web steiner
Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen
Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.
+43/2624/54014 - office@websteiner.com
Schloss Greinburg
Grein, September 2023
Das älteste Wohnschloss Österreichs mit seinen Highlights – Renaissancearkadenhof, Diamantgewölbe, Sala Terrena, Großer Rittersaal mit Kapelle – ist einen Besuch wert. Schloss Greinburg ist im Besitz der herzoglichen Familie Sachsen-Coburg-Gotha. Hier ist auch das OÖ. Schifffahrtsmuseum beheimatet.„Die Perle des Strudengaus“ wird das alte Donaustädtchen Grein von den Dichtern genannt.

Der Flößer von Grein
Der Strudengau war jahrhundertelang der gefährlichste Donauabschnitt
für Schiffsleute und Flößer. Die Gestalt des unbekleideren Flößers, der
Strudel und Wirbel bezwingt, ist Sinnbild fur den im Lebenskampf
stehenden Menschen schlechthin. Durch die fehlende Kleidung ist die
Figur keiner bestimmten Epoche zugeordnet, Sie wird über das begrenzt
Zeitliche und Örtliche hinausgehoben. Freilich - der Kampf des Menschen
gegen die Urgewalten der Natur hat sich gewandelt, aber auch mit all
seiner Technik kann der Mensch die Natur nicht endgültig bezwingen, sie
nicht endlos ausbeuten und vergewaltigen. Er überlebt nur, wenn er
wieder lernt, sich selbst als Teil dieser Natur zu begreifen. In den
Jahren 1987/88 schuf der Bildhauer Magnus Angermeier diese Skulptur des
Flößers für die Raiffeisenbank Grein. 2014 wurde die Figur der Stadt
Grein als Leihgabe gewidmet.
Im Hintergrund: Die prachtvolle Herndl-Villa mit Nebengebäude und eigenem Donauzugang

Die Kalvarienbergkapelle wurde
1967 bis 1969 hier auf dem verbliebenen Teil des Schwalleck-Felsens
nach einem Entwurf von Architekt Rupert Bruckner errichtet. Früher
reichte dieses Felsplateau weit in die Donau hinein und wurde beim
Kraftwerksbau Ybbs-Persenbeug gesprengt. In der Kapelle stehen die
lebensgroßen Figuren des Gekreuzigten, der beiden Schächer sowie der
Hl. Maria, Hl. Magdalena und des Hl. Johannes. Die Figurengruppe gehört
zu den künstlerisch bedeutendsten dieser Art in Österreich und wurde
von Johann Worath um 1660 geschaffen. Im Jahr 2015 wurden die Figuren
restauriert. Die Figuren befanden sich ursprünglich im Bereich des
Franziskanerklosters, später an der Donaulände, ab 1893 waren sie in
der Kapelle in der Berggasse und seit 1967 sind sie in dieser Kapelle
aufgestellt.

Die historische Stadt Grein/Donau ist der Hauptort des Strudengaus. Sie
wurde 1491 zur Stadt erhoben und ist damit die drittälteste Stadt des
Mühlviertels. Das historische Stadttheater in Grein (1791) ist das
älteste erhaltene bürgerliche Theater Österreichs. Schloss Greinburg
wurde von 1488 bis 1493 erbaut und gilt als eine der ersten
Schlossbauten im deutschsprachigen Raum! Hochkarätige Veranstaltungen
wie die Donaufestwochen, Sommerspiele Grein, BrassFestival,
JazzFestival zeichnen Grein aus.
Die Kulturlandschaft des Strudengaus ist durch den Donaueinschnitt mit
den steil abfallenden Felsen geprägt. Wanderwege mit fulminanten
Ausblicken auf das Donautal und die Alpenkette im Süden, Kraftplätze
wie der Marienstein, Mondstein oder der Frauenstein, tiefe Schluchten,
hoch aufragende Felswände und nicht zuletzt die unberührte Natur machen
die Region einzigartig. Grein liegt in der Mitte, am Donauradweg von
Passau nach Wien, zusätzlich gibt es ein großes regionales Radwegenetz.
Der Donausteig endet knapp unterhalb von Grein. Viele Rundwanderwege
wie etwa in die Stillensteinklamm oder zur Gobelwarte laden zum Wandern
ein. Die Rad- und Personenfähre d'Überfuhr von Grein (OÖ) nach Wiesen
(NÖ), eine Kletter- und Boulderhalle, ein Freibad und Tennisplätze
runden das Freizeitangebot ab.
Panoramablick vom Kalvarienberg
auf Grein. Von diesem Aussichtspunkt kann man einen sehr schönen
Panoramablick auf Grein und die Donau genießen.

Petroglyphen am Kalvarienberg in Grein
In Granit gemeißelte Nachrichten vorchristlicher Kulturen waren für den
Mostviertler Bildhauer Miguel Horn die Motivation, Informationen über
unsere Zeit in einer einfachen Symbolsprache in Stein dauerhaft
festzuhalten. Laut Horn sollte es uns allen bewusst sein, dass die
Folgen unseres Umgangs mit Mensch und Natur von späteren Generationen
getragen werden müssen.
Miguel Horn
1948 in Passau geboren, lebte 20 Jahre in Chile, mehrjährige
Arbeitsaufenthalte in Italien, Frankreich und USA. Seit 1981 wohnhaft
in Neuhofen an der Ybbs. Mit seinen Arbeiten nimmt er zu den negativen
Auswirkungen unseres Wohlstands Stellung: Verlust der Individualität,
Zurückdrängung indigener Völker, Zerstörung letzter Naturreservate, um
nur einige zu nennen.

Das Halterkreuz wurde
seinerzeit vor dem Schwalleck, einem ehemals gefährlichen
Stromhindernis errichtet ("Greiner Wirbel"). Der Sage nach wohnte vor
vielen Jahren bei der Überfuhr über den Schwall ein Halter (Hirte) der
Stadt Grein. Dieser hütete bei Hochwasser in der Nähe des Schwalls das
Vieh. Während dieses weidete, versuchte der Hirte das Treibholz aus der
Donau aufzufangen. Mit dem schwimmenden Holz deckte er den
Brennholzbedarf im Winter. Als er einen langen Baumstamm ans Ufer
anheften wollte, rutschte er aus und fiel ins Wasser. Gerade noch
rechtzeitig konnte sich der Nichtschwimmer an dem Baumstamm anklammern
und trieb so hilflos im Schwall umher. In seiner Angst machte der
Halter das Gelöbnis, wenn er gerettet werde, am Ufer ein Kreuz zu
errichten. Da trieb die Strömung den Baum so nahe ans Ufer, daß der
Halter den Ast eines herabhängenden Baumes erreichen konnte und so
glücklich gerettet wurde. Der Halter hielt sein Gelöbnis, und seit
dieser Zeit steht dort das sogenannte Halterkreuz.

DAS HALTERKREUZ
VOR VIELEN VIELEN JAHREN STÜRZTE EIN HIRTE BEI DEM VERSUCHE EINEN
TREIBENDEN BAUMSTAMM AUFZUFANGEN, IN DIE HOCHGEHENDEN FLUTEN DES
DONAUSCHWALLES * IN SEINER TODESNOT GELOBTE ER DIE ERRICHTUNG EINES
KREUZES * ER WURDE GERETTET UND STIFTETE EIN SCHLICHTES KREUZ AUS HOLZ
- DAS "HALTERKREUZ" * DAS HOLZ WURDE MORSCH * EIN EHERN KREUZ WURDE
1937 AUFGESTELLT, UM WEITERHIN DES FROMMEN HALTERS SINN ZU KÜNDEN * DER
DONAUSCHWALL VERSCHWAND DURCH SPRENGUNG IN DEN JAHREN 1956-1958 * WO
DAS KREUZ STAND FLIESST BREITER JETZT DER STROM * EIN NEUES KREUZ WURDE
ERRICHTET, UM ALLEN DIE VORÜBERZIEHN, ZU ZEIGEN: SCHUTZ IST UND HALT IM
KREUZ DES HERRN *

Schon mehr als 500 Jahre wacht Schloss Greinburg majestätisch und
mächtig über der Stadt Grein und der Donau. Österreichs ältestes
Wohnschloss stammt aus dem Spätmittelalter. Im Inneren dominiert der
großzügige Renaissancehof mit schmuckvollen Arkadengängen. Weitere
Höhepunkte der Besichtigung sind der beeindruckende Rittersaal, die
Schlosskapelle mit ihrem frühbarocken Weihnachtsaltar, das einzigartige
Diamantgewölbe mit seinem faszinierenden Licht- und Schattenspiel und
die mit Donaukieseln dekorierte Sala Terrena. Seit 1823 gehört Schloss
Greinburg zum Besitz der herzoglichen Familie Sachsen-Coburg und Gotha.
Das Fürstengeschlecht erlangte im Laufe des 19. Jahrhunderts
europäische Bedeutung ihm entstammen die Königshäuser von England,
Belgien, Portugal und Bulgarien, sowie die Mutter des heutigen Königs
von Schweden. Die Festräume der Herzoglichen Familie von Sachsen-Coburg
und Gotha bieten noch heute einen glanzvollen Rahmen für
Feierlichkeiten der herzoglichen Familie. Die wertvolle Ausstattung mit
Möbeln und Porträts berühmter Familienmitglieder stammt aus dem
Privatbesitz der ehemaligen Herzöge und Queen Victoria von England.

Die Schifffahrt war bis vor 100 Jahren der bedeutendste
Wirtschaftsfaktor für die Stadt Grein. Grein war die letzte Station vor
dem gefährlichen Donautal, dem Strudengau. Mautgebühren, besondere
Lade- und Handelsrechte und der durchlaufende Händlerverkehr ließen die
Stadt florieren und begründeten den herrschaftlichen Bau des Schlosses.
Die OÖ Landes-Kultur GmbH präsentiert in einem Zweigmuseum die
Geschichte der verkehrstechnischen Nutzung der Donau und ihrer Zuflüsse
Inn, Salzach, Enns und Traun.
Die Kapelle am Kalvarienberg
beherbergt bemerkenswerte lebensgroße Figuren von Johann Worath aus der
Mitte des 17. Jahrhunderts (Christus und die Schächer auf den Kreuzen
sowie die Assistenzfiguren Johannes, Maria und Maria Magdalena).

Grein ist seit 1491 die drittälteste Stadt des Mühlviertels und
Hauptort des Strudengaus. Dank des regen Schiffsverkehrs auf der Donau,
blühte die Wirtschaft schon seit jeher in Grein. Auch heute noch ist
Grein Standort zahlreicher Gewerbebetriebe, Fachgeschäfte und
Dienstleistungsbetriebe, die mit Qualität und Persönlichkeit punkten.

Im Jahre 1622 gründete Leonhard Helfried Graf Meggau das Franziskanerkloster
als gegenreformatorisches Zentrum im oberösterreichischen Donautal. Die
stattliche Anlage umfasste neben dem Konvent mit der Klosterkirche nach
Osten hin die Lorettokirche, das Heilige Grab und den Kalvarienberg.
Über eine gedeckte Stiege konnten Pilger von der Donau her das
Klosterareal erreichen. Auf mehreren Ebenen verfügte das Kloster auch
über einen großen Nutzgarten, einen Ziergarten und einen Pavillon. 1784
wurde der Konvent von Joseph II. aufgehoben, hernach diente das Gebäude
als Armenhaus, Amtshaus und Gefängnis. Als „Haus St. Antonius" wird es
heute für Besinnungstage, Gebetstreffen und Exerzitien genutzt.

„Die Perle des Strudengaus“ wird das alte Donaustädtchen Grein von den
Dichtern genannt. Seit 1491 besitzen die Bürger von Grein die
Stadtrechte. Im Mittelalter als das „goldene Städtchen“ weithin
bekannt, bezaubert Grein heute mit seinem nostalgischen Charme.

Ackerbürgerhaus
Ein Bauernhaus innerhalb des beengten Stadtraumes ist selten.
Ackerbürgerhäuser sind historische Stadthäuser, die für einen
Landwirtschaftsbetrieb geeignet waren und über einen Hof und eigene
Wirtschaftsgebäude verfügten.
Das östlich freistehende Haus stammt aus dem Spätmittelalter und wurde
um 1500 erbaut. Im linken Gebäudeteil befand sich bis 1966 eine
Fleischerei während im rechten Teil bis 2002 ein Uhrmacher logierte.
Noch heute findet sich im rechts gelegenen Geschäftsraum eine mit 1642
bezeichnete Tramdecke, die nach dem großen Stadtbrand errichtet wurde.
Über lange Zeit bestimmend für das Ortsbild waren die beiden
Kastanienbäume, die der Fleischerei als Sonnenschutz dienten.

Nagelschmiede & Werkstätte
Eer im 16. Jahrhundert entstandene, breit gelagerte Bau wurde 1905 um
ein Stockwerk erhöht und mit einem viereckigen Erkertürmchen versehen.
Lange Zeit stand dahinter noch das Haus Nr. 9, bis es baufällig 1978
abgebrochen wurde. Im vorderen Gebäude befanden sich unter anderem eine
Bäckerei und eine Nagelschmiede. In der Zwischenkriegszeit beherbergte
es neben kleinen Wohnungen einen KFZ-Betrieb mit Tankstelle und
Mietwagenservice. Die Werkstätte lag im dahinterliegenden Haus, bis
dort anschließend ein Malerbetrieb einzog.
Seit 1946 versorgt eine charmante kleine Trafik ihre Kunden mit Tabakwaren, Zeitungen, Schreibutensilien und Ansichtskarten.

Wetterstation Grein - Wunderschönes Wetterhäuschen am Platz vor der Stadtpfarrkirche
ERRICHTET AUS ANLASS DES 25. JÄHRIGEN BESTANDES VERSCHÖNERUNGSVEREINES GREIN 1880-1905.

Druckerei & Zeitungsverlag
Ursprünglich war es ein Schul- und Mesnerhaus. Das nach Süden leicht
abgerundete Gebäude wurde im 15. Jahrhundert an den Turm der
Pfarrkirche angebaut. Städtebaulich schloss es damit den Stadtplatz
wirkungsvoll nach Osten hin ab. Um 1700 erfuhr das spätgotische Gebäude
kleinere Umbauten. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts beherbergte es eine
Lithographische Anstalt, Buchdruckerei, Papierhandlung, ein
Schreibwarengeschäft sowie die Wohnung seiner jeweiligen Besitzer. 1906
gründete der Buchdrucker Johann Michael Hiebl hier einen
Zeitungsverlag. Bis 1939 erschien samstäglich das „Greiner Wochenblatt"
mit lokalen Nachrichten, Kulturberichten, Kurzgeschichten und
Feuilltons.

Gasthof & Lichtspieltheater
Das mächtige Doppelhaus mit dem markanten Eckturm wurde in der ersten
Hälfte des 16. Jahrhunderts erbaut. In alter Zeit war der Turm
unterhalb des Daches mit Schießscharten versehen, die der Verteidigung
des Stadtplatzes dienten. Das breite Gebäude beherbergte den Gasthof
„Zum Goldenen Löwen" mit dazugehöriger Fleischerei. 1920 wurde im
ersten Stock ein Lichtspieltheater eingebaut, in dem anfänglich
Stummfilme zu sehen waren. Ein beliebter Ausgangspunkt für Wanderungen
und Fahrradausflüge war das nach dem Besitzer Georg Laimer benannte
„Laimer-Eck". An der Hausfassade waren Hinweistafeln angebracht, die
Gästen wie Einheimischen die schönsten Routen markierten.

Historischer Stadtplatz und Stadtbrunnen
Am Stadtplatz, sowie entlang der Hauptstraße sehen wir vorwiegend zwei-
und dreigeschossige Ackerbürgerhäuser auf langgestreckten
mittelalterlichen Parzellen. In vielen dieser Häuser haben sich noch
zahlreiche spätmittelalterliche Bauteile erhalten, es fanden jedoch
viele Um- und Neubauten in der 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts und in
der 1. Hälfte des 17. Jahrhunderts, vor allem nach dem großen
Stadtbrand im Jahr 1642 statt. Besonders sehenswert das Alte Rathaus
mit dem Historischen Stadttheater (Stadtplatz 7), das ehemalige
Schiffsmeisterhaus mit dem Arkadenhof (Stadtplatz 6) und das ehemalige
Mesnerhaus (Hauptstraße 2).
Der Stadtbrunnen am Stadtplatz wird auch Meggaubrunnen genannt und
stammt aus dem Jahr 1872. Die Greiner Bürger setzten dem Grafen
Leonhard Helfrich Meggau — er war Besitzer der Greinburg und vielfältig
sozial engagiert — ein steinernes Denkmal.

Die Geschichte der Donaustadt Grein im Überblick
Im Jahre 1147 wurde Grein unter dem Namen „grine“ erstmals urkundlich
erwähnt. Die Donau prägte die Entwicklung der Stadt, da sie wie eine
Kulisse an ihrem Ufer liegt. Unterhalb von Grein verengt sich das
Donautal und die aus dem Flussbett aufragenden Felsen bildeten
Stromschnellen von größter Gefährlichkeit, die sogenannten „Strudel“
und „Wirbel“. Ortsunkundige konnten die Hindernisse nur mit der Hilfe
von Lotsen sicher passieren. Die erfahrenen Lotsen von Grein führten
die Flöße und Schiffe sicher durch diese Schifffahrtshindernisse, sehen
kann man das heute noch am Greiner Stadtwappen, verliehen im Jahre
1468. Es zeigt den Donaustrom mit den Felsen, ein Schiff (Klobzille)
mit drei Schiffsleuten, davon in der Mitte der Lotse.
Privilegien, Handelsrechte, blühendes Handwerk in Zusammenhang mit der
Schifffahrt führten zu einem wirtschaftlichen Aufschwungin Grein und
bildeten die Grundlage für den Wohlstand des Bürgertums. Der Habsburger
Kaiser Friedrich III. übertrug 1488 die Herrschaft Grein an die Brüder
Prüschenk und sie erhielten das Recht ein Schloss zu bauen. Der Markt
Grein wurde vom Kaiser 1491 zur Stadt erhoben. Grein schreibt demgemäß
eine über 500jährige Stadtgeschichte und ist heute mit über 3000
Einwohnern eine der kleinsten Städte in Oberösterreich.

Der Stadtbrunnen am Historischen Stadtplatz von Grein, auch
Meaggaubrunnen genannt, stammt aus dem Jahr 1872. Benannt wurde der
Brunnen nach dem Grafen Leonhard Helfrich Meggau - er war Besitzer der
Greinburg. Die Greiner Bürger setzten dem Grafen Meggau, der sich
sozial für die Greiner engagierte, am Stadtplatz ein steinernes Denkmal.

Altes Rathaus
Das Alte Rathaus von Grein wurde 1563 vom italienischen Baumeister Max
Canaval vom Comosee errichtet. Der Bau folgt architektonisch einem
Handelshaus des 16. Jahrhunderts und besteht heute noch in seiner
unveränderten Form. An regnerischen Markttagen wurden im
Eingangsbereich die Waren angeboten. Dem Rathaus war auch ein
Getreidespeicher angefügt, der 1791 zu einem Theater umgebaut wurde.
Historisches Stadttheater (1791) und Stadtmuseum
Das Historische Stadttheater in Grein ist das älteste erhaltene
bürgerliche Theater Österreichs und Teil der Europäischen Route
Historische Theater, ein Juwel, das von vielen Besuchern aus nah und
fern besichtigt wird. Begeisterte Amateurschauspieler richteten es im
Jahre 1791 im Getreidespeicher der Stadt ein. Das vorgelagerte Alte
Rathaus (um 1563) ist heute Museum. Nach der Generalsanierung 2020/2021
erstrahlt das Haus in vollem Glanz und ist barrierefrei erreichbar.
Viele Besonderheiten aus vergangener Zeit sind hier zu sehen: Original
erhaltene Sperrsitze, die man mit einem kleinen Schlüssel auf- und
zusperren konnte; ein Abort, nur durch einen Vorhang vom Zuschauerraum
abgetrennt, ein Gefängnisraum direkt neben dem Theatersaal; die
berühmte Napoleonloge und vieles mehr. Im neu gestalteten Stadtmuseum
erfahren Sie mehr über die wechselvolle Geschichte der Stadt und die
Theatergeschichte des Hauses. Es gibt eine lebendige Theatertradition,
die mit Unterbrechungen bis ins 18. Jahrhundert zurückreicht. Das
Stadttheater ist ganzjährig bespielt.

SCHLOSS GREINBURG: 1488 bewilligte Kaiser Friedrich III. den Brüdern
Heinrich und Siegmund Prüschenk, Freiherrn von Stettenberg, ein Schloss
zu errichten. Das Schloss in Grein sollte der Sicherung des Machlandes
gegen feindliche Einfälle dienen. 1534 gelangte das Schloss in den
Besitz des kaiserlichen Pfennigmeisters Johann Loeble. Seine Tochter
vermählte sich mit Rudolf von Sprinzenstein, der 1621 das Schloss an
den Grafen Leonhard Helfried von Meggau verkaufte. Über Graf Meggaus
Tochter Anna kam Schloss Greinburg in den Besitz der Familie
Dietrichstein. 1709 erwarb Franz Ferdinand Graf von Salburg das
Schloss. Durch Erbschaft gelangte das Schloss 1810 an Josef Karl Fürst
von Dietrichstein, der es 1817 an den Armeelieferanten Michael Fink
verkaufte. 1823 erwarb Herzog Ernst I. von Sachsen-Coburg und Gotha
Schloss und Herrschaft Greinburg. Ihn beerbten seine Söhne Ernst II.
und Albert, Prinzgemahl der britischen Königin Victoria, so dass nach
dem frühen Tod ihres Gemahls auch Queen Victoria Mitbesitzerin von
Schloss Greinburg wurde. Heute befindet sich das Anwesen im Besitz der
Nachkommen des vierten Sohnes von Victoria und Albert - Prinz Leopold,
Duke of Albany. Derzeitiger Chef des Hauses ist Andreas Prinz von
Sachsen-Coburg und Gotha.
Zwei Gebäudekomplexe erheben sich auf dem schroff abfallenden
Donaufelsen. Das hohe Schlossgebäude stammt vorrangig aus der Zeit um
1500. Das niedrigere Wirtschaftsgebäude (nicht öffentlich zugänglich)
wurde während des 17. Jahrhunderts errichtet.

Donaublicke und Donaupromenade
Am Kalvarienberg und am Donaublick im Schlosspark bietet sich dem
Betrachter jeweils ein herrlicher Blick von oben auf die Stadt Grein
und die Donau. Direkt an der Donau lädt die neue Promenade — vom
Esperantoplatz im Westen bis zum Halterkreuz im Osten — zum Spazieren
und Verweilen ein. Am Esperantoplatz befindet sich neben der
Anlegestelle der Donauradfähre auch die Sonnenuhr des Greiner Physikers
Dr. Werner Riegler.

Die Erbauer von Schloss Greinburg waren die Brüder Heinrich und
Siegmund Prüschenk. Als wichtige Geldgeber von Kaiser Friedrich III.
erhielten sie im Gegenzug am 10. März 1488 die kaiserliche Erlaubnis
zum Bau des Schlosses. Nach nur vier Jahren Bauzeit (1491-1495) stand
das Gebäude in seinen heutigen Ausmaßen. Das imposante Gebäude mit
seiner großzügigen Konzeption ist nicht mehr als Burg zu bezeichnen,
sondern gilt als einer der ersten Schlossbauten im deutschsprachigen
Raum.
Schloss und Herrschaft Greinburg samt ausgedehnter Ländereien erfuhren einen häufigen Besitzerwechsel:
1533 kaiserlicher Rat Johann Löbl
1621 Graf Leonhard Helfrich von Meggau
1644 Graf Ludwig Sigmund von Dietrichstein
1709 Franz Ferdinand von Salburg und Prandegg
1810 Graf Joseph Karl von Dietrichstein
1816 Bürgermeister Michael Fink
1823 erwarb schließlich der deutsche Herzog Ernst I. von Sachsen-Coburg
und Gotha Schloss und Herrschaft Greinburg. Das Gebäude befindet sich
bis heute im Besitz der herzoglichen Familie, die für die Erhaltung und
öffentliche Zugänglichkeit Sorge trägt.

Der Zugang des Schlosses führt seitlich in einen mächtigen Torturm. Für
die Funktion dieses spätmittelalterlichen Wehrbaues sind dicke Mauern
mit schräg verlaufenden Außenflächen und der winkelige Verlauf des
Durchgangs typisch. Denn hier, an der einzigen leicht zugänglichen
Seite, war das Schloss in Kriegszeiten am stärksten gefährdet. Es
bedurfte daher einer zusätzlichen Befestigung zur Abwehr gegnerischer
Geschosse.
Das Innere des Schlosses empfängt den Eintretenden mit einem Blick in den prachtvollen Arkadenhof.
Von Säulen getragene Bogengänge schmücken die vier Gebäudeflügel
einheitlich über alle drei Geschoße. Die Arkaden wurden um 1600/1700
errichtet und bieten den repräsentativen Rahmen für große Feste und
Empfänge.


Zur Linken betreten Sie nun den Kutschenraum, in dessen Mitte die
Kutsche von Herzog Karl Eduard von Sachsen-Coburg und Gotha steht. Er
war der letzte regierende Herzog der Familie Sachsen-Coburg und Gotha.

Schloss Greinburg wurde von 1491 und 1495 von den Brüdern Heinrich und
Siegmund Prüschenk als eines der ersten Schlösser im deutschsprachigen
Raum errichtet. Das heutige Aussehen erhielt das Schloss unter Graf
Leonhard Helfrich von Meggau, welcher das Bauwerk 1621 erwarb. Das
Schloss wechselte in der Folge mehrmals seine Besitzer. Seit 1823 ist
es im Besitz der Herzöge von Sachsen-Coburg und Gotha. Viele imposante
Festräume sind hier zu entdecken: einer der größten und schönsten
Arkaden-Innenhöfe der Spät-Renaissance, ein gotisches Zellengewölbe,
der in seinem Ausmaß beeindruckende Große Rittersaal mit Schlosskapelle
und einem der schönsten Weihnachtsaltäre Österreichs und nicht zu
vergessen die mit Mosaiken aus Donaukieseln dekorierte Sala Terrena.
Nur mit Führung zu besichtigen sind die privaten Herzoglich
Sachsen-Coburg und Gotha‘schen Festräume. Auf Schloss Greinburg
befindet sich auch das OÖ Schifffahrtsmuseum. Viele Modelle und
Darstellungen zeigen den Transport auf der Donau und ihren Nebenflüssen.

Das Diamantgewölbe stammt aus
der spätmittelalterlichen Entstehungszeit des Gebäudes. Es ist in
Österreich das einzige seiner Art und beweist den außerordentlich hohen
Qualitätsstandard, der beim Bau von Schloss Greinburg angelegt wurde.
Das zarte Wunderwerk mit seinem faszinierenden Licht- und Schattenspiel
schuf vermutlich der sächsische Baumeister Hans Cölin von der Bauhütte
der Albrechtsburg in Meißen.


Gemälde der Kapellentür
Die Türflügel des Kapellenzugangs zeigen in offenem Zustand sechs
Szenen aus der Lebensgeschichte des heiligen Leonhard von Noblat. Graf
Meggau (1577-1644), der Erbauer von Rittersaal und Schlosskapelle, hieß
mit Vornamen Leonhard demnach ist die Kapelle seinem Namenspatron
gewidmet. Der hl. Leonhard gilt als Schutzpatron der Schwangeren, der
Gebrechlichen und derjenigen, "die in Ketten liegen" gemeint waren
nicht nur Gefangene, sondern auch psychisch Kranke (die früher
angekettet wurden), sowie Haustiere, v. a. Pferde; auf letztere bezieht
sich der sogen. „Leonhardiritt" am 6. Nov., dem Festtag des Heiligen
(gest. angebl. 6.11.559)
Die Flügeltüren zeigen folgende Szenen aus der Heiligen-Vita:
1 Die am Merowingerhof lebende fränkische Adelsfamilie lässt ihren um
500 n. Chr. geborenen Sohn Leonhard durch Erzbischof Remigius von Reims
taufen ...
2 und unterrichten.
3 Leonhard besucht täglich Gefangene und erreicht bei König Chlodwig ihre Freilassung.
4 Leonhard gewinnt an Ansehen, ihm wird ein Bistum angeboten, doch er
lehnt ab. Stattdessen zieht er sich in die Wald-einsamkeit bei Limoges
zurück, predigt von seiner Zelle aus und tut Wunder (heilt Gebrechen).
5 In das nahe gelegene Jagdschloss kommt König Chlodwig mit seiner
schwangeren Frau. Unerwartet setzen bei ihr die Wehen ein. Leonhard
betet auf Bitten des Königs an ihrem Lager. Die Königin gebiert den
ersehnten Sohn. Chlodwig will Leonhard reich entlohnen, doch Leonhard
erbittet sich nur ein Waldgelände von der Größe, wie er es in einer
Nacht mit einem Esel umreiten kann. In diesem Waldstück gründet
Leonhard das Kloster Noblac (bei Limoges).
6 Leonhard stirbt als Abt in seinem Kloster, wo er bis heute verehrt wird.

Graf Meggau war ein Anhänger der Gegenreformation und entschiedener
Verfechter der Rekatholisierung von Oberösterreich. Auf ihn ist wohl
auch der Einbau der Schlosskapelle zurückzuführen. Sie ist in einem der
mittelalterlichen Ecktürme untergebracht. Ganz ungewöhnlich ist die
räumliche Anordnung, denn die Kapelle ergänzt den Rittersaal — wie ein
Altarraum das Langhaus einer Kirche.

Die zweiflügelige Tür zeigt in geöffnetem Zustand die Geschichte des
Heiligen Leonhard (Namenspatron des Grafen Leonhard Helfrich Meggau).
Der Kapellenraum beherbergt einen außergewöhnlich qualitätvollen
Barockaltar mit Szenen aus der Weihnachtsgeschichte und der Anbetung
des Hirten als Mittelbild. Bemerkenswert ist auch die statische
Konstruktion an der Rückseite des Altars.

Der Große Rittersaal ist das Kernstück des Schlosses. Mit seinen
überwältigenden Dimensionen (33 m lang, 16 m breit und 14 m hoch) gilt
er als größter einheitlich gewölbter Renaissance-Saal Österreichs.
Seine Wände schmücken Portraits aus dem 17. Jahrhundert. Sie zeigen
unter anderem die vollständige Reihe der Habsburg-Herrscher von König
Rudolf (gest. 1291) bis Kaiser Ferdinand II. (gest. 1637). Der Erbauer
des Rittersaals, Graf Meggau, bekleidete als Obersthofmarschall am
kaiserlichen Hof Ferdinands II. die zweitmächtigste Stelle im Reich.
Schloss Greinburg: Rittersaal - Hof- & Zugangsseite
Kaiser Ferdinand II. (*1578, König/Kaiser 1619-1637)
Kaiser Matthias (*1557, König/Kaiser 1612-1619)
Ernst Rüdiger Graf Starhemberg (1638-1701) kaiserl. Feldmarschall
Kaiser Rudolf II. (*1552, König 1575, Kaiser 1576-1612)
Karl V. Herzog zu Lothringen (1643-1690) kaiserl. Generalleutnant

Die kostbare Ausstattung mit Möbeln und Gemälden aus dem Privatbesitz
der herzoglichen Familie vermittelt einen Einblick in den spannenden
Aufstieg des Herzogshauses Sachsen-Coburg und Gotha zur europäischen
Dynastie. Dem Adelsgeschlecht entstammen die Königshäuser von Belgien,
Portugal, Großbritannien und Bulgarien. Die letzte Königin von Italien
und die Mutter des heutigen schwedischen Königs sind Coburger
Prinzessinnen. Auch Kronprinz Rudolf wählte mit Prinzessin Stephanie
eine Coburgerin zur Gattin. Sein tragischer Freitod in Mayerling 1889
beendete jedoch jäh die Hoffnung auf ihre Krönung zur Kaiserin von
Österreich.

Schloss Greinburg: Rittersaal - Hof- & Zugangsseite
König Albrecht II. (*1397, König 1438-1439)
Herzog Friedrich IV. (*1382-1439; Herzog v. Österreich, Graf v. Tirol)
König Albrecht I. (*1255, König 1298-1308)
König Rudolf I. (*1218, König 1273-1291)
Raimondo Graf Montecúccoli (1609-1680) kaiserl. Feldmarschall
Leopold Philipp Fürst Montecúccoli (1663-1698) kaiserl. Feldmarschall
Nikolaus VI. Graf Pálffy zu Erdöd (1667-1732) kaiserl. Feldmarschall
Carl Graf Sereni kaiserl. Feldmarschall
Franz Sebastian Graf Thürheim (1665-1726) kaiserl. Feldmarschall
Unbekannt
Leonhard Helfried Graf von Meggau (1577-1644)
1621-1644 Besitzer von Schloss Greinburg
Erbauer des Rittersaals, der Kapelle mit Weihnachtsaltar und der Sala Terrena im EG
Graf Meggau war Obersthofmeister unter Kaiser Ferdinand II.
demzufolge ist Meggau vermutlich der Auftraggeber der 12 Habsburger-Reiterportraits
Max Emanuel Kurfürst von Bayern (1662-1726)
Unbekannt

Oberhalb der Stiege gelangt man links in den Kleinen Rittersaal. Hier
entfaltet sich an der Decke ein feines Beispiel frühbarocker
Stuckdekoration. In diesem und den beiden gegenüberliegenden Sälen
wurde 1970 das OÖ Schifffahrtsmuseum eingerichtet.
DAS OBERÖSTERREICHISCHE SCHIFFFAHRTSMUSEUM GREIN
Seit 1970 befindet sich der größte Teil der schifffahrtsgeschichtlichen
Bestände des OÖ. Landesmuseums in Schloss Greinburg. Das Museum, das
auf Initiative der Herzogin Viktoria Adelheid von Sachsen-Coburg und
Gotha eingerichtet wurde, beschäftigt sich mit der Schifffahrt auf
oberösterreichischen Gewässern. Die ausgestellten Objekte sind
detailgetreue Modelle der Floß-, Ruder- und Dampfschifffahrt. Neben
diesen finden sich auch solche, die dem Wasserbau gewidmet sind. Ein
Teil der Modelle wurde 1958 im Zuge einer Großausstellung hergestellt.
Sie veranschaulichen die Beschwernis des damaligen Berufsbildes um die
Schifffahrt. Besonders sehenswert ist die noch erhaltene originale
museale Einrichtung aus dem Jahr 1970, da diese quasi als „Museum im
Museum" anzusehen ist und einen selten in dieser Qualität greifbaren
Charme aufweist.
RAUM 1 - DIE DONAUSCHIFFFAHRT
Dieser Raum ist der heimischen Schifffahrt auf der Donau gewidmet.
Daneben werden die beiden Welten, die in der 1. H. 19. Jh. aufeinander
stießen, thematisiert: Tradition gegen Moderne. Mit Unterstützung von
englischem Know-how wurden Schiffe für die Binnenschifffahrt mit
Dampfmaschinen ausgerüstet. Da 1830 die überhitzten Dampfkessel häufig
explodierten, wurde der erste Donaudampfer Carolina noch nicht als
Personenschiff gebaut, sondern diente als Zugschiff für Lastkähne des
Personentransportes. 1837 konnten auf dem Dampfer Maria Anna erstmals
Personen transportiert werden. Dieser Meilenstein beeinflusste die
spätere Donauregulierung und leitete das Ende der traditionellen
Flößerei und Schifffahrt, des Handwerks und der Zunft ein. Die
Schiffleute hielten sich neben der Dampfschifffahrt bis etwa 1850, das
endgültige „Aus" brachte ein weiterer Konkurrent: die Eisenbahn.

Die außergewöhnliche Sammlung detailgetreuer Modelle ist eine Feingabe
des OÖ Landesmuseums. Thema ist die wirtschaftliche Nutzung der
Wasserstraßen von Donau, Inn, Enns, Salzach und Traun. Die
kleinformatigen Nachbauten zeigen eine Vielzahl unterschiedlichster
Schiffe, Boote und FIlöße sowie komplexe Konstruktionen zur
Wasserregulierung. Sie lassen das ungeheure Ausmaß an Mühe und
Einfallsreichtum erahnen, mit dem der Mensch den gefahrenvollen Fluten
zu trotzen versuchte.
Ansicht von Grein, Öl, um 1700, Öl auf Leinwand, Gemäldesammlung der Greinburg
Das Bild entstammt einer Serie von zehn Ansichten, auf denen zur
Greinburg gehörende Besitzungen dargestellt sind. Das Aussehen von
Schloss und Stadt entspricht hier noch weitgehend dem bekannten, 1649
erschienenen Kupferstich Matthäus Merians. So zeigt etwa der Kirchturm
noch seine barocke, erst 1804 veränderte Form. Besonders bemerkenswert
sind die Darstellungen verschiedener Fahrzeuge auf der Donau.

Modell der Urfahraner Schiff(s)mühle, einst an der Urfahrwänd gelegen, Holz, gefasst
Dieser Mühlentyp geht auf den römischen Bauingenieur Vitruv (1. Jh. v.
Chr.) zurück. Schiff(s)mühlen befanden sich auf größeren Flüssen
Österreichs. Sie bestanden aus dem, dem Land näher gelegenen,
Hausschiff und dem kleineren Weitschiff. Dieses beherbergte die
Antriebswelle des (unterschlächtigen) Mühlrades, das ständig mit
gleichbleibender Wassermenge versorgt wurde. Die Plattform, die an der
strömungsintensivsten Stelle des Flusses verankert und am Ufer od. an
Brückenpfeilern vertäut wurde, schwamm unabhängig vom sich ändernden
Wasserstand. Schiff(s) mühlen produzierten zu allen Jahreszeiten,
ausgenommen im Winter, wo sie ans Ufer gebracht wurden. In 24 Stunden
konnten sie etwa 1,5 Tonnen Getreide mahlen.
WUSSTEN SIE? Zwischen Urfahr und Ottensheim (km 9,4) befindet sich
heute die Bahn-haltestelle „Schiffmühle" bei km 2,4. Sie erinnert an
die Urfahraner Schiff(s)mühle.

Die Donaudampfschifffahrt
Obwohl das Kaiserreich Österreich als Donaumonarchie bezeichnet wurde,
hat man die Bedeutung der Donau als Verkehrsweg bis 1800 stark
unterschätzt. Österreich war der einzige christliche Staat, der laut
den Bestimmungen des Friedens von Passarowitz 1718 die untere Donau im
türkischen Einflussgebiet befahren durfte. Das Bewusstsein um die
Bedeutung der Donau änderte sich nach 1800: 1817 definierte man in
einem Hofdekret, dass fortan die Dampfmaschine als Schiffsantrieb
dienen sollte. Das erste Donaudampfschiff Carolina durfte ihre Fahrt
1830 antreten.
Modell des Raddampfers Franz Schubert
Originalmaße: L 67,2 x b 7,8; über den Radkasten 14,8 m × h 2,7 m
Typ: Fahrgastschiff, Dampfantrieb mit Heizölfeuerung, Raddampfer, Dampfmaschine: 740 PS
Eine neue Type stellten die 1912 von der DDSG auf der Linzer
Schiffswerft erbauten Eildampfer wie die „Franz Schubert" (in der
Monarchie als „Erzherzog Franz Ferdinand" bezeichnet) dar. Dieser
Dampfer wurde 1913 in Betrieb genommen und hatte im Unterschied zur
bisher gebräuchlichen Anordnung die 1. Klasse vorne. Dieses für 1250
Personen eingerichtete Fahrgastschiff wurde mit Heizöl befeuert.

Modell des k.k. privilegierten Seitenraddampfers Maria Anna der Ersten k.k. privilegierten Donau-Dampfschifffahrts-Gesellschaft (DDSG)
Originalmaße: L 45 x b 6,70 x h 2,70 m, Tiefgang 0,87 m
Typ: Personenschiff, Transportschiff mit Dampfantrieb, Raddampfer
Dampfmaschine: 60 PS, Balancemaschine, Zwillingsmaschine
Modell Maßstab 1: 50, angefertigt von Karl Durst, 1956
Dieser Seitenraddampfer wurde 1831 in Alt-Ofen, wo die DDSG die
Schiffswerft Budapest errichtet hatte, von Engländern gebaut und befuhr
die obere Donau. Das Schiff besaß eine
Niederdruck-Kondensationsmaschine von 60 PS aus dem Hause Boulton Watt
& Co in Soho (London).
WUSSTEN SIE? Ursprünglich war die Maria Anna aus Holz angefertigt, 1845
wurde sie mit einem eisernen Schiffskörper ausgestattet. 1886 erhielt
sie eine oszillierende Zwillingsmaschine, die einfach gebaut war und
wenig bewegte Teile besaß. Die Herstellung war kostengünstig und
garantierte zudem eine längere Lebensdauer.

Modell des DDSG-Dampfers Suppan
Originalmaße L 65 x b 7,70 (über den Radkasten 15,90 m) x h 2,80 m
Typ: Remorker (Zugdampfer), Transportschiff mit Dampfantrieb, Raddampfer
Dampfmaschine: 800 PS, feste Diagonalmaschine, Compound Maschine
Dieser Dampfer wurde 1921 mit 800 PS von der Schiffswerft Budapest für
die DDSG gebaut. Die „Suppan" war ein Zweikaminer, der relativ schwer
zu manövrieren war. Nach 45 Jahren Dienstzeit wurde sie am 31. März
1966 außer Dienst gestellt und verschrottet.

Betriebsfähiges Modell des Donau-Rad-Zugschiffes Cyclop, Baujahr 1914
Originalmaße: L 66 x b 8,50 (über den Radkasten 16,50 m) x h 2,9 m Typ:
Remorker (Zugdampfer), Transportschiff mit Dampfbetrieb, Raddampfer
Dampfmaschine: 1000 PS, feste Diagonalmaschine, Triplexmaschine
Modell angefertigt 1945-1947, von Kapitän Herbert Regelsberg und
Kapitän Franz Fillner (nach Australien ausgewandert), Ankauf 1946 von
Kapitän Herbert Regelsberg, Wien II.
Dieses dampfbetriebene Kraftschiff wurde 1914 als eines der größten
Dampfer der DDSG in der Schiffswerft Budapest gebaut. In den 1930ern
wurde die Cyclop von Kohle- auf Ölfeuerung umgestellt. Das Schiff wurde
am 1.12.1963 außer Dienst gestellt. Es besaß 2 Schornsteine
(sogenannter „Zweikaminer").

Modell des Seitenraddampfers Linz
Originalmaße: L 34 x b 4,80, über den Radkasten: 9,80 m, Seitenhöhe 2,20 m
Das ehemalige Dienstschiff „Linz" der OÖ. Wasserbauverwaltung wurde
1903 auf der Linzer Schiffswerft gebaut und 1927 Eigentum der
Strombaudirektion Wien. 1950 wurde es außer Dienst gestellt und zu
einem Dieselfahrzeug umgebaut. Es besaß eine in der Anschaffung sehr
teure Verbundmaschine (oder Mehrfach-Expansionsmaschine, engl. compound
machine) von 140 PS, die weniger Brennstoff und Wasser verbrauchte.

Bis Mitte des 19. Jahrhunderts war die Schifffahrt mit ihren
Handelswegen ein bedeutender Wirtschaftszweig für Oberösterreich und
Motor technischer Entwicklungen. Auch war sie der Quell für den
legendären Reichtum der Stadt Grein und wohl der entscheidende Faktor
für den Bau von Schloss Greinburg. Denn das kaiserliche Privileg von
1488 beinhaltete auch ein ewiges Mautrecht am Donauufer.
Gemälde von Grein vor dem Brand 1642
In der Kartusche befindet sich folgender Text. „Anno 1642 // den 23.
May ist // die Statt Grein Sambt // dem Closter abgebra//nen Wie es in
// gegenwertiger//Taffel zusehen // ist".

Das Oberösterreichische Schifffahrtsmuseum ist über dem Donaustädtchen
Grein auf Schloss Greinburg beheimatet und in Oberösterreich das größte
Museum seiner Art.
Das Oberösterreichische Schifffahrtsmuseum wurde auf Initiative von
Herzogin Viktoria Adelheid von Sachsen- Coburg und Gotha im Juni 1970
in Anwesenheit von Landeshauptmann Dr. Heinrich Gleissner feierlich
eröffnet.
Das Museum wird von der Stiftung der Herzog von Sachsen-Coburg und
Gothaschen Familie getragen und fast ausschließlich aus Beständen des
Oberösterreichischen Landesmuseums ausgestattet. Das Museum beherbergt
eine beeindruckende Ausstellung an Exponaten, die die
verkehrstechnische Nutzung der Donau und ihrer Zuflüsse Salzach, Enns
und Traun als Binnenschifffahrtswege dokumentiert. Bis Mitte des 19.
Jahrhunderts waren die Schifffahrt und der Handel an diesen Wasserwegen
von großer Bedeutung für die Wirtschaft Oberösterreichs und eine Quelle
großen Wohlstandes für die Stadt Grein. Die drei Ausstellungssäle im
Schifffahrtsmuseum widmen sich der Darstellung der historischen
Schifffahrt auf den Flussläufen Oberösterreichs wie Donau, Traun und
Enns.
Im Donausaal beeindrucken besondere Modelle: Es gibt Modelle eines
Viechtwängerfloßes, eines Pesterfloßes und des Holzrechens von Au an
der Donau sowie unzählige andere, längst vergangene Zeugen der
Schifffahrt zu bestaunen. Natürlich dürfen auch Modelle von
Dampfschiffen nicht fehlen, so etwa jenes des ersten Donaudampfschiffes
"Maria Anna", das als erster Raddampfer seiner Art von der
Donaudampfschifffahrtsgesellschaft, der größten Gesellschaft der
europäischen Binnenschifffahrt der damaligen Zeit, 1837 in Betrieb
genommen wurde. Dass die Donau bereits lange vor 1837 als Handels- und
Transportweg benutzt wurde, verdeutlichen weitere in der Ausstellung
gezeigte Objekte. So werden neben "Ulmer Schachteln", Waidzillen und
Plätten verschiedene Floßarten, die oft nach ihrem Abfahrts- und/oder
Herstellungsort benannt wurden, präsentiert. Der Salzhandel und der
Kohletransport standen neben dem Transport von Holz an vorderster
Stelle. Dass sich hinter diesen Aufgabenbereichen zahlreiche Berufe
verbargen, wird beim Betrachten der Ausstellung ebenfalls deutlich:
Schiffsreiter, Flößer, Schiffsbauer u. a. werden thematisiert. In
Zünften organisiert, wurde der Zusammenhalt dieser Handwerksbereiche
garantiert. Auch der Schiffahrtspatron St. Nikolaus taucht als zentrale
Figur des Schiffahrtswesens in unterschiedlichen Kontexten im Museum
auf. Die museale Präsentation der Ausstellungsstücke birgt einen
besonderen Charakter und entführt die Besucher in längst vergangene
Zeiten.

Gasthausschild aus Struden, Schmiedeeisen, Kopie
Angefertigt von Schlosser Buchberger und dem akademischen Maler Staudenherz, Grein, 1970 (?)
Das Schild zeigt eine mit drei Schiffleuten bemannte Kobelzille (?) und die Inschriften „1789 /1956/1856".

Gasthausschild aus Freistadt, Original: aus der Zeit von um 1800, Schmiedeeisen, Kopie
Angefertigt von Herrn Buchberger, Grein, 1970 (?)
Das Gasthausschild zeigt ein stark stilisiertes Schiff (Kelheimer) mit
zwei Ruderern und drei Fahrgästen. Die Vorlage stammt vom Gasthaus „Zum
goldenen Schiff" in Freistadt, das vermutlich von Salzfuhrleuten
besucht und bis 1982 betrieben wurde.

Fischer am Traunsee, Sign. Knörlein, 1930er/40er
Keramikrelief aus der Künstlerischen Werkstätte Franz und Emilie Schleiß
Gmunden ist seit dem 17. Jh. Zentrum der altösterreichischen Fein- und
Zierkeramik. Vor allem der Traunsee beeinflusste die Keramikkünstler im
Dekor. Dieses Relief stammt von Rudolf Knörlein (1902-1988). Er wurde
in Gmunden und Wien ausgebildet, arbeitete in deutschen und
italienischen keramischen Industrien und wurde schließlich Leiter der
Keramik Werkstatt in Gmunden.
WUSSTEN SIE? 1843 gründeten Franz und Emilie Schleiß die Künstlerische
Werkstätte in Gmunden, in der auch Künstler der Wiener Werkstätte tätig
waren. 1923 wurde das Unternehmen in eine Aktiengesellschaft
umgewandelt und seit 1931 „Gmundner Keramik" genannt. Ab 1968 stellte
man Gebrauchsgeschirr anstelle figuraler Kunst her. Das grüngeflammte
Tafelgeschirr erlebte seine erste Hochblüte.

Wassertüchtiges Modell des k.k. privilegierten Raddampfers Maria Anna der DDSG
Nicht maßstabsgetreu, sondern verkürzt
Dauerleihgabe des Stiftes Schlägl, Oberösterreich an das OÖ. Landesmuseum
Am 13.09.1837 trat der nach der Ehefrau Kaiser Ferdinands I. (Ks. 1835
- 1848) benannte Dampfer Maria Anna seine erste Reise von Wien nach
Linz an. Er benötigte aufgrund widriger Witterung und Hochwasser 55
Stunden 22 Minuten (Rückreise: 9,5 Stunden). Das Ereignis wurde von der
Presse gefeiert, die Post gab sogar eine eigene Briefmarkenserie
heraus, die Schiffleute jedoch sahen ihren Berufsstand durch das
Aufkommen der Dampfschifffahrt gefährdet. Franz Josef I. widmete 1837
das mit einem Dampfkessel ausgestattete Modell dem Stift Schlägl, da
sein Abt die nachmalige Kaiserin Elisabeth mit diesem Schiff nach Linz
begleitete.

Gmundener Keramikschüssel, modern, Dm 34 cm
Die Majolika (weiß glasierte Keramik mit leuchtenden Farben bemalt) mit
der Ansicht von Urfahr, dem Pöstlingberg und der Pferdebahn zeigt den
ersten Seitenraddampfer Maria Anna der DDSG. Seit 1837 pendelte die
Maria Anna, die wegen ihrer luxuriösen Ausstattung gerühmt wurde,
zwischen Wien und Linz. Sie bot 250 Reisenden Platz und diente bis 1898.

Walzenförmiger Schifferkrug der Gmundener Fayence
Kopie nach Originalen im OÖ. Landesmuseum, angefertigt von der Fa. Schleiss in Gmunden, 1972
Dieser Krug stellt den Gegentrieb (Schiffzug) auf der Traun dar. Zwei
nebeneinander laufende Treidelpferde ziehen eine Zille in Bergrichtung
(flussaufwärts). Der Schiffsreiter sitzt auf einem der Pferde und hält
eine Peitsche in der Hand. In der abgebildeten Granselzille befinden
sich zwei Schiffsleute.
Walzenförmiger Schifferkrug der Gmundener Fayence
Kopie nach Originalen im OÖ. Landesmuseum, angefertigt von der Fa. Schleiss in Gmunden, 1972
Original: sign. TH.G. 1821, OÖ. Landesmuseum, Abt. Volkskunde
Der Krug zeigt einen Gebirgssee, auf welchem fünf Männer ein Schiff
rudern. Zwei Schiffsleute befinden sich im Stoir (Heck), drei weitere
im Gransel (Bug). Vermutlich sieht man einen Salztransport. Inschrift:
„Fünf Schifleut auf a Fuhr sand just recht a Stoira, a Fahra und dazu
drey Knecht. Wann mir san bey Bier und Wein, da wollen mir tapferne
Schifleut sein".
Birnenförmiger Schifferkrug der Gmundener Fayence
Kopie nach Originalen im OÖ. Landesmuseum, angefertigt von der Fa. Schleiss in Gmunden, 1972
Dieser Krug zeigt den Traunsee, der von einer Kobelzille von einem
Stoirer und zwei Schiffleuten befahren wird. Neben den Schiffsleuten
sitzt auch ein Mädchen mit rotem Kopftuch in der Zille. Die Inschrift
verweist auf die Gefahren der Schifffahrt hin: „Fahren wir auf der
Donau oder Traun, brauchen wir Gott vertraun".
Birnenförmiger Schifferkrug der Gmundener Fayence
Kopie nach Originalen im OÖ. Landesmuseum, angefertigt von der Fa. Schleiss in Gmunden, 1972
Dieser Krug zeigt einen von einer Zille befahrenen See. In der Zille
sitzen zwei Ruderer und drei weibliche Fahrgäste. Die Inschrift ist
anzüglich und derb: „O Wunder über Wunder, hat das Schiff so viele
Löcher und gehet doch nicht unter".

Modell Schwabenplätte
Plätten sind kastenförmige hölzerne Arbeitsschiffe ohne Kiel
(„Rückgrat"). Sie wurden traditionell im Alpen-Donauraum verwendet. Ihr
Kennzeichen ist das spitz zulaufende Gransel (Bug).

Kelheimer Tischzeichen, OӦ, 2. H. 19. Jh.
Spende von Dr. Schiller / Linz-Pöstlingberg, der es 1922 bei dem
Antiquitätenhändler Johann Hofinger in Lambach erworben hatte. Das
Tischzeichen wurde beim Antiquitätenhändler Johann Hofinger in Lambach
gekauft. Es zeigt vier Schiffleute zwei Ruderbäume und das Steuerruder
(Timon). Am Grans(e)l (Bug) befindet sich der Schriftzug „Jh.", am
Stoi(e)r (Heck) „1724". Das Schild weist beidseitig die Inschrift „Es
Leben // Hoch die Edlen // Schiffer" auf.
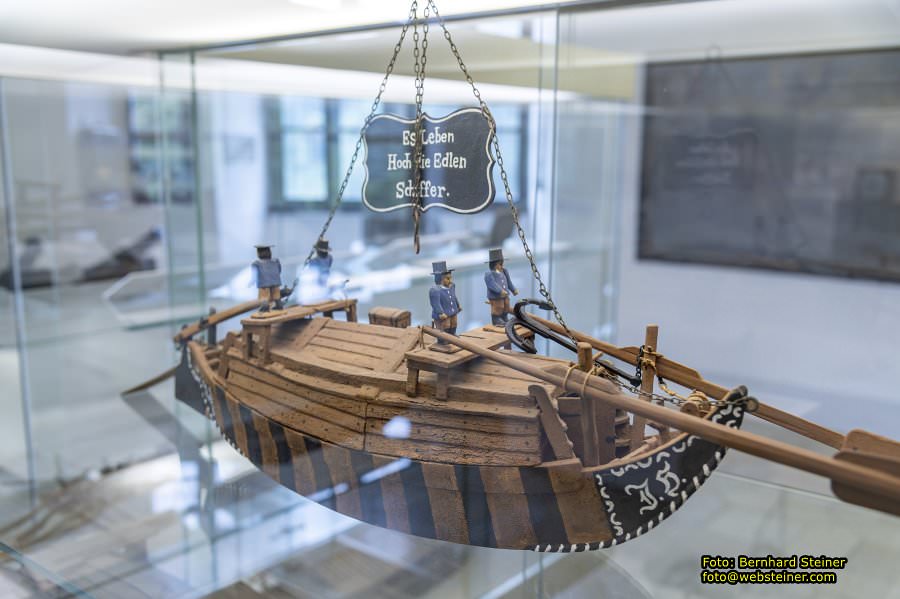
RAUM 2 - Fünf Themen charakterisieren diesen Raum: so wird über die
verschiedenen Floß- und Schiffarten berichtet, die dem Salz-, Holz- und
Kohletransport dienten. Hinter diesen Aufgaben verbergen sich
zahlreiche Berufe (Schiffsreiter, Flößer, Schiffsbauer u.a.). Einzelne
Standesvertreter werden mittels seltener Figurinen gezeigt, wobei diese
individuelle Gesichtszüge besitzen, die auf reale Persönlichkeiten
zurückgehen. Unwetter und Unachtsamkeit waren die Todfeinde dieser
Berufsgruppen, weshalb man mit Schifffahrtsprozessionen und kirchlichen
Aussegnungen die Unterstützung Gottes und des Schutzheiligen Nikolaus
erbat. Diese Volksfrömmigkeit wird durch verschiedene Bilder
verdeutlicht. Ansichten von Orten mit Schifffahrtstradition und Modelle
diverser Wasserbauten sind die beiden abschließenden Themen dieses
Raumes.

Figurinen der Schiffknechte von der Enns (mit Tabakspfeife), Inn (mit Bootshaken) und Traun (mit Beil, Seil und Decke)
Die Figurinen wurden nach einem Aquarell von Ludwig Haase aus dem Jahr
1902 im Atelier Krauhs, Wien angefertigt. Den Traditionen verbunden,
trugen viele Schiffer Federkielgürtel. Die Ledergürtel wurden mit
gespaltenen Pfauenfedern in kunstvoller Handarbeit bestickt. Besonders
in der 2. Н. 19. Jh. fanden diese Lederwaren im Salzkammergut, in
Salzburg, Tirol und in Süddeutschland weite Verbreitung. Umso feiner
der Kiel gespalten wurde, desto feiner und teurer wurde die
Stickarbeit. Fein gestickte Leibgurte konnten den Gegenwert eines
Pferdes erreichen und stellten daher Statussymbole dar.

RAUM 3 - Dass der Mensch sich die Natur Untertan gemacht hat, belegen
Meisterwerke der Technik in Modellen: die Gmundener Seeklause
symbolisiert die Kontrolle über den Wasserstand, der Traunfallkanal die
Umfahrung der gefährlichen Fälle, die Linzer Donaulände die künstliche
Aufschüttung eines Straßenzuges usf. Andere Modelle zeigen wie der
Mensch sein Wirtschaftsleben organisiert hat: so wird im Rettenbach
Rechen das Schwemmholz aufgefangen, in den Gmundener Salzstadeln das
Salz zwischengelagert oder mithilfe von Booten Fischfang betrieben.
Auch in der Volkskunde war der Salztransport Thema wie die Gmundener
Keramikkrüge zeigen. Die Traun galt als wichtiger Transportweg des
Salzes zur Donau. Modelle von Schiffstypen geben davon Zeugnis. Auf der
Weiterfahrt nach Wien und Pest überwanden sie die gefährlichste Stelle,
den Struden bei Grein, der in mehreren Ansichten gezeigt wird.

Gmundener Schifferkrug mit Kobelzille, Majolika, Kopie, Fa. Schleiß, Gmunden 1970
Gmundener Schifferkrug mit Doppeladler und Salzschiff, Majolika, Kopie, Fa. Schleiß, Gmunden 1970
Gmundener Schifferkrug mit Kobelzille, Majolika, Kopie, Fa. Schleiß, Gmunden 1970
Schiffertruhe des Paul Stadlmann aus Bad Goisern, Bad Goisern 1816
durch Tausch für die Abt. Volkskunde / OÖ. Landesmuseen erworben, übergeben von Familie Pilz aus Steeg / Hallstättersee

Wappen von Grein
Urkundlich wird die Pfarre Grein das erste Mal 1147, die Burg 1215 als
„burgensisi in Grine" erwähnt. 1469 erhielt Grein ein eigenes Wappen.
Am 27. August 1491 erhob Kaiser Friedrich III. Grein zur Stadt, was
eine wirtschaftliche Blüte zur Folge hatte.
WUSSTEN SIE? Laut Wappenbrief vom 2. Jänner 1468 wird das Wappen wie
folgt beschrieben: „...ainen Schilde, der ist ganntz überflossen mit
wasser, in dem grunde des schilldes mit ettlichen swarzen schrofen, und
dann in der mitte des Schilldes ain hohenawerinn in irer gewöndlichen
farbe und form, mit ainem gelben dach, und in yedem ortt des schiffs
ain mndel, ziehend an einem ruder und in der mitte des schiffs ain
mendel auf dem verdegk steend, hinder sich und für sich zaigende, wie
man sulle faren, darnach in der höhe desselben schilldes aber mitt
swartzen schroven zu gleicher weys, als ob das scheff zwischen den
schrofen hindurchgeen were..."

Modell der Seeklause bei Gmunden, Angefertigt von R. Schober und Hans Pertlwieser, Linz 1969/70
Die Seeklause diente zur Regulierung der Wassermenge. Diese alte
Hochwasser-Wehranlage schützte Gmunden vor Überschwemmungen (sie
bewältigte 120 m³ Wasser pro Sekunde). Die Klause diente aber auch zur
Regulierung der Wasserhöhe, da die Schifffahrt eine Mindestanforderung
besaß, die durch den Bau des „fahrbaren Traunfalls" nicht immer
gewährleistet werden konnte.

Modell der Donau bei Linz, Zustand ca. 1837, Nicht maßstabsgetreu, Angefertigt von Hans Pertlwieser, Linz 1969/70
Die Biegung der Donau war namengebend für die Stadt (keltisch lentos =
Kurve, Biegung). Die vorgelagerte Insel hieß Strasserinsel (Bereich
Parkbad). Der Seitenarm der Donau wurde 1889/91 aufgeschüttet und dient
als einer der Hauptstraßenzüge der Stadt. Die Donaulände war ehemals
Landeplatz für Schiffe. Der heutige Hafen wurde stromabwärts verlagert
(Winter-, Stadt-, Handels und Voesthafen). Er ist der größte Hafen in
Österreich.

Kopie eines Gmundener Birnkruges mit Doppeladler und Schoppern bei der Arbeit, Majolika, Fa. Schleiß, Gmunden 1970
Sechs Schopper arbeiten gemeinsam am Abdichten einer Zille, die mit
Seilzügen am Ufer gesichert ist. Unter Schoppen versteht man das
Abdichten der Fugen zwischen den Holzpfosten mit Moos, Zain (Holzspäne)
und Klampfeln (eine Art Eisenbügel). Es galt als der schwierigste
Arbeitsgang beim Schiffsbau.
Kopie eines Gmundener Schifferkruges mit bemannter Kobelzille, Majolika, Fa. Schleiß, Gmunden 1970
Nach einem Original aus der Sammlung Dr. Langer, Weißenbach / A.
Gmundener Birnkrug mit Zinndeckel und Zinnrand, Majolika, 18. Jh.
Auf der Leibung des Kruges erkennt man eine schlecht gezeichnete Zille,
die von einem Ruderer und einem Herz besetzt ist. Im See befindet sich
ein großer Anker. Das Spruchband lautet: „Mit der Zeit und mit den
Jahre, solst du meine / Treu erfahre"

Eine spätmittelalterliche Spindeltreppe führt vom Arkadenhof in den
ersten Stock. Hier beginnt bereits die Dauerausstellung des
Oberösterreichischen Schifffahrtsmuseums. Entlang der Stiege
präsentieren Ortswappen aus Bayern, Salzburg, Oberösterreich,
Niederösterreich und Wien Gegenstände mit schifffahrtskundlichem Inhalt.
Wappen von Urfahr (Linz), Oberösterreich, Reproduktion
1497 wurde nach Genehmigung Kaiser Maximilians I. eine Donaubrücke
zwischen Linz und Urfahr errichtet. Urfahr erhielt 1808 das Marktrecht
und wurde 1882 zur Stadt erhoben. 1919 wurde die nördlich gelegene
Stadt Urfahr von Linz eingemeindet.
WUSSTEN SIE? Der Name „Urfahr" bezeichnet eine Art Monopol des
Fährverkehrs. Sowohl Adelsgeschlechter, als auch Klöster, konnten voll
oder teilweise in ihrem Besitz sein. Die Ortsbezeichnung „Urfahr"
benennt daher eine alte Überfuhrstelle im Fährverkehr, das dem
Eigentümer alle damit verbundenen Einnahmen garantierte. Die Urfahr,
die Querschifffahrt, dürfte bereits lange vor der Längsschifffahrt
existiert haben.

Die Sala Terrena entlehnt ihren
Namen „Steinernes Theater“ von ihrer ungewöhnlichen Innendekoration.
Ein Mosaik aus Donaukieseln zeichnet über die gesamte Wand- und
Deckenfläche eine Scheinarchitektur. Sie spiegelt die Fortsetzung des
Arkadenhofs und die Vorstellung eines Gartenpavillons mit Ausblick ins
Freie vor. Die Raumausstattung wurde von Graf Meggau (gest. 1644)
veranlasst. Sein Wappen ist an der Decke abgebildet. Die Sala Terrena
ist für Österreich ein seltenes Beispiel der kuriosen Gattung
künstlicher Grotten. Diese waren an den Höfen Italiens seit dem 16.
Jahrhundert in Mode und Ausdruck eines luxuriösen und höchst
raffinierten Lebensstils.




Ein besonderer Höhepunkt bei der Besichtigung von Schloss Greinburg ist
die “Sala Terrena” auch “Steinernes Theater” genannt, das 1625 unter
der Leitung des Grafen von Meggau gebaut wurde (sein Wappen ist Teil
des Deckenschmucks). Der Raum erhielt seinen Namen aufgrund des Mosaiks
aus Donaukieseln, die die gesamte Fläche der Wände und des
Deckengewölbes überziehen. Dieser Saal mit der angeschlossenen
Rustikagrotte ist einzigartig in Österreich als eines der frühesten
Beispiele derartiger Raumausstattung nördlich der Alpen. Diese
bemerkenswerte Art der Ausstattung war in italienischen Hofkreisen seit
dem 16. Jahrhundert Mode und spiegelte einen luxuriösen und überaus
raffinierten Lebensstil wider.


Stadtpfarrkirche Grein - Als
spätgotischer Bau errichtet, dem heiligen Ägidius geweiht. Altarbild
von Bartolomeo Altomonte geschaffen stellt den heiligen Ägidius mit der
Hirschkuh dar und wird voneinem schwungvollen Barockaufbau umrahmt.
Prachtvolle Kanzel mit den vier Kirchenvätern, die 1679 von der
Schlossherrin Anna von Dietrichstein gestiftet wurde. Interessante
Grabsteine und Grabmale.

Die Stadtpfarrkirche ist ein spätgotischer Bau und dem Hl. Ägidius
geweiht. Das Altarbild von Bartolomeo Altomonte aus dem Jahr 1749
stellt den Kirchenpatron mit der Hirschkuh dar und wird von einem
schwungvollen Barockaufbau umrahmt. Deutlich älter als der Hochaltar
sind die beiden Seitenaltäre. Die prachtvolle Kanzel zeigt die vier
Kirchenväter (Augustinus, Ambrosius, Gregor und Hieronymus) und die
vier Evangelisten und wurde von der ehemaligen Schlossherrin Anna von
Dietrichstein gestiftet. Die Glasfenster im Langhaus sind jüngeren
Datums und zeigen unter anderem den Hl. Nikolaus, Schutzpatron der
Schiffsleute. Der mächtige Kirchturm ist 55 m hoch. Besonders dekorativ
bemalt ist die Südwand des Turms mit Wappen und Uhr.

1476 diente die Kirche den Einheiten des späteren Landeshauptmanns
Bernhard von Scherffenberg als Wehrkirche zur Abwehr der Truppen des
Matthias Corvinus, wobei das Gebäude schwer beschädigt wurde. Im
vierten Viertel des 15. Jahrhunderts wurde das Langhaus im
spätgotischen Stil wieder aufgebaut und vergrößert. Damit entstand die
Anbindung des älteren, wohl aus dem 14. Jahrhundert stammenden
Westturmes an das Kirchenschiff.

Die Ausstattung der Kirche ist eine bemerkenswerte barocke Einrichtung
aus dem 17. und 18. Jahrhundert. Der Hochaltar aus dem Jahr 1749 zeigt
ein Gemälde von Bartolomeo Altomonte. Die Kanzel mit den vier
Kirchenvätern wurde 1679 von der Schlossherrin der Greinburg gestiftet.



Die Pfarrkirche ist eine spätgotische, jedoch stark erneuerte
Hallenkirche. Die dreischiffige vierjochige Langhaushalle ist mit
Kreuzrippen gewölbt.


Der Westturm besitzt einen spitzbogigen kreuzrippengewölbten Durchgang.
Nach dem Stadtbrand von 1642 wurde er im Aufbau umgestaltet. Der im
Durchgang befindliche große Rittergrabstein des Schlossbesitzers,
dessen gleichnamiger Neffe Hans Jakob Löbl oberösterreichischer
Landeshauptmann wurde, ist mit einer Zusatztafel versehen: Anno 1560 am 21 tag May starb der Edel Ervest Herr Hans Jacob Löbl zue Greinburg Hie begraben dem Got genadt
Grabstein von Hans Jakob Löbl


Zwischen der Mündung des Greinerbaches und der Donaubrücke erstreckt sich entlang der Donaubucht ein neu errichteter Planetenweg.
Idee und Ausführung stammen vom am CERN beschäftigten Greiner Physiker
Dr. Werner Riegler. Das Sonnensystem ist im Maßstab 1:2,8 Milliarden
ausgeführt. Somit hat die Sonne einen Durchmesser von einem halben
Meter und alle Planeten und Monde sind im entsprechenden
Größenverhältnis dargestellt. Nach Sonne, Merkur, Venus, Erde, Mars und
dem Asteroidengürtel passieren Sie Jupiter. Saturn entdecken Sie am
Esperantoplatz/Ecke Campingplatz. Am Hafen vorbei und weiter am Radweg
erreichen Sie Uranus und nach 1,7 km kurz vor der Donaubrücke Neptun.
Genießen Sie nun den Blick zurück zur Sonne und staunen Sie über die
Weite und Distanzen unseres Sonnensystems.
Ein einzigartiger Zeitmesser ziert seit 1993 das Donauufer im Bereich
des Esperantoplatzes, entworfen und gebaut vom damaligen Physik- u.
Astronomiestudenten Werner Riegler aus Grein. Es handelt sich bei
dieser Sonnenuhr um eine
Äquatorialsonnenuhr, bei der der Schatten eines erdachsenparallel
gespannten Drahtseiles auf eine Skala fällt. Von einem
halbzylinderförmigen Ziffernblatt ist es dann möglich, die Zeit mit
einer Genauigkeit von rund zwei Minuten abzulesen. Das Gerüst dieser
Uhr besteht aus Chrom-Nickel-Stahl, das Ziffernblatt und die Skalen aus
Messing. Zusätzlich zu der Zeitangabe ist im vorderen Teil noch eine
Granitkugel angebracht. Dieser Globus mit den eingravierten Kontinenten
wird von der Sonne in gleicher Weise beschienen wie die Erde selbst.
Man kann daher an den Schattengrenzen ersehen, in welchen Ländern die
Sonne gerade scheint. Das Faszinierende an einer solchen Uhr ist, daß
man die Funktionsweise leicht versteht und somit auch Zusammenhänge
zwischen Erd- und Sonnenbewegung einfach kennen lernt.

Im antiken Rom wurde schon bald eine Rechtsordnung definiert, die für
die Zivilbevölkerung verbindlich war. Eine Rechtswissenschaft wurde
entwickelt, bei der es sich um eine originäre Schöpfung der Römer
handelt. Ziel war die Schaffung einer Rechtssicherheit, wobei die
Gleichheit eines jeden römischen Bürgers (nicht aber von Frauen,
Fremden, Sklaven etc.) vor dem Gesetz ein wesentlicher Bestandteil war.
Das römische Recht galt bis in das 19. Jahrhundert in den meisten
europäischen Staaten Europas als maßgebliche Quelle. Auch das moderne
bürgerliche Recht ist nach wie vor davon geprägt. Das österreichische
Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch (ABGB) ist zwar stärker vom
Vernunftrecht des 18. Jahrhunderts beeinflusst, römische Wurzeln sind
jedoch noch deutlich erkennbar.
Berühmte Römer: Tiberius Claudius Caesar Augustus Germanicus, Historiker, fähiger Verwalter
(* 1. August 10 v. Chr., Kaiser ab 41 n. Chr., + 13. Oktober 54 n. Chr.)
Claudius galt auf Grund körperlicher Gebrechen als ungeeignet für das
Kaiseramt. Dadurch überlebte er die politischen Säuberungsaktionen
durch Tiberius und Caligula und konnte sich historischen Studien
zuwenden. Sein Interesse galt unter anderem der römischen
Rechtsprechung. Nach der Ermordung seines Neffen Caligula wurde er im
Alter von über 50 Jahren dessen Nachfolger. Unter seiner Herrschaft
wurde Britannien erobert, Noricum und Pannonien erhielten den
Provinzstatus. Um die Versorgung Roms sicherzustellen, ließ er in Ostia
einen großen, künstlichen Seehafen für die Getreideschiffe aus Ägypten
anlegen. Von Ostia wurden dann die Nahrungsmittel tiberaufwärts nach
Rom transportiert.

In Favianis, der heutigen Stadt Mautern, war in der zweiten Hälfte des
5. Jahrhunderts eine Hungersnot ausgebrochen. Durch Lebensmittel aus
der Provinz Raetien, über Inn und Donau herangebracht, wurde diese
gemildert. Flüsse stellten in der Antike wichtige Verkehrsverbindungen
dar, da über sie verschiedenste Güter auf Schiffen oder Flößen schnell
und preiswert transportiert werden konnten. Dies galt vor allem
natürlich flussabwärts. Gegen den Strom musste getreidelt, die Boote
durch Mensch oder Tier vom Ufer aus gezogen werden. Die Donau war die
wichtigste Ost-West-Verbindung der römischen Provinz Noricum und
verband diese mit den Nachbarprovinzen Raetia und Pannonia. Da die
Donau zugleich die Grenze zum nördlichen „Barbaricum" war, wurde sie
durch einen militärischen Flottenverband, die classis Pannonica, später
classis Histricae, kontrolliert. Eine entsprechende Infrastruktur mit
Häfen, Werften etc. war erforderlich. Felsen und Untiefen stellten
ernstzunehmende Bedrohungen dar. So war der Strudengau aufgrund
„Strudel und Wirbel" erzeugender Felsenriffe einer der gefährlichsten
Donauabschnitte. Es ist davon auszugehen, dass derartige Stellen
zumindest bei Niedrigwasser umgangen wurden. Bei der Regulierung von
dieser Passage Mitte des 19. Jahrhunderts kamen sowohl urgeschichtliche
als auch römische Funde zu Tage, die vielleicht auf Unfälle und/oder
Opfergaben für eine glückliche Durchquerung hinweisen.
Bei der Zillen-Überfuhr zwischen Schwalleck am oberösterreichischen und
Wiesen am niederösterreichischen Ufer war das Schild mit den gekreuzten
Rudern das offizielle Zeichen für das Vorliegen der behördlichen
Zulassung.
Am gegenüberliegenden Ufer in Wiesen befand sich ein gleichartiges
Schild, das alle 4 Wochen (am Sonntag um 0:00 Uhr) alternierend bei
verschiedenen Nachbarhäusern ausgehängt wurde, weil in Wiesen die
Überfuhr-Zulassung auf vier Familien aufgeteilt war. Das Schild musste
erkennbar machen, wer der jeweils diensthabende Überführer war. Sollte
man den zuständigen Überführer nicht angetroffen haben, so war es noch
bis etwa 1955 üblich, durch lautes Zurufen über die Donau („Überfuhr")
auf sich aufmerksam zu machen und sich abholen zu lassen.

Entstehung der Donau: Die
Heraushebung der sogenannten Böhmischen Masse begann vor rund 18
Millionen Jahren. Vor 3 Millionen Jahren fand die Donau ihr jetziges
Bett. Während des Eiszeitalters hob sich die Böhmische Masse wiederum
und gleichzeitig konnte sich die Donau stark eintiefen. Die Donau in
Oberösterreich ist das Herzstück der Lebensader Europas.
Die Region bietet neben dem Donauradweg den Donausteig für Wanderer,
auf dem der außergewöhnliche Naturraum erlebt werden kann. Hier findet
man Entschleunigung und erholt und inspiriert von dem sagenhaften
Kulturleben, das tief in der bewegten Geschichte des Flusses verwurzelt
ist, fahren Gäste um viele unvergessliche Eindrücke reicher nach Hause.
Wussten Sie, dass...
... die Donau 2888 Kilometer lang ist und durch 10 Staaten fließt?
... die Kilometer der Donau und ihres gesamten Flusssystems
flussaufwärts gezählt werden, was sonst unüblich ist? Offizieller
Nullpunkt der Kilometrierung ist der alte Leuchtturm von Sulina am
Schwarzen Meer.
... Sie hier bei Kilometer 2079 der Donau stehen?

Wem der viele Text zu lange war und lieber Bewegtbilder mit Musik mag,
kann sich gerne dieses Video antun: