web steiner
Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen
Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.
+43/2624/54014 - office@websteiner.com
Lipizzanergestüt Piber
Piber bei Köflach, September 2023
In der sanften Hügellandschaft der Weststeiermark liegt der malerische Ort Piber, seit 1920 Geburtsort der berühmten Lipizzanerhengste der Spanischen Hofreitschule. In Piber versteht man schnell, warum die Lipizzaner Lieblinge der Habsburger waren: Sie sind überaus intelligent, lebhaft und menschenbezogen. Als nationales immaterielles Kulturerbe der UNESCO sichert das Lipizzanergestüt Piber zudem das jahrhundertealte Wissen rund um Zucht und Aufzucht der Lipizzaner. Jährlich kommen ca. 40 Fohlen zur Welt und verbringen ihre Kindheits- und Jugendtage im Lipizzanergestüt, auf seinen Außenhöfen sowie auf den umliegenden Almen zur Sommerfrische.

Besucher:innen erstreckt sich mit Stallungen, Koppeln, dem idyllischen
Schloss, dem Museum mit interaktiven Stationen zu Zucht und Aufzucht
der Lipizzaner in Piber, der Wagenremise mit den historischen Kutschen,
dem Café-Restaurant und der Veranstaltungs-Arena ein herrliches
Ausflugsziel. Erleben Sie die weltberühmten Lipizzaner hautnah bei
geführten Gestütsbesichtigungen, Kutschenfahrten, Almführungen oder bei
einer der Veranstaltungen in der großen Arena mit Vorführungen der
Reit- und Fahrabteilung des Lipizzanergestüts Piber.

Das Barockschloss Piber wurde
im Zeitraum von 1696 - 1728 von den Benediktinern als Abtei (Gutshof
des Stiftes St. Lambrecht) erbaut. Es hat einen quadratischen
Grundriss. Der dreigeschossige Arkadenhof folgt dem Stil des Domanico
Sciassia. 1798 wurde es unter militärische Verwaltung gestellt. Über
dem Hauptportal des Schlosses befindet sich eine lateinische Inschrift,
welche übersetzt bedeutet: Dieses Gebäude erbaute FRANCISCUS, ANTONIUS
ließ es vergrößern und vervollkommnen - KILIAN schmückte das Gebäude
aus. Die Vornamen bezeichnen die Namen der damaligen St. Lambrechter
Äbte, die in Piber Pfarrherren waren. Das Schloss beherbergt die
Verwaltung des Gestüts, Veranstaltungs-und Seminarräume und Wohnungen.

Das Schloss befindet sich in der Ortschaft Piber, etwa 2 Kilometer
nordöstlich der Stadtgemeinde Köflach, neben der Pfarrkirche Piber. Es
befindet sich dort auf einem niedrigen Hügel mit relativ steilen
Hängen, die teilweise künstlich abgeböscht wurden.
Die Ursprünge des Schlosses gehen bis auf das frühe 11. Jahrhundert
zurück. Seit 1952 befindet sich im Schloss die Verwaltung des
Bundesgestüts Piber. Außerdem dient das Schloss heute als kultureller
Ausstellungsraum sowie als Veranstaltungsort für Konzerte.

Beim Schloss handelt es sich um einen dreigeschoßigen barocken Bau mit
vier regelmäßigen Gebäudeflügeln sowie einem annähernd quadratischen
Grundriss. Die vier Flügel umgeben einen großen Arkadenhof mit über
alle Geschoße reichenden Pfeilerarkaden und weisen dreiachsige
Eckrisalite auf. Die Fassade wird durch gemalte Pilaster gegliedert,
welche über alle Geschoße reichen. Die Fenster haben gemalte
Umrandungen. Die einzelnen Geschoße werden durch Zierfelder unterhalb
der Fenster voneinander getrennt. Das Gebäude kann durch ein auf das
Jahr 1726 datiertes Haupttor im Westen oder durch ein auf das Jahr 1728
datiertes Seitenportal betreten werden. Ein über dem Haupttor
angebrachtes Chronogramm verweist auf die Fertigstellung des Neubaus im
Jahr 1728 sowie auf die Lambrechter Äbte Franz von Kaltenhausen und
Anton Stroz als Bauherren.

Das Exterieur - oder das
äußerliche Erscheinungsbild des Lipizzaners
Der Typ des Lipizzaners wirkt elegant, mittelgroß und kompakt.
Charakteristisch für den Lipizzaner ist der ausdrucksvolle und lang
gestreckte Kopf mit dem mehr oder minder stark geramsten Profil, den
großen, lebhaften und klugen Augen und kurzen, gut angesetzten Ohren.
Der markante Ramskopf ist auf den altspanischen Einfluss zurückzuführen.
Die Ganaschen sind stark ausgeprägt, der Hals ist ziemlich hoch
aufgesetzt, stark, nicht sehr lang und nicht selten mit deutlichem
Unterhals.
Wie der Hals sind auch die Beine kurz und kräftig gebaut.
Der Körper ist gedrungen, die Brust breit, die Schulter oft ein wenig
steil, mit wenig ausgeprägtem Widerrist.
Die kleinen, schmalen Hufe sind von harter Hornbeschaffenheit.
Die Bewegungen wirken graziös und sind durch einen federnden Gang
ausgezeichnet.
Bei Gestütspferden ist die Schimmelfarbe dominierend, sie ist mit etwa
10 Jahren ausgefärbt, oft mit Krötenmaul und gelegentlich nackten
Ringen um die Augen.
Die Widerristhöhe variiert im Idealfall um 153 bis 158 cm Stockmaß.

SICHERES AUFSCHIRREN
Geschirr und Leine beim linken und rechten Pferd passend vorbereiten
und dem Pferd ein Halfter anlegen.
Brustblatt oder Kumt über den Kopf heben und den Kammdeckel von der
mähnenfreien Seite auf den Rücken drehen. Den Kammdeckel mit
Schweifriemen nach hinten ziehen und Schweifriemen vorsichtig über die
Schweifrübe ziehen. Den Kammdeckel in die richtige Lage heben, großen
und kleinen Bauchgurt schließen (nicht zu fest). Erst Innenstrang, dann
Außenstrang unter den Schweifriemen über den Rücken legen. Halfter
abnehmen, Fahrzaum anlegen, Kehl- und Nasenriemen schließen, Kinnkette
ausgedreht einhängen. Leinen beim rechten Pferd rechts und beim linken
Pferd links stehend von hinten nach vorne einziehen. Außenleine durch
Schlüsselring und Leinenauge führen und im Gebiss einschnallen,
Innenleine nur durch Schlüsselring führen und im Kehlriemen von hinten
nach vorne einhängen. Das Handstück der Leine mit einer Schlaufe von
hinten nach vorne durch den Schlüsselring am Kammdeckel schieben und
mit einer Sicherheitsschlaufe befestigen. Pferde am Backenstück führen
und in die betriebsbereite Kutsche einspannen.

Die Pfarrkirche Piber ist eine
der urkundlich am frühesten nachweisbaren Pfarrkirchen der Steiermark
(seit 1060 Pfarrrecht, erbaut als typische „romanische Landkirche" Ende
12./Anfang 13. Jh.). Piber war „Mutterpfarre" der gesamten
weststeirischen Umgebung und bis 1760 Verwaltungsmittelpunkt des
Klosters St. Lambrecht, d.h. Jahrhunderte lang geistiges und
kulturelles Zentrum. Diese römisch-katholische Kirche ist dem Hl.
Apostel Andreas geweiht. Besonderheiten bilden der mächtige romanische
Wehrturm mit barocker Zwiebelhaube sowie die romanische Apsis mit einem
typischen Zahnschnittfries. Zahlreiche Römersteine, sowohl außen wie
auch im Inneren des bedeutenden Sakralbaues sichtbar, zeugen von früher
Besiedlung.

Die Kirche ist eine typische romanische Landkirche und wird von einer
ursprünglich wehrhaften Kirchhofmauer umgeben. Der mächtige, romanische
Kirchturm befindet sich über dem Chorquadrat, und hat einen barocken
Zwiebelhelm mit Laterne. Er hat gekuppelte, rundbogige Schallfenster
und drei Glocken, von denen eine im Jahr 1528 gegossen wurde. Die
Außenseite der niedrigen, halbkreisförmigen Apsis ist mit einem Bogen-
und einem Zahnschnittfries versehen. An der Apsis ist ein Grabstein mit
der Darstellung eines in Rüstung knienden Herren von Kainach aus dem
Ende des 16. Jahrhunderts eingemauert. An der Außenseite der gotischen
Sakristei befinden sich Strebepfeiler. Bei der Kreuzkapelle befindet
sich ein überlebensgroßes Kruzifix aus dem zweiten Viertel des 18.
Jahrhunderts.

Der Hochaltar füllt die gesamte Apsis aus. Er wurde in der Zeit um 1710
bis 1720 aufgestellt. Das in das Jahr 1627 datierte und mit I. S.
fecit. signierte Altarblatt zeigt den heiligen Andreas sowie das Wappen
des Lambrechter Abtes Johann Heinrich Stattfeld. Der rechte
Seitenaltar, ein Anna-Altar mit Statuen von Balthasar Prandstätter
wurde um 1752 aufgestellt. Der linke Seitenaltar stammt ungefähr aus
derselben Zeit wie der Anna-Altar. Der Kreuzaltar wurde zu Beginn des
18. Jahrhunderts und das Tabernakel um 1730 errichtet. Die mit Reliefs
versehene Kanzel wurde um 1752 von Johann Piringer gefertigt. Der
Taufstein stammt aus dem 17. Jahrhundert. Die Orgel wurde 2002 von dem
Orgelbauer Walter Vonbank aufgestellt. Sie besitzt 20 Register auf zwei
Manualen und Pedal.

Das romanische, fünfjochige Kirchenschiff wird von einem
Netzrippengewölbe überspannt, welches auf abgefasten, barockisierten
Wandpfeilern ruht. An das Langhaus schließt das Chorquadrat mit
niedrigen Rundbögen aus Quadersteinen mit Kämpferprofilen. An der
nördlichen Mauer des Chorquadrates befinden sich die Reste eines
verstäbten, spätgotischen Portals mit gedrehten Basen. An das
Chorquadrat schließt die niedrige Halbkreisapsis, welche fast gleich
breit wie der Kirchturm ist. Unter der Apsis befindet sich eine kleine,
achteckige Krypta. Nördlich an das Chorquadrat ist eine einjochige,
gotische, ehemalige Kapelle angebaut, welche heute als Sakristei
genutzt wird. Diese hat einen Fünfachtelschluss und wird von einem auf
Halbkreisdiensten sitzenden Kreuzrippengewölbe überwölbt. Eine
zweijochigeTaufkapelle mit einem Kreuzgratgewölbe schließt nördlich an
das Langhaus an. An der südlichen Langhausmauer befindet sich der Anbau
einer rechteckigen Kreuzkapelle mit Kreuzrippengewölbe und
Eierstab-Stuckleisten aus dem 17. Jahrhundert. Im westlichen Teil des
Langhauses befindet sich die dreiachsige, von einem Kreuzgratgewölbe
unterwölbte Empore. Der Zugang zur Kirche erfolgt im Westen durch ein
einmal gestuftes, romanisches Rundbogenportal mit zwei
Knospenkapitellen. Alle Fenster im Kirchenschiff sind barockisiert, mit
der Ausnahme eines romanischen Fensters an der Südseite. Die
Rundbogenfenster in der Apsis weisen leichte, heute teilweise
vermauerte Ansätze zum Spitzbogen auf.


Am Fronbogen stehen zwei aus dem zweiten Viertel des 18. Jahrhunderts
stammende Statuen der Heiligen Bernhard und Benedikt. In den
Fensterlaibungen der Sakristei zur Chorschräge findet man Fresken aus
dem Anfang des 15. Jahrhunderts. In der Kirche befinden sich einige
Bilder, so etwa eine Darstellung der Anbetung der Könige aus dem ersten
Drittel des 17. Jahrhunderts, ein Bildnis der heiligen Anna mit Maria
und Joachim aus der Mitte des 17. Jahrhunderts so wie zwei ebenfalls
aus dem 17. Jahrhundert stammende Apostelbilder und ein gleichzeitiges
Bild des heiligen Joseph. Die ovalen Passionsbilder stammen aus dem
dritten Viertel des 18. Jahrhunderts, die Kreuzwegbilder aus der Zeit
um 1800. Ein gläserner Hängeleuchter wurde in der Mitte des 19.
Jahrhunderts gefertigt. In der Sakristei stehen ein Paramentenschrank
aus dem Jahr 1631 sowie ein in das Jahr 1725 datierter, eingelegter
Sakristeischrank mit geschnitzter Bekrönung. Über das gesamte
Kirchengebäude verteilt findet man einige figürliche Römersteine.

Die Kirche wird erstmals 1066 als Pfarre erwähnt. 1103 wurde sie dem
Stift St. Lambrecht geschenkt, in dessen Besitz sie sich mit
Unterbrechungen bis in das Jahr 1786 befand. Die heutige Kirche wurde
zu Beginn des 13. Jahrhunderts errichtet und in der Zeit der Spätgotik
sowie um 1629 bis 1631 umgebaut. Um 1400 wurde eine Kapelle angebaut.
Im ersten Viertel des 16. Jahrhunderts wurde die romanische Flachdecke
des Kirchenschiffes durch ein spätgotisches Netzrippengewölbe ersetzt.
1955 fand eine Außen-, 1960 eine Innenrestaurierung statt.[2] Im Jahr
2002 wurde die alte Orgel durch eine neue Orgel von Walter Vonbank mit
12 Registern ersetzt.


Die römisch-katholische Pfarrkirche St. Andreas der Pfarre Piber steht
in dem zur Stadtgemeinde Köflach gehörenden Ort Piber in der
Steiermark. Sie ist eine typische, romanische, teilweise gotisierte
Landkirche. Ihre Geschichte geht bis in die Mitte des 11. Jahrhunderts
zurück. Sie ist die Mutterpfarre der nördlichen Weststeiermark.

MUSEUM/SCHÜTTKASTEN - VERTEIDIGUNGSANLAGE & GETREIDELAGER
Dieser altertümliche Zweckbau - der sogenannte Schüttkasten - ist eine
Befestigungsanlage, die in der Zeit der Türkenbelagerung um 1490 erbaut
wurde. Er diente zur Verteidigung und als Getreidelager. In früheren
Zeiten galt ein Schüttkasten, oder auch Schüttboden genannt, als
Schatzkammer der Region, in der Weizen, Hafer, und Roggen gelagert
wurden. Heute steht der im Jahre 2002 renovierte Schüttkasten unter
Denkmalschutz und beherbergt das Gestütsmuseum.

Die Führung des Pferdes
Der Zaum oder das Zaumzeug dient zur Führung der Pferde und besteht aus
Riemen für den Kopf und aus den Zügeln. Die Kopfteile können mit einem
Mundstück verbunden sein, werden an den Riemen befestigt und durch das
Maul geführt. Diese Teile nennt man Trensen und Kandare. Bereits im 4.
Jahrtausend v. Chr. wurde Zaumzeug fürs Reiten in den weiten Steppen
nördlich des Schwarzen Meeres verwendet. Die bisher ältesten Teile von
Zaumzeug in Mitteleuropa sind Trensen aus Hirschgeweih, Knochen oder
Bronze und stammen aus der Bronzezeit um 2000 v. Chr. Ob die Pferde als
Reittiere oder als Zugtiere dienten ist nicht klar.

Die Winterreitschule in Wien
Am 20. September 1565 wurden 100 Gulden verwendet zum Bau des
„Thumblplatz im Garten an der Purgkhalhie": eine offene Reit- und
Turnierbahn am heutigen Josefsplatz, die leider keinen Schutz vor
schlechter Witterung bot. Der Grundstein für die Stallburg in Wien war
gelegt. Die Burg wurde als Residenz für Ferdinand I. nach spanischen
Plänen gebaut, aber nie benutzt. Bis 1569 wurde sie daher zu Stallungen
umgebaut; bis heute das Heim der Leibpferde der Habsburger. Der
Baumeister Johann Bernhard Fischer von Erlach entwarf die
lichtdurchflutete Winterreitschule in Wien. Kaiser Karl VI., Vater
Maria Theresias, ließ von 1729-1735 den weltweit schönsten Reitsaal
bauen.
Bei Betreten der Reitbahn in der Winterreitschule ziehen die Bereiter
ihren Hut, den Zweispitz, nicht vor dem Publikum, sondern vor dem
Bildnis Kaiser Karls VI, das in der Kaiserloge hängt, als Dank für den
Bau der Winterreitschule in Wien.

Die Steppenkrieger
Seit fast einem halben Jahrtausend wird an der Hofreitschule mit den
Lipizzanern eine militärisch begründete Reitkunst gepflegt. Bereits
Jahrtausende davor hat die Kunst des Reitens zahlreichen Völkern aus
den weiten Steppen Eurasiens immer wieder zu Siegen und Eroberungen
verholfen und zu politischen und sozialen Umwälzungen in Europa
geführt. Die Skythen, Hunnen, Awaren, Magyaren und Mongolen haben vor
dem Beginn der Tradition in Österreich vorgelebt, wie die profunde
Ausbildung von Pferden und der enge Zusammenhalt zwischen Tier und
Reiter eine erfolgreiche Kriegsführung ermöglichen.
Die Skythen - Krieger aus dem Osten
Vor 2700 Jahren tauchten rund um das Schwarze Meer plötzlich Skythen
auf. Zahlreiche Funde belegen ihre vom Reiten bestimmte Kultur. Sie
ritten ohne Steigbügel und nur mit leichten Sätteln oder Satteldecken.
Die skythischen Reiter waren gefürchtete Bogenschützen. Mit ihren
jederzeit griffbereiten kleinen Reflexbögen konnten sie ihre Pfeile
auch im Reiten abschießen. Am Gürtel links trugen sie einen Köcher, den
„Goryt", überzogen mit üppigen goldenen Beschlägen. Bei der Pflege
ihrer Pferde ließen sie sich durch nichts stören. Es wird in Quellen
berichtet, dass ein skythischer König. während er in Ruhe sein Pferd
bürstete, einen hohen Gast empfing. Die Skythen bestatteten ihre Toten
in ihrer Tracht und Schmuck zusammen mit ihren Pferden und dem reichen
Pferdegeschirr. Die skythischen Pferde begleiteten ihren Reiter bis ins
Jenseits.

Die Zuchtbücher in Piber
In Piber wird nach den klassischen Richtlinien des barocken
Lipizzanertyps gezüchtet, in der direkten Nachfolge der alten
kaiserlichen Herde. Die Dokumentation der Abstammung hat in der
Pferdezucht große Bedeutung, und wird in Zuchtbüchern dokumentiert, die
bis heute von Hand geführt werden und im Archiv in Piber aufbewahrt
sind. Eine erfolgreiche Zucht gelingt aber nur mit sorgfältig
ausgesuchten Stutenfamilien. Durch die konsequente Zucht konnten die
Lipizzaner als eigene Rasse über so lange Zeit erhalten werden.
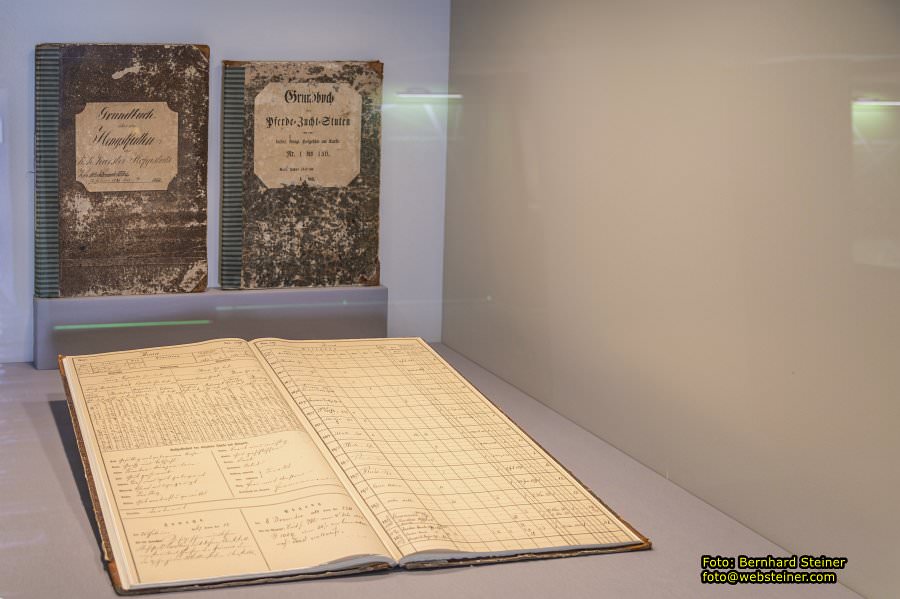
Pferde und Kutschen
Das Geschirr oder Schirrung dient der Anspannung von Tieren vor einem
Wagen oder einem anderen fahrbaren Gerät. Das Joch gilt als die älteste
Anspannung und ist seit 5500 Jahren im Nahen Osten und in Europa durch
archäologische Funde nachgewiesen. In Mitteleuropa werden heute fast
nur noch Pferde als Zugtiere eingesetzt und zwar meist mit dem
Kumtgeschirr oder dem Brustblattgeschirr. In Piber werden die
Lipizzaner im Reiten und Fahren ausgebildet und präsentieren ihre
Fähigkeiten bei besonderen Vorführungen. Piber beherbergt auch eine
eigene Fahrschule, bei der die Kunst des Gespannfahrens von
Interessierten erlernt werden kann. In der Geschirrkammer im Schloss
Piber sind historische Geschirre, Zaumzeuge und Sättel ausgestellt,
welche bis heute, wie auch die historischen Wagen, erhalten und
eingesetzt werden.
Imperialwagen des Wiener Hofes mit einer berittenen Kutsche. Die
Prunkgeschirre der Pferde stammen aus dem 18. Jahrhundert, die Lakaien
und die Reiter tragen die schwarz-gelbe Spanische Livree aus Samt der
höchstrangigen Bediensteten des Oberststallmeisters. Sie wurde nur bei
außerordentlich feierlichen Anlässen getragen.
Imperialwagen mit Achterzug vor dem Wiener Stephansdom, Johann Erdmann
Prestel um/nach 1851

Die Ausstattung der Bereiter
Die Empire-Uniform der Bereiter ist seit 200 Jahren fast unverändert.
Der Bereiter trägt einen kaffeebraunen hochgeschlossenen Reitfrack mit
versteckter Zuckertasche, eine weiße Hirschlederhose, Stulpstiefel,
Schwanenhalssporen, einen Zweispitz am Kopf, und weiße Handschuhe aus
Rehleder. Oberbereiter und Bereiter haben als Rangabzeichen eine breite
Goldborte, Bereiter-Anwärter haben nur eine schmale Goldborte am
Zweispitz. Der Oberbereiter hat drei Goldbordüren, der Bereiter zwei
und der Bereiter-Anwärter nur eine an seiner Schabracke. Die Bereiter
in Wien verwenden eine traditionelle Birkengerte. Verwendet wird nur
der Stamm einer 6 bis 8 Jahre alten Birke. Vor der Verwendung wird die
Gerte einen Tag ins Wasser gelegt. Sie wird jedes Jahr im Jänner von
den Bereitern selbst geschnitten.
Gebisse für Wagenpferde, Spanische Hofreitschule Gestüt Piber

Das Gestüt Piber ist die Wiege der weltberühmten Lipizzanerhengste der
Spanischen Hofreitschule in Wien. Die weißen Stars können bei geführten
Gestütsbesichtigungen, Kutschenfahrten, Galaveranstaltungen sowie bei
der Sommerfrische auf der Alm in all ihren Facetten erlebt werden.
Die Lipizzaner Zucht in Piber
Das Lipizzanergestüt Piber ist weltweit das einzige Gestüt, in dem
Nachkommen aller noch existierender klassischen Lipizzaner
Stutenfamilien und Hengstlinien gezogen werden. Die für die Zucht
ausgesuchten Hengste sind die Besten der Spanischen Hofreitschule. Sie
kommen, nach einer intensiven Ausbildung, für eine Saison zurück in das
Gestüt nach Piber, um ihre hervorragenden Eigenschaften an ihre
Nachkommen weiterzugeben. Von Jänner bis Juni werden die dunkel
gefärbten Fohlen geboren. Sie bleiben mit ihrer Mutter zwei Wochen fern
von der Herde und werden dann vorsichtig wieder in die Herde
eingegliedert. Das Fohlen darf jederzeit bei der Mutterstute trinken.

Historische Zucht- und Ausbildungsstätte für die berühmten Lipizzaner
der Spanischen Hofreitschule.
GESTÜTSEINGANG - HEIMAT DER ÖSTERREICHISCHEN LIPIZZANER
Nach Auflösung des Hofgestüts Lipica (im heutigen Slowenien fand die in
Österreich verbliebene Lipizzanerherde 1920 hier ihre neue Heimat Alle
Schulhengste der Spanischen Hofreitschule in Wien stammen aus dem
Lipizzanergestüt Piber. Hierher kehren sie auch nach der Ende ihrer
erfolgreichen Laufbahn für einen geruhsamen „Ruheabend" zurück.

Piber - der Beginn
Der römisch-deutsche Kaiser Otto III. schenkte im Jahr 1000 etwa 520
km² Land um Piber dem Markgrafen Adalbero von Eppenstein, der mit der
Neubesiedlung des Landes begann. Bereits 1020 entstand in Piber ein
befestigter Hof gemeinsam mit der romanischen Kirche St. Andreas. Den
Hof und das umliegende Land in Piber schenkte Herzog Heinrich III. von
Kärnten dem 1103 gegründeten Stift St. Lambrecht. Das Schloss wurde
1696-1728 als Residenz für die Äbte und Mönche des Stifts erbaut. Über
3000 Menschen in 405 zinsbaren Häusern, und 3663 Schafe gehörten im
Jahre 1792 zur Herrschaft.
Die jungen Lipizzaner
Die ersten vier Monate seines Lebens ist die kräftigende Stutenmilch
die wichtigste Ernährung für das Fohlen. Ab der ersten Woche knabbert
das Fohlen am Heu und kostet ab der zweiten bereits den frischen Hafer.
Nach ca. 6 Monaten wird das Fohlen von der Mutter abgespänt und wächst
bis zum Alter von einem Jahr mit den anderen gleichaltrigen Fohlen
beiderlei Geschlechts in der Herde am Aufzuchtshof für Fohlen in Kampl
auf. Bevor die jungen Pferde geschlechtsreif sind, werden sie getrennt
und auf gestütseigene Höfe in der Umgebung aufgeteilt. Die Hengste
verbringen ihre Jugend am Außenhof Wilhelm, die Jungstuten auf dem
Reinthalerhof.

Piber und die Lipizzaner
Im Ersten Weltkrieg wurde ein Teil der Lipizzanerherde vom
habsburgischen Lipizza nach Laxenburg verlegt. Piber wurde nach dem
Krieg 1920 als geeigneter Ersatz für das jetzt zu Italien gehörige
Gestüt Lipizza gesehen. Die lange Tradition der Pferdezucht, das Klima
und die Natur, wie die weiten Almen in der nahen Umgebung, schienen für
die Lipizzanerzucht in Österreich optimal. Mehrere Umsiedlungen führten
die Lipizzaner und ihre Betreuer durch die stürmische Zeit des Zweiten
Weltkrieges. Nach langwierigen Verhandlungen konnte 1952 ein Teil der
Pferde nach Piber zurückgeholt werden. Heute kommen die weißen Hengste
in Wien ausschließlich aus dem Gestüt in Piber.

Die Hohe Schule der Reitkunst
Vom 15. bis zum 16. Jahrhundert wurde die Hohe Schule der Reitkunst an
den Fürstenhöfen Europas beliebt. Ritterliche Ideale und die Tradition
des Zeremoniellen kamen der Schulreiterei sehr entgegen. Dies traf
besonders auf den Kaiserhof in Wien zu. Das Pferd bekam eine neue
Bedeutung. Neben seiner Wichtigkeit im Einsatz im Krieg wird das Pferd
zum Prestigeobjekt für den Adel. Reitunterricht und Ausbildung in der
Pferdedressur werden Teil der adeligen Erziehungsaufgaben. In der
Ausbildungsstufe der Hohen Schule bringt der Reiter sein Pferd zur
Perfektion. Der Hengst lernt Piaffe, Passage, Galopppirouetten und
Galoppwechsel von Sprung zu Sprung. Begabte Hengste lernen die
Schulsprünge Levade, Kapriole und Courbette.
Der Wagenschimmel
Auf den fürstlichen Höfen kamen Wagenfahrten in Mode. Ausflüge in die
Parkanlagen wurden zum beliebten Zeitvertreib. Die damals schweren und
schwerfälligen Stadtfahrzeuge wichen wendigen, gefederten Kutschen mit
aufklappbarem Verdeck, selber kutschieren wurde zum Sport. Dafür
brauchte es aber auch das geeignete Pferd. In Lipizza wurden nicht nur
die Reitpferde für den Hof, sondern auch repräsentative Wagenschimmel
gezüchtet. Der österreichische Kaiserhof bevorzugte Pferdegespanne mit
gleichartigen Haarfarben.

Ein Damenkarussel in Wien
Anlässlich der Wiedereroberung Prags richtete Maria Theresia am 2.
Januar 1743 in der Winterreitschule der Hofburg ein Fest aus. Dabei
wurde ein „Damenkarussell" ausgetragen: Die Herrscherin führte die
erste Quadrille von Reiterinnen an. Die Wagen wurden von Kavalieren
gelenkt. Nach dem Fest fuhr Maria Theresia mit ihren Hofdamen in den
Karussell-Wagen rund um den Michaelerplatz. Die Wiener Bevölkerung
bestaunte die Festgesellschaft. Im Rahmen des Wiener Kongresses wurde
ein aufwendig geplantes und ausgestattetes Karussell in der
Hofreitschule veranstaltet. Es fanden ritterliche
Geschicklichkeitsspiele und ein Scheingefecht statt.
Karusselle, im Mittelalter bei ritterlichen Turnierveranstaltungen
abgehalten, wurden in der Barockzeit sehr beliebt. Sie waren ein Teil
der Pferdeballette, die vor allem zu Hochzeiten aufgeführt wurden. Beim
„Damenkarussell" Maria Theresias, der Tochter von Kaiser Karl VI,
tanzten die Herrscherin und ihre Hofdamen mit Pferd und Wagen die
Quadrille und nahmen in der Winterreitschule an
Geschicklichkeitsbewerben teil.

Zeit für die Ausbildung
Mit 3,5 Jahren beginnt für die Pferde der Ernst des Lebens. Nach der
Rückkehr von der Sommerfrische auf den Almen werden sie auf ihre
Eignungen und Talente getestet. Dabei wird entschieden welche der
Hengste für eine Ausbildung übernommen werden sollen und welche Stuten
zur weiteren Zucht geeignet sind. Die Zuchtstuten aus Piber bekommen
mit sechs Jahren ihr erstes Fohlen. Jene Hengste, die nicht zur
Ausbildung kommen, werden als Repräsentationspferde ausgebildet. Sie
absolvieren eine Ausbildung im Gespann und unter dem Sattel und stellen
dabei ihren Charakter, ihre Lernfähigkeit und Leistungen unter Beweis.
Zu besonderen festlichen Anlässen in Piber führen sie ihre Reit- und
Fahrkünste vor.
Weiße und dunkle Lipizzaner
In den Hofgestüten werden ab Mitte des 19. Jahrhunderts vor allem
„Kaiserschimmel" gezüchtet, eine bis heute feste Tradition. Die weiße
Farbe der Lipizzaner gilt auch als Rassestandard und ist heute zum
Markenzeichen geworden. Verantwortlich dafür ist das sogenannte
Grey-Gen, eine Mutation, welche ein sehr schnelles Ergrauen des
Pferdefells verursacht. Mit etwa sechs bis acht Jahren sind die Pferde
komplett weiß. Alle Schimmel erben diese identische Mutation von einem
einzigen gemeinsamen Vorfahren. Trotzdem gibt es bis heute auch farbige
Lipizzaner. Ein Sprichwort besagt: „So lange es mindestens einen
dunklen Lipizzaner in Wien gibt, wird es die Spanische Hofreitschule
geben".

Der Sommer auf der Alm
Die jungen Hengste und Stuten verbringen den Sommer auf den Hochalmen
in 1600 Metern Höhe. Dort üben die Jungtiere Trittsicherheit im steilen
Gelände. Sehnen, Gelenke, und Muskulatur werden trainiert und gestärkt.
Das rauhe Bergklima kräftigt die Tiere allgemein und steigert ihre
Widerstandskraft. Nach drei Monaten Sommerfrische auf der Stubalm,
werden die jungen Pferde wieder nach Piber geholt. Die feierliche
Rückkehr startet früh am Morgen. Bei der ersten Station werden die
Tiere festlich geschmückt und vor der Wallfahrtskirche Maria Lankowitz
bzw. Kainach gesegnet für den weiteren Abstieg ins Tal. Dort werden sie
mit einem Fest von begeisterten Lipizzanerfreunden empfangen, bevor sie
in ihre Stallungen zurückgeführt werden.

FOHLENSTATION - DER
GEBURTENBEREICH
Im Geburtenbereich können die werdenden Pferde-Mütter Tag und Nacht
betreut werden. Die Stute trägt ihr Fohlen 333 Tage. Bereits einige
Minuten nach der Geburt steht das Fohlen auf eigenen Beinen.
Mutterstute und Fohlen bleiben bis zu zwei Wochen nach der Geburt in
diesem geschützten Bereich. Bereits in den ersten Lebenstagen
unternimmt das junge Fohlen kleine Ausflüge an der Seite seiner Mutter.
In der ersten Lebenswoche werden die züchterischen Daten des Fohlens
erhoben und dokumentiert. Besondere Abzeichen an Kopf und Beinen, sowie
der Körperbau und die Vitalität werden beschrieben.
LAUFSTALL - MUTTERSTUTEN MIT
IHREN FOHLEN
Hier befinden sich die Mutterstuten mit ihren Fohlen. Sie stehen auf
einem weichen Strohbett. Wenn man die Stutenherde genau betrachtet,
sind Unterschiede in der Färbung des Fells zu erkennen. Einige Monate
nach der Geburt beginnt beim Fohlen der erste Haarwechsel und somit die
erste Verfärbung. In der Lipizzanerzucht gibt es reinweiße
Milchschimmel, Fliegenschimmel (schwarze Punktierung), Forellenschimmel
(braune Punktierung) und Mischschimmel. Sechs Monate bleibt das Fohlen
bei der Mutter. Dann wird es von ihr getrennt („abgespänt") und
übersiedelt gemeinsam mit der gesamten Fohlenherde auf den Aufzuchthof.

UNESCO Kulturerbe
Seit einem Jahrhundert wird im Gestüt in Piber das vierhundertjährige
Wissen um die Zucht der Lipizzaner von einer Generation an die nächste
nur mündlich weitergegeben und in Zuchtbüchern, die bis heute händisch
geführt werden, dokumentiert. Das Herz der Lipizzanerzucht in Piber
sind die Mutterstuten. Jährlich werden in Piber rund 40 Fohlen geboren
und zwar nicht in ihrem berühmten Weiß, sondern in Schwarz, in Grau
oder in Braun.
UNESCO Kulturerbe der Menschheit
Das Wissen um die klassische Reitkunst und ihre traditionelle
Darstellung als Hohe Schule wird bis heute an der Spanischen
Hofreitschule in Wien von einer Bereitergeneration an die nächste nur
mündlich weitergegeben; in nationalen wie internationalen
Reitvorführungen der Öffentlichkeit präsentiert. Dabei lernen die
jungen Eleven und Bereiteranwärter die Kunst nicht nur von ihren
älteren Kollegen, sondern auch von den Schulhengsten selbst.

Das Lipizzanergestüt Piber beherbergt die Lipizzanerfohlen bis zu ihrem
sechsten Lebensmonat.
Dann werden sie von ihren Müttern abgespänt und verbringen die nächsten
sechs Monate am Außenhof Kampl - unserem „Kindergarten". Da Pferde mit
einem Jahr geschlechtsreif werden, gehen die Stuten und Hengste von da
an ihre eigenen Wege.

HENGSTSTALL - DIE JUNGEN HENGSTE
Die am besten geeigneten Junghengste übersiedeln im Alter von knapp 4
Jahren zur Ausbildung auf den Heldenberg (Niederösterreich). Dort
werden sie nach den Regeln der Klassischen Reitkunst ausgebildet. Im
Alter von ca. 10 Jahren haben die Hengste ihre Ausbildung
abgeschlossen. Während der Ausbildung stellen sie ihren Charakter sowie
ihre Lern- und Leistungsbereitschaft unter Beweis. Meist kommen sie
auch für eine Decksaison nach Piber, um ihr edles Erbgut an ihre
Nachkommen weiterzugeben. Im Alter zwischen 20 und 25 Jahren treten die
Schulhengste aus der Spanischen Hofreitschule in Wien ihren
wohlverdienten Ruhestand an und kehren an ihre Geburtsstätte, in das
Lipizzanergestüt Piber, zurück. Die Hengste führen einen Doppelnamen,
der von ihrer Abstammung abgeleitet wird. Er setzt sich aus dem Namen
der Stammlinie des Vaters und dem Namen der Mutter zusammen. Gezüchtet
wird nach sechs klassischen Hengststammbäumen.
Am Kopf links (der „Ganasche") ist das „L" zu sehen. Dieses Zeichen
wird im Gestüt als Reinrassigkeitsbrand vergeben und geht historisch
auf Kaiser Leopold I. zurück, der alle Pferde mit seinem
Anfangsbuchstaben versehen ließ. In der linken Sattellage berindet sich
der Abstammungsbrand, in der rechten der Fohlenbrand.

WAGENREMISE - HISTORISCHE
KUTSCHEN UND SCHLITTEN
Die historischen Kutschen und Schlitten, die sich in der Wagenremise
befinden, sind zwischen 100 und 140 Jahre alt und voll
funktionstüchtig. Sie werden nicht für den täglichen Fahr- und
Ausbildungsbetrieb verwendet, sondern kommen nur bei repräsentativen
Anlässen zum Einsatz. Verschiedene Bauarten machen die
unterschiedlichen Verwendungszwecke deutlich - ob es sich z. B. um
einen Herren- oder Kutschierwagen oder eine Gebrauchskutsche für
Transporte handelt. Größe und Gewicht entscheiden, ob die Kutsche ein-,
zwei- oder mehrspännig gefahren wird. Zu einer stilvollen Anspannung,
auch „Equipage" genannt, gehören neben der passenden Kutsche und dem
Geschirr auch geeignete Pferde bis hin zur richtigen Kleidung des
Kutschers und seines Beifahrers.

LANDAUER
Glaslandauer mit Lederverdeck, nach hinten abzuklappen
Verglaste Vorderfront ist unter den Kutschersitz zu klappen
Gebaut von S. Ambruster, K. u. K. Hofwagenfabrik in Wien um 1910
Vierspännig zu fahren

VICTORIA
Der mittleren Größe
War als Hofwagen in Verwendung
Gebaut um 1880
Zweispännig zu fahren

CHAR-Á-BANCS
Gebaut von Jacob Lohner & Co in Wien um 1890 (Hofwagen)
Hoher Gesellschafts- und Jagdwagen nach englischem Vorbild
Mindestens vier- oder mehrspännig zu fahren

PARKWAGEN
Gebaut von der K. u. K. Hofwagenfabrik Armbruster in Wien um 1910
Damenkutschierwagen vom Typ des Duc
Ausführung eines Korbwagens
Zweispännig zu fahren

JAGDWAGEN
Gebaut um 1880 vom Typ Sandschneider Esterhazy
War als Kutschierwagen des Kronprinzen Rudolf in Verwendung
Kaiserkrone in den Laternengläsern eingeschliffen
Zwei- und mehrspännig zu fahren

VIS-A-VIS
Gebaut um 1900
Offener viersitziger Hofwagen
Vergoldetes Doppeladlerwappen auf den Türen
Kaiserkrone in den Laternengläsern eingeschliffen
Zwei- und mehrspännig zu fahren

KLASSISCHER BUGGY
Mit breitem Radstand, dünnen Speichen und schmalem Wagenkasten
Ein äußerst leichtes Fahrzeug mit großer Spurbreite aus extrem zähen
und leichtem Hickory-Holz gefertigt.
Verdeck nach hinten aufklappbar
Leihgabe der Familie Dobretsberger

AUSBILDUNGSSTALL - ZUKÜNFTIGE ZUCHTSTUTEN
Einige ausgewählte Junghengste werden jedes Jahr zur Ausbildung auf den
Heldenberg (Niederösterreich) und an die Spanische Hofreitschule
entsandt. Die Jungstuten, welche zur Zucht vorgesehen sind, werden im
Gestüt 2 Jahre ausgebildet und einer Leistungsprüfung unterzogen, bevor
sie in die Zuchtstufenherde übernommen werden. Diese Leistungsprüfung
umfasst eine Grundausbildung im Gespannfahren und unter dem Sattel.

Lipizzaner als Skulpturen aus Hufeisen zieren die Zufahrtsstraße zum
Gestüt.
Künstler Sascha Exenberger hat Geschäftsführerin Sonja Klima einen
Wunsch erfüllt und 2020 zwei Pferde nach dem Abbild des legendären
Neapolitano Nima I. gestaltet.

Wem der viele Text zu lange war und lieber Bewegtbilder mit Musik mag,
kann sich gerne dieses Video antun: