web steiner
Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen
Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.
+43/2624/54014 - office@websteiner.com
Palais Niederösterreich
Tag des Denkmals, September 2023
Das alte Niederösterreichische Landhaus im ersten
Wiener Gemeindebezirk ist eines der geschichtsträchtigsten und
traditionsreichsten Gebäude des Landes Niederösterreich. Im Jahr 1513
erwarben die Stände Niederösterreichs, Vorläufer des heutigen
Niederösterreichischen Landtags, unweit der Hofburg eine Realität von
den Brüdern Liechtenstein, um hier ihre Landtage abhalten zu können. Ab
1835 erfolgte ein umfassender Umbau im klassizistischen Stil. Im
Inneren haben sich bedeutende Ausstattungen aus allen Bauphasen
erhalten.

Für Kulturinteressierte werden am Tag des Denkmals wieder spezielle
Führungen durch die Prunkräume angeboten, bei denen auch die eine oder
andere Anekdote erzählt wird. Es besteht die Möglichkeit, die
Räumlichkeiten auf eigene Faust zu erkunden.

Landhauskapelle - Ursprünglich
Torhalle mit prächtigem spätgotischen Schlingrippengewölbe, errichtet
1514/15; 1845/46 im Zuge des Umbaues des Landhauses von Architekt
Ludwig Pichl zur Landhauskapelle umfunktioniert; neues Altarbild
entworfen von Ludwig Schnorr von Carolsfeld, ausgeführt vom Glasmaler
Carl Geyling.
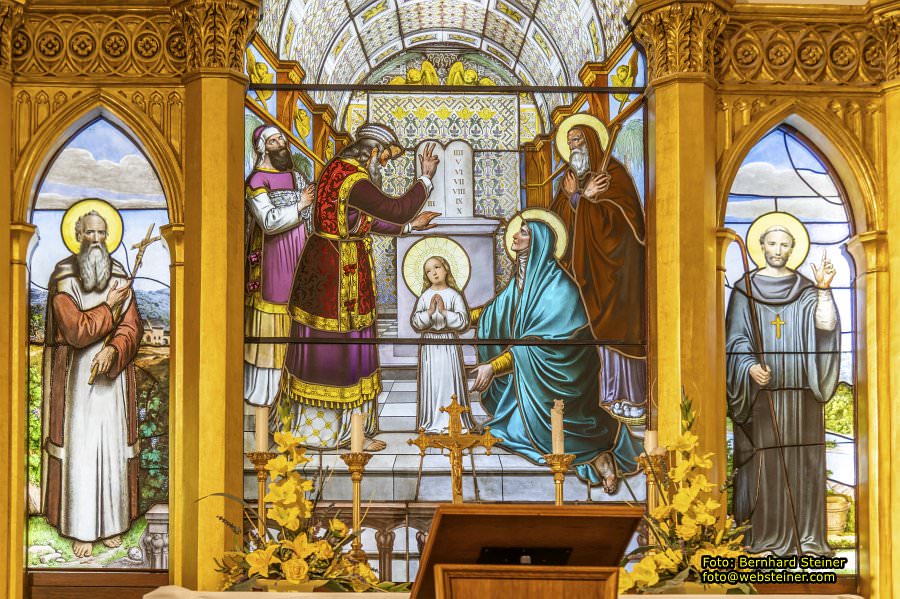
Heute wird das Palais Niederösterreich erfolgreich als
Veranstaltungszentrum geführt. Unter der Dachmarke „Event Residenzen
Niederösterreich“, zu der das Palais Niederösterreich gehört, befinden
sich auch das historische Conference Center Laxenburg und die neu
renovierte Villa Schönthaler am Semmering.

Marschallstiege - Die
sogenannte „Marschallstiege", die allein das Hauptgeschoss erschließt,
wurde als repräsentative Feststiege vor dem Großen Sitzungssaal
1845/1846 nach Plänen von Architekt Ludwig Pichl errichtet. Sie ist
nach dem Landmarschall, dem Vorsitzenden des ständischen Landtages,
benannt und gilt als das schönste klassizistische Stiegenhaus Wiens.
Die Wappenwand an der Stirnseite der Marschallstiege zeigt das
historische und heutige Wappen Niederösterreichs sowie die Wappen jener
landesfürstlichen Städte und Märkte, die als „Vierter Stand" im Landtag
Sitz und Stimme hatten, ergänzt durch die Wappen jener Städte, in denen
sich heute Bezirkshauptmannschaften befinden.

Rittersaal -
Renaissance-Sitzungszimmer für den Ritterstand, errichtet 1573/74 von
Hans Saphoy; heutige Innenausstattung 1845/47 von Architekt Leopold
Ernst; 1725 Aufstellung des prachtvollen barocken „Justitia-Throns";
Verwendung des Saales: als Beratungszimmer des Ritterstandes, für
Gerichtssitzungen des „Landmarschallischen Gerichtes", als Sitzungs-
und Festsaal.

Justitia-Thron von 1725

Herrensaal -
Renaissance-Sitzungszimmer für den Herrenstand, errichtet 1572/73 von
Hans Saphoy; heutige Innenausstattung 1845/47 von Architekt Leopold
Ernst; Holzschnitzarbeiten an Wänden und Türen von Bildhauer Christian
Schneider; Verwendung des Saales: als Beratungszimmer des
Herrenstandes, für Ausschußsitzungen des Landtages, als Sitzungs- und
Festsaal.


Landtagssaal = Großer Saal -
Renaissance-Saal mit mächtigem Muldengewölbe, errichtet 1572 von Hans
Saphoy; 1710 barockes Deckenfresko von Antonio Beduzzi, Darstellung der
Größe des „Hauses Österreich", der Dynastie der Habsburger; Verwendung
vom 16.-20. Jh. als Sitzungssaal des NÖ Landtages, als Festsaal und
Konzertsaal.



Die Säle des Niederösterreichischen Landhauses waren ab dem 16.
Jahrhundert nicht nur Schauplatz politischer Beratungen, sondern
dienten auch der Abhaltung von höfischen und adeligen Festlichkeiten.
Der Große Sitzungssaal spielte im musikalischen Leben Wiens eine
wesentliche Rolle und steht mit Händel (Aufführung des Oratoriums
„Timotheus"), Schubert (Uraufführung von „Geist der Liebe"), Liszt
(1823 Auftritt im Alter von elf Jahren) und Beethoven in Zusammenhang.
Schon früh fanden hier musikalische Akademien und symphonische Konzerte
statt.

Prälatensaal -
Renaissance-Sitzungszimmer für den Prälatenstand, errichtet 1572 von
Hans Saphoy; heutige Innenausstattung 1845/47 von Architekt Leopold
Ernst; Die Wappen der vierzehn niederösterreichischen Stifte und
Propsteien an der Decke schuf der Maler Karl Taege; Verwendung des
Saales: als Beratungszimmer des Prälatenstandes, als Sitzungs- und
Festsaal.

Gotisches Zimmer - Ursprünglich
eine Art Vorhalle zwischen der ehemaligen Bürgerstube und dem
Prälatensaal, ausgestattet mit prächtigem spätgotischem
Sternrippengewölbe, errichtet 1515/1516; Das sogenannte
„Leopoldfenster" ist 1885 anlässlich des 400-Jahr-Jubiläums der
Heiligsprechung des Markgrafen Leopold III., des niederösterreichischen
Landespatrons, entstanden. Das Glasbild wurde von der Glasmalerfirma
Carl Geyling ausgeführt.

ZEITTAFEL ZUR GESCHICHTE DES NIEDERÖSTERREICHISCHEN LANDHAUSES
1513 Die oberen Stände
Niederösterreichs erwarben unweit der Hofburg ein Haus von den Brüdern
Liechtenstein, um hier ein Gebäude zu errichten, das als fester
Amtssitz für die ständische Administration und als Versammlungsort für
die ständischen Landtage dienen sollte.
1513-1533 Erste Bauphase, Im
spätgotischen Stil unter der Bauleitung der Dombaumeister Anton Pilgram
und Jörg Öchsel. Errichtung eines einstöckigen Quertraktes gegen den
Minoritenplatz mit einem großen Sitzungssaal und kurzen Flügeln
Richtung Herrengasse. Die Torhalle, jetzt Landhauskapelle, die
Pförtnerstube und das Gotische Zimmer mit ihren bedeutenden
spätgolischen Gewölben sind heute noch in ursprünglicher Form erhalten.
1562-1586 Zweite Bauphase. Im
Renaissanceslil unter der künstlerischen Leitung von Dombaumeister Hans
Saphoy. Völlige Neugestaltung des Hauptgeschosses mit dem Landtagssaal
und den Beratungssälen der Stände sowie Aufstockung des Gebäudes und
Vorziehen der Flügel bis zur Herrengasse. Heute noch original erhalten
ist die Verordnetenratsstube, der schönste Renaissance-Innenraum Wiens.
1710 Ausgestaltung des Großen
Saales (heute Landtagssaal) durch ein parockes Deckenfresko von Antonio
Beduzzi, Darstellung der Größe des „Hauses Österreich", der Dynastie
der Habsburger.
1837-1848 Dritte Bauphase.
Neukassizistischer Umbau des Landhauses unter größtmöglicher Erhaltung
der historischen Bausubstanz durch Architekt Ludwig Pichl. Verlegung
der Hauptfassade vom Minoritenplatz zur Herrengasse.
1848 Die Revolution von 1848, die auch die Ständische Volksvertretung beseitigte, nahm vom Landhaus ihren Ausgang.
1861 Der erste gewählte Landtag
von Niederösterreich, der aufgrund des „Februarpatentes" von 1861 nach
einem Zensuswahlrecht Im März desselben Jahres gewählt worden war trat
am 6. April 1861 zusammen. Brennpunkte der Tätigkeit des Landtages
waren die Schulpolitik, die Verbesserung der Verkehrsverhältnisse und
das Wasserbauwesen, wie die Regulierung der Donau.

1907 Die Änderung der
Landtagswahlordnung 1907 brachte eine Erhöhung der Landtagssilze aut
127 und das Wahlrecht für alle männlichen Staatsbürger über 24 Jahre.
Das Frauenwahlrecht wurde erst 1919 eingeführt.
1918 Am 21. Oktober 1918 fand
im NÖ Landhaus durch die deutschsprachigen Reichsratsabgeordneten unter
Berufung auf das Selbstbestimmungsrecht der Völker die Konstituerung
der „Provisorischer Nationalversammlung des selbständigen
Deutsch-Österreichischen Staates" statt, war also hier die
Geburtsstunde der 1. Republik.
1920/1921 Mit dem Inkrafttreten
der Bundesverfassung vom 10. November 1920 wurde das bisherige Kronland
Österreich unter der Enns in Niederösterreich-Land und Wien geteilt
sowie der Landtag in zwei Kurien gegliedert. Mit dem Trennungsgesetz
vom 29. Dezember 1921 beschluss der „Gemeinsame Landtag" die Teilung in
die zwei selbständigen Bundesländer Wien und Niederösterreich, die am
1. Jänner 1922 in Kraft trat. Damit war die lange Geschichte des
gemeinsamen Landtages von Wien und Niederösterreich zu Ende.
1945 Die drei Länderkonferenzen
im September und Oktober 1945 im NÖ Landhaus führten zur
österreichweiten Anerkennung der Regierung Renner und verhinderten so
eine Teilung des Landes in Ost- und Westösterreich.
1986 In der Festsitzung vom 10.
Juli 1986 beschloss der NÖ Landtag einstimmig die Erhebung St. Pöltens
zur Landeshauptstadt von Niederösterreich.
1997 Die NÖ Landesregierung und der NÖ Landtag übersiedelten von Wien in das neu errichtete Regierungsviertel in St. Pölten.
2002-2005 Renovierung des Alten Landhauses durch die Via Dominorum Grundstückverwertungsgesellschaft m.b.H.
2005 Am 8. September 2005 wurde
im Alten Landhaus das Veranstaltungszentrum „Palais Niederösterreich"
und am 6. Oktober 2005 die Galerie für zeitgenössische Kunst „Kunstraum
Niederösterreich" eröffnet.

Im Zentrum von Wien, da, wo einst die Geschicke des Landes
Niederösterreichs gelenkt wurden, befindet sich das Palais
Niederösterreich. Über die Prunkstiege erreichen Sie die 4 historischen
Prunkräume im Obergeschoss. Im Erdgeschoss befindet sich der
herrschaftliche Innenhof, die kleine Kapelle, sowie ein Seminarraum.
Insgesamt gibt es viel Raum für stilvolle Events — für bis zu 680
Personen drinnen und 980 Personen draussen. Internationale Kongresse,
Galadinner, Seminare, Produktpräsentationen, Pressekonferenzen,
Weihnachtsfeiern sowie private Feste finden im Palais Niederösterreich
eine prunkvolle Umgebung.

Die Erbhuldigung für Ferdinand I. (14. Juni 1835) war das letzte Fest
im traditionellen Rahmen ständischen Prunks. Die Revolutionsereignisse
1848 nahmen im Niederösterreichischen Landhaus ihren Ausgang: Am 13.
März 1848 berieten die Stände hier über drei Adressen, im Hof des
Landhauses wurde eine Rede von Lajos Kossuth verlesen, in der er eine
parlamentarische Verfassung forderte. In den Hof des Landhauses
drängten immer mehr Menschen und der aus Ungarn stammende Adolf
Fischhof hielt eine mit stürmischem Beifall aufgenommen Rede. Noch am
Vormittag fielen die ersten Schüsse vor dem Landhaus, die zahlreiche
Opfer forderten (sog. Märztage). Im Hof befindet sich eine Gedenktafel
für Hans Kudlich, der am 13. März 1848 vor dem Niederösterreichischen
Landhaus durch einen Bajonettstich verletzt worden war.

Die von der Konstituierenden Nationalversammlung am 1. Oktober 1920
beschlossene und am 10. November 1920 in Kraft getretene
Bundesverfassung definierte Wien als eigenständiges Bundesland, weshalb
an diesem Tag vom Wiener Gemeinderat, erstmals als Landtag tätig, die
Wiener Stadtverfassung beschlossen wurde. Wien schied damit
verfassungsrechtlich aus dem Land Niederösterreich aus.
Das in der Folge zur materiellen Seite der Scheidung verhandelte und am
29. Dezember 1921 erlassene Trennungsgesetz, vom Wiener und vom
Niederösterreichischen Landtag gleichlautend beschlossen, ging davon
aus, dass das Landhaus nun zur Hälfte Eigentum Wiens sein würde,
übertrug es aber zur Gänze dem neuen Land Niederösterreich, so lange
Landtag und Landesregierung hier amtieren würden. Würde der Sitz der
politischen Vertreter Niederösterreichs anderswohin verlegt, würde das
Hälfteeigentum der Stadt Wien am Landhaus aufleben.
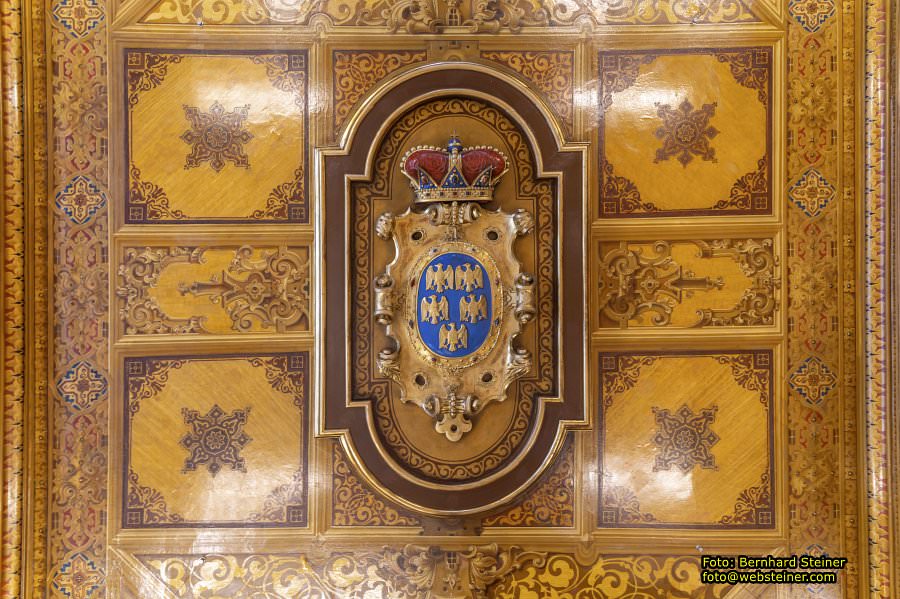
Manuskriptenzimmer





Verordnetenratsstube


Verordnetenratsstube (1572) mit kunstvoller Kassettendecke,
selbstbewusstem heraldischem Programm und reichgeschnitzter Tür des
Hoftischlers Georg Haas (mit Karyatiden, im Aufsatz der von Symbolen
weltlichen Tugenden umgebene Kaiseradler)



1997 wurde der Sitz des niederösterreichischen Landtages in die neue
Hauptstadt St. Pölten verlegt. Nach einer aufwendigen Renovierung von
2002 bis 2004 wird das Gebäude, nunmehr als "Palais Niederösterreich"
bezeichnet, vom Land Niederösterreich für Konferenzen, Sitzungen und
Feierlichkeiten öffentlicher und privater Institutionen genutzt und
kann auch für private Zwecke gemietet werden.
