web steiner
Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen
Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.
+43/2624/54014 - office@websteiner.com
Basilika Sonntagberg
Sonntagberg, Mai 2023
Die Basilika Sonntagberg mit besonderer Bedeutung für
die Umgebung ist die auf dem 704 Meter hohen Sonntagberg gelegene
weithin sichtbare barocke Wallfahrtskirche. Im Jahre 1964 wurde der
Kirche von Papst Paul VI. der Titel einer päpstlichen Basilica minor
verliehen. Die Schatzkammer in der Basilika Sonntagberg zeigt wertvolle Schätze und Gaben von Pilgern im Museum.

Die Basilika Sonntagberg ist dem öffentlichen Nahverkehr NICHT
angeschlossen und macht somit eine ansteigende Wanderung zB von der
Bahnhaltestelle Sonntagberg (57 min bei 2,7 km) und retour zur
Bahnhaltestelle Rosenau (47 min bei 3,2 km) erforderlich.
Steinernes Kreuz: Das Steinerne Kreuz wurde um 1850 - vermutlich von
den Steinbruchbesitzern, die an den Abhängen des Sonntagberges Wetz-
und Schleifsteine gebrochen haben - als Andachtsstätte errichtet. Im
Jahre 1995 wurde das alte Steinerne Kreuz abgetragen und ein völlig
neues errichtet. Nur das Giebelkreuz und das Relief des alten
Bildstocks sind noch im Original erhalten.

Abt Benedikt I von Seitenstetten ließ im Jahre 1440 neben dem
sogenannten Zeichenstein, den die christliche Legende mit wundertätigen
Kräften in Verbindung bringt, eine Kapelle, die dem Erlöser (Salvator)
geweiht war, im gotischen Stile erbauen. Einige Jahre später – um 1448
– erfolgte der Anbau einer Dreifaltigkeitskapelle. 1490 entstand hier
eine spätgotische Kirche.

In den Jahren 1706–1732 wurde von Jakob Prandtauer und Joseph
Munggenast das heutige Gotteshaus erbaut. Hochaltar (1755) und Kanzel
(1757) stammen von Melchior Hefele, die Altarplastiken (1752–1756) von
Jakob Schletterer und die Deckenfresken von Daniel Gran (1738–1743).
Die 1774–1776 von Franz Xaver Christoph († 1793) gebaute Orgel ist eine
der bedeutendsten spätbarocken Orgeln Österreichs. Die Kirche ist der
heiligsten Dreifaltigkeit geweiht, ebenso die an die Errettung vor den
Türken erinnernde Türkenbrunnenkapelle.

Die der Heiligsten Dreifaltigkeit geweihte Wallfahrtsbasilika wurde in
den Jahren 1706 bis 1732 von Jakob Prandtauer und Josef Munggenast
erbaut, die Fresken stammen von Daniel Gran. Die Kirche auf dem
Sonntagberg, das Wahrzeichen des Mostviertels, ist seit Jahrhunderten
für Tausende von Gläubigen ein Ort der Besinnung und erfreut
Kunstfreunde aus nah und fern. 1964 wurde die Kirche von Papst Paul I.
zur Basilika minor erhoben. Ein Kirchenführer liegt im Gotteshaus auf.
Führungen sind nach Anmeldung im Pfarrhof möglich.

Die am nordwestlichen Vierungspfeiler angebrachte, vergoldete Kanzel
entstand nach dem Entwurf Melchior Hefeles im Jahre 1757. Der mit
Akanthusranken und Girlanden geschmückte Korb zeigt Reliefs mit
Darstellungen der Bergpredigt und der Bekehrung des Saulus. Den
Schalldeckel besetzen Figuren der drei christlichen Tugenden Glaube,
Liebe und Hoffnung. An der Rückwand ist das Wappen des Passauer
Fürstbischofs Joseph Dominikus von Lamberg angebracht, der 1.000 Gulden
zu dem Werk stiftete.

Das hier verehrte Gnadenbild aus dem Jahr 1614, der sogenannte
Sonntagberger Gnadenstuhl, geht auf mittelalterliche Vorbilder zurück.
Eine sehr bekannte Darstellung dieser Art stammt von Albrecht Dürer. Ab
dem 17. Jahrhundert war der Sonntagberg eine der bedeutendsten
Wallfahrtsstätten Österreichs, was dazu führte, dass die Darstellung
des Gnadenstuhles weit verbreitet wurde und vor allem in
Niederösterreich zu den häufigsten und bekanntesten
Dreifaltigkeitsdarstellungen gehört.

Die Pfarr- und Wallfahrtskirche zur Heiligsten Dreifaltigkeit thront
weithin sichtbar auf der Kuppe des Sonntagbergs und bietet dem Besucher
am Ziel seiner Reise einen einzigartigen Blick über die Hügel des
Mostviertels bis ins Donautal und in das Voralpenland. Sie ist umgeben
von mehreren mit der Wallfahrt in Zusammenhang stehenden Baulichkeiten,
die teilweise schon vor dem barocken Kirchenbau bestanden, wie etwa der
1652-79 erbaute Pfarrhof, der sich im Osten an das Gotteshaus
anschließt und über einen Brückengang mit diesem verbunden ist. Der
barocke Kirchenbau erhebt sich auf einem über Stiegen zu erreichenden
Plateau von 1758 mit Belüftungs- und Entwässerungssystem, das einen
Umgang um den gesamten Bau ermöglicht. Dieser zeigt sich als
kreuzförmige Basilika mit Doppelturmfassade und gerundetem Chorschluss,
über dem sich ein Dachreiter erhebt. Die in einer Flucht mit den
Seitenschiffen des Langhauses errichteten Anbauten zu Seiten des Chores
beherbergen im Norden die Hl.-Grab-Kapelle und im Süden die Sakristei.
Sie binden den ohnehin sehr kompakt gestalteten Baukörper zusammen und
geben ihm eine feste Basis. Das nur wenig über das Langhaus
hinausreichende Querhaus, dessen in der Mitte erhöhtes Dach auf die
Kuppel im Inneren verweist, verstärkt diese Tendenz noch. Die
Gliederung des Außenbaus bestimmen zusammen mit dem schwach verkröpften
Gebälk die Kolossalpilaster, die auch paarweise erscheinen und die
durchwegs abgerundeten Kanten des Bauwerks kennzeichnen. Außerdem
markieren sie an Langhaus und Chor die Jochtrennung im Inneren der
Kirche.
Bauplastische Zierelemente finden sich lediglich an der Westfassade.
Deren konkav einschwingende Portalachse bekrönen Skulpturen des
Erzengels und zweiten Kirchenpatrons Michael, der Luzifer niederringt,
sowie der Wetterheiligen Johannes und Paulus von 1719. Sie stammen von
dem Bildhauer und Schwiegersohn Prandtauers Peter Widerin (1684-1760),
der auch die Darstellung des von Engeln flankierten Sonntagberger
Gnadenbildes über dem Hauptportal geschaffen hat. Durch das schwere
Eisenplattentor im Westen mit Darstellungen einer Türkin und eines
Türken gelangt man in den Kirchenraum. Dieser präsentiert sich als
kreuzförmige Basilika mit seitlichen Kapellenräumen. Dem vierjochigen
Langhaus, dessen westlichstes Joch als Eingangsraum mit
darüberliegender Orgelempore gestaltet ist, schließt sich im Osten das
Querschiff an. Die Vierung ist mit einer Pendentifkuppel überwölbt,
während die Querarme ebenso wie Langhaus und Presbyterium Tonnengewölbe
mit Stichkappen aufweisen. Der zweijochige, gering eingezogene Chor
schließt in einer flachbogigen Apsis. Hier wie auch im Langhaus
übernehmen korinthische Kolossalpilaster die Gliederung der Wand, die
durch ein verkröpftes Gesims nach oben hin abgeschlossen ist. Darüber
erhebt sich die Wölbzone, die durch weite Fensteröffnungen eine
großzügige Belichtung erfährt. Der Grundriss der Sonntagberger
Wallfahrtskirche ist eng verwandt mit dem Bauplan der Melker
Stiftskirche. Im Aufriss jedoch zeigen sich einige Abweichungen. So
verfügt Melk z.B. über Emporen im Langhaus und eine Tambourkuppel. Ein
wichtiger Unterschied besteht auch in der Wandgestaltung, die in Melk
durch vor- und zurückschwingende Emporenbrüstungen und Gesimse
gekennzeichnet wird, während in Sonntagberg die Flächigkeit der Wand
raumprägend ist.

Die beiden grauen Altäre aus Ybbsitzer Marmor in den Querschiff-armen
sind als Pendants gestaltet und beziehen die Wand in ihren Aufbau mit
ein. Während sich die Sockelzone noch über die ganze Tiefe des
Querhauses erstreckt, nimmt das Säulenretabel darüber nur noch die
Hälfte der Wandfläche ein. Der Marienaltar auf der Nord-seite zeigt
Figuren der Eltern Mariens, Anna und Joachim, von dem Wiener Bildhauer
Johann Georg Dorfmeister (1736-86). Sie flan-kieren eine Darstellung
der Aufnahme Mariens in den Himmel von Martin Johann Schmidt
(1718-1801), dem sog. Kremser Schmidt, aus dem Jahr 1767.
Der in Grafenwörth östlich von Krems geborene Schmidt gilt als der
überragende Meister des spätbarocken Altar- und Andachtsbildes in
Österreich. Er und seine Werkstatt hinterließen ein außerordentlich
umfangreiches Oeuvre an Ölbildern, Zeichnungen und Druckgrafiken. Eine
Vielzahl österreichischer Stifte, darunter Göttweig, St. Peter in
Salzburg und Seitenstetten, sowie eine noch größere Anzahl
österreichischer Pfarrkirchen besitzen Werke aus der Hand des Kremser
Schmidt.
Der erst 1837 fertig gestellte Sakramentsaltar
gegenüber zeigt ebenfalls ein Werk des Kremser Schmidt: die auf 1773
datierte Darstellung der Taufe Christi. Die beiden Skulpturen der
Ordensheiligen Benedikt und Dominikus entstanden 1655 und stammen vom
ehemaligen Hochaltar der ebenfalls zu Seitenstetten gehörenden
Wallfahrtskirche Mariä Himmelfahrt in Krenstetten.

Der Sonntagberg gehört mit Mariazell und Maria Taferl zu den
bedeutendsten und ehrwürdigsten Wallfahrtsstätten Österreichs. Die
Strahl-kraft des Gnadenbildes der Heiligsten Dreifaltigkeit zog Pilger
von weither an und führte das Wallfahrtswesen zu einer Blüte, die in
der Errichtung des barocken Kirchenbaus durch Jakob Prandtauer ihren
Höhepunkt fand. Dessen Ausgestaltung übernahmen bedeutende
österreichische Künstler wie Daniel Gran und Melchior Hefele, die auf
der Grundlage eines theologischen Programms ein barockes
Gesamtkunstwerk erschufen. Künstlerisches Können und benediktinische
Gelehrsamkeit vereinten sich so in vollendeter Weise zum Lob der
Heiligsten Dreifaltigkeit.

Die malerische Ausgestaltung der Wallfahrtskirche ist das kirchliche
Hauptwerk des Malers und Freskanten Daniel Gran (1694-1757), der sein
Werk an der Wölbung des südlichen Querarmes signiert hat. Der in Wien
geborene Künstler weilte im Auftrag seines Förderers, des Fürsten von
Schwarzenberg, in Italien und nahm dort Einflüsse venezianischer und
neapolitanischer Meister auf. Zu seinen Auftraggebern gehörten neben
den Schwarzenberg und dem kaiserlichen Hof zahlreiche geistliche
Institutionen, u.a. die Stifte Herzogenburg, Lilienfeld und
Klosterneuburg. Gran arbeitete von 1738 bis 1743 an der Ausmalung der
Wallfahrtskirche Sonntagberg und schuf sämtliche figuralen Fresken. Mit
der Darstellung unter der Musikempore schloss er sein Werk im Jahre
1754 ab. Die Umrahmung der Fresken mit Architekturmalerei, die
geschickt eine Stuckierung vortäuscht, schufen Antonio Tassi und
Kürchmayr 1740, die Dekormalerei an den Wänden 1748 und 1750 Franz
Josef Wiedon (1703 - um 1782), der auch in Stift Seitenstetten
arbeitete.
Die Fresken thematisieren die Offenbarung des Dreifaltigen Gottes, der
in den drei Kreuzarmen der Kirche - Presbyterium und Querhausarme -
versinnbildlicht ist. Östlich über dem Altarraum ist das erste
Menschenpaar Adam und Eva inmitten der Pflanzen- und Tierwelt des
Paradieses dargestellt; sie stützen sich auf einen Felsen, in dem man
den Zeichenstein der Sonntagberger Wallfahrt erkennen könnte. Über
ihnen schwebt auf einer von Engeln getragenen Wolkenbank der
Schöpfergott. Das Unheil des Sündenfalls deutet sich in der Schlange
mit Menschenkopf am linken Bildrand an. Im nördlichen Querhausgewölbe
sieht man die Menschwerdung Gottes, die Geburt Christi, im südlichen
Querhausgewölbe die Herabkunft des Heiligen Geistes auf Maria und die
Apostel zu Pfingsten. Als Zeugen des Geschehens fungieren die jeweils
an den Gewölbefüßen dargestellten Prophetenpaare.

Überhöht wird das Thema im Kuppelfresko, das Engel, Apostel und
Propheten, Heilige und Märtyrer in Verehrung der Dreifaltigkeit zeigt,
symbolisiert durch das Strahlendreieck im Zentrum. In den
Kuppelpendentifs wohnen dem Geschehen die vier Evangelisten bei. In der
westlichen Bildzone leitet der Erzengel Michael, der die gefallenen
Engel aus dem Himmel vertreibt, thematisch zum Langhausfresko über.
Dieses zeigt die Allegorie der herrschenden und der streitenden Kirche.
Unter den allegorischen Frauenfiguren erkennt man zuoberst die Kirche,
Ecclesia, ausgewiesen durch Tiara und Petrusschlüssel sowie Engel, die
Kreuz und Glocke tragen. Links darunter schließen sich die christlichen
Tugenden Glaube, Liebe und Hoffnung sowie rechts daneben der Alte und
der Neue Bund an. Unterhalb sitzen auf Wolkenbänken links die
Standhaftigkeit, rechts die Stärke, die den Wahlspruch Kaiser Karls VI.
versinnbildlichen: CONSTANTIA ET FORTITUDINE.
In der Mitte triumphiert die streitbare Kirche über ihre Widersacher.
Im übertragenen Sinne als „Stützen“ des Geschehens fungieren die
seitlich in die Architekturmalerei eingefügten vier abendländischen
Kirchenväter. Das chronologisch letzte Fresko aus der Hand Daniel Grans
ist der Traum des alttestamentlichen Patriarchen Jakob von der
Himmelsleiter unter der Empore, das 1754 entstand. Es stellt den Bezug
zur Sonntagberger Wallfahrtslegende her. Verbindendes Element ist der
Stein, auf dem Jakob sein Haupt während des Schlafes bettete und den er
nach dem Aufwachen zum Altarstein salbte.

Das 1774-76 in der Werkstatt des Franz. Xaver Christoph (um 1728-1793)
in Wien gefertigte Orgelwerk hat sich seine klangliche Substanz und
seinen typischen Klangcharakter über die Zeiten relativ unverändert
bewahrt. Es verfügte ursprünglich über 25 Register auf 2 Manualen und
war als reines Begleitinstrument für den Gottesdienst gedacht. Um die
Orgel auch für Konzerte nutzbar zu machen, hat man 1872 und 1959 zwei
zusätzliche Register eingefügt, die jedoch bei einer gründlichen
Restaurierung 2000/01 wieder entfernt wurden. Der um die Westfenster
gruppierte, sechsteilige Rokokoprospekt mit seitlichen Pfeifentürmen
sowie das Brüstungspositiv wurden von den Gebr. Pichler aus Wien mit
Schleierbrettern, Vasen und Girlanden reich verziert. Die vergoldeten
musizierenden Engel und Putten stammen von dem Bildhauer Kögler.

Pfarr- und Wallfahrtskirche zu Ehren der Heiligsten Dreifaltigkeit
Patrozinium: Trinitatis (Sonntag nach Pfingsten) und St. Michael (29. September)
Diözese St. Pölten — Bezirk Amstetten

Der bemerkenswerte, den Kirchenraum beherrschende Hochaltar
entstand in den Jahren 1751-57 nach einem Entwurf des aus Tirol
stammenden Architekten und Erzgießers Melchior Hefele (1716-94).
Ausführender Steinmetz war Gabriel Steinbock aus Wien. Das als
Grundlage für den Vertrag mit dem Künstler dienende Holzmodell hat sich
erhalten und befindet sich heute in den Sammlungen des Stiftes
Seitenstetten. Der Aufbau ist in Form eines frei stehenden Rundtempels
mit zwölf Säulen gestaltet, die das Gnadenbild in ihrem Inneren
umschließen. Als Altar einer Wallfahrtskirche verfügt er im hinteren
Bereich über einen Durchgang für Prozessionen. Den eigentlichen
Altartisch aus Marmor zieren die Leidenswerkzeuge und ein Relief, das
den Auferstandenen vor den Frauen am offenen Grab zeigt. Über der Mensa
erhebt sich der mit Wein- und Blütenranken gezierte Säulentabernakel
aus weißem Marmor, der ein Strahlendreieck als Symbol der
Dreifaltigkeit birgt und von dem Apokalyptischen Lamm, das auf dem Buch
mit den sieben Siegeln ruht, bekrönt wird. Zu dessen Seiten knien zwei
Cherubim in innigster Anbetung, die der Hand des Bildhauers und Wiener
Akademieprofessors Jakob Christoph Schletterer (1699-1774) entstammen.
Schletterer zeichnete auch für die übrige figurale Ausstattung des
Altares verantwortlich. Lediglich die vier vergoldeten Bleireliefs der
Sockelzone und die Tabernakelverzierungen sind Melchior Hefele selbst
zuzurechnen. Die Reliefs zeigen von links nach rechts die Predigt
Johannes' des Täufers, die Verkündigung des Herrn, Christus auf dem
Ölberg und Johannes, der das Himmlische Jerusalem schaut.
Diesen dem Neuen Testament entstammenden Motiven steht der im Zeichen
des Alten Bundes gestaltete Rundtempel gegenüber. Die zwölf
kannelierten, rosafarbenen Marmorsäulen symbolisieren die zwölf Stämme
Israels, die in einer Kartusche auf dem Gebälk jeweils genannt sind.
Die Inschrift in der Mitte schlägt den Bogen zum Fresko Daniel Grans
unter der Orgelempore. Sie nennt eine Stelle aus dem ersten Buch Mose
(Gen 28,17), die sich unmittelbar an Jakobs Traum von der Himmelsleiter
anschließt. Die Säulen tragen den abschließenden Baldachin, auf dessen
Voluten Engel mit Sinnbildern der Eigenschaften Gottes sitzen; von
links: Weisheit (Davidstern), Unendlichkeit (Blattkranz) und Allmacht
(Blitzbündel und Schild). Bekrönt wird der Altar von einer
Strahlenscheibe mit den Initialen Jahwes. Das Gehäuse des Altarauszugs
umschließt eine silberne Wolkenbank, die das in den Himmel aufsteigende
Gebet symbolisiert und vom Gnadenbild im Zentrum des Altars ihren
Ausgang nimmt.
Die als Gnadenstuhl angelegte Darstellung der Dreifaltigkeit zeigt
Gottvater mit der Tiara auf dem Haupt, der den Gläubigen den
gekreuzigten Menschensohn präsentiert. Darunter schwebt der Heilige
Geist in Gestalt der Taube. Das 1614 entstandene, auf eine Kupfertafel
aufgebrachte Gemälde ruht auf einem Teil des Zeichensteins, der bei der
Errichtung des Hochaltars von dem Felsblock abgetrennt wurde. Umgeben
ist es von einem reich gezierten silbernen Rahmen, der von Engeln
getragen und von einer Strahlenglorie hinterfangen wird. Dieser
entstammt der Hand des Goldschmieds Josef Wilhelm Riedl (1714-90), der
auch die berühmte Sonntagberger Monstranz geschaffen hat (heute in den
Sammlungen des Stiftes Seitenstetten). Die vier vergoldeten
Holzskulpturen alttestamentlicher Propheten, die links Mose mit den
Gesetzestafeln und Aaron mit dem Rauchfass, rechts Ezechiel mit den
Tempelmaßen und Melchisedek beim Opferritual darstellen, stammen
wiederum von Jakob Christoph Schletterer. Einen weiteren Zusammenhang
mit dem Alten Testament bildet der kunstvoll geschnitzte siebenarmige
Leuchter über dem Baldachintabernakel. Er wurde 1967 von der Wiener
Kunstschmiedin Traudl Reimers nach Plänen Hefeles angefertigt.

Pilgerreisen brachten Geld in Umlauf und waren deshalb für die
Wirtschaft eine unerlässliche Einnahmequelle. Rund um die Gnadenorte
bildeten sich auf die Bedürfnisse der Pilger spezialisierte Angebote
aus: Von der Unterkunft und Verpflegung über die seelsorgerische
Betreuung am Wallfahrtsort bis hin zu den Andenken und Mitbringseln für
zu Hause wurde der Pilger rundum umsorgt. Viele sozial schlechter
gestellte Pilger verdienten sich auf der Reise durch Gelegenheitsarbeit
ihre Reisekosten. Gesteigerte Pilgerzahlen waren zwar für die Statistik
und die Einnahmen des Gnadenortes von Vorteil, benötigten aber auch
mehr Betreuungspersonal (Klerus, Personal vor Ort) und ‚eine
verbesserte Infrastruktur (Erhaltung von Straßen, Herbergen, Brücken
etc.).
Diebe und Wegelagerer betrachteten die bekannten Pilgerrouten als
attraktives Jagdrevier, sodass ein zusätzlicher Schutz für die
Reisenden nötig war. Vielfach übernahmen Bruderschaften diese Funktion
und kontrollierten Wege und Brücken. Sie förderten die Wallfahrt auch
maßgeblich, indem sie u. a. die Veranstaltung von Prozessionen, das
Ausschmücken von Kirchen und Kapellen, die Förderung von Gottesdiensten
und bestimmten Andachten übernahmen. 1651 erfolgte die Gründung der
Sonntagberger Dreifaltigkeitsbruderschaft. Vor Ort mussten die Pilger
kanalisiert und weitergeleitet werden. Da vor allem im Barock die
Gemeinschaftswallfahrt in einer Art Prozession genauen Richtlinien und
einem festgelegten Zeremoniell folgte, musste am Wallfahrtsort für
einen reibungslosen Ablauf der Prozessionen und Umgänge gesorgt werden.
Der Pilger sollte neben der Teilnahme an Gottesdiensten die Möglichkeit
zu Einzelgebeten und Beichte finden.

Die Statue des heiligen Johannes von Nepomuk auf dem Platz vor der
Wallfahrtsbasilika und dem Pfarrhof ist eine der zahlreichen
Darstellungen des Heiligen in unserer Gegend. Neben den Kreuzes- und
Mariendarstellungen ist es Johannes von Nepomuk, der außerhalb des
Kirchenraums am häufigsten als Heiligenfigur anzutreffen ist. Er gilt
vor allem als Brückenheiliger, wird aber auch sonst gern dargestellt.
Hier ist es allerdings nicht die übliche Plastik mit den fünf Sternen
im Heiligenschein, sondern der Heilige ist von Engeln umgeben und hält
ihnen das Kreuz zur Verehrung hin. Geboren wurde der heilige Johannes
von Nepomuk um 1350 in Pomuk in Südböhmen. Den größten Teil seines
Lebens war er Priester in Prag, und 1393 wurde er von König Wenzel IV.
gefangen genommen, grausam gefoltert und - der Legende nach wegen
seiner standhaften Weigerung, das Beichtgeheimnis preiszugeben - von
der Karlsbrücke in die Moldau gestürzt.

Vom Werden einer Schatzkammer...
Die große und zunehmend unüberschaubare Zahl von Votivgaben, die in der
Nähe des Gnadenbildes niedergelegt wurden, machte es notwendig, eigene
Räume zur Deponierung und zur Aufbewahrung zu schaffen. Dem Stellenwert
der Opfergaben entspricht es, dass sie in einem eigens dafür
eingerichteten und kunstvoll ausgestatteten Raum präsentiert werden.
Wie „funktioniert" Wallfahrt? Votivgaben als Zeichen der Bitte und des Dankes
Der Wallfahrer trifft dabei vielfach aus einer Notsituation heraus mit
dem Heiligen als Fürsprecher vor Gott eine persönliche Abmachung. Die
Gründe dafür sind unterschiedlich und vielfältig. Meistens sind die
Auslöser Krankheit, Kriege, Unfälle, Viehseuchen, Naturkatastrophen
oder Folgen eines Verbrechens. Mit einem Opfer, dessen Größe dem
sozialen Stand und der Lebenssituation des Bittstellers angepasst
werden kann, bittet der Votant um die Beseitigung oder zumindest
Linderung der entsprechenden Not. Um die Bitte zu verdeutlichen,
hinterlässt der Wallfahrer als Zeichen seiner Wertschätzung eine
Votivgabe am Gnadenort. So sind mit den Schatzkammern Räume der
kollektiven sowie der persönlichen Erinnerung entstanden. Sie bewahren
Votivgaben auf, die das ganze Spektrum an Votationsanlässen eines
Einzelnen oder einer Gruppe repräsentieren.

Ziborium - Silber getrieben,
vergoldet, Franz Carl Glockseissen (Meistermarke FCG), Wiener
Beschauzeichen 1751, Wiener Repunzierungszeichen 1806/07 bzw.
Freistempel 1809/10
Durchgehend reiche Rocaille-Ornamentik an Fuß, Cuppa und Deckel. Auf
dem Fuß Darstellungen aus dem Leben des Hl. Benedikt, auf der Cuppa
Fischzug, Predigt Jesu im Tempel, Bergpredigt sowie am Deckel
eucharistische Symbole. Die steigende Pilgerzahl ab der 2. H. 18. Jhs.
machte für die Vielzahl an Kommunionen ein Gefäß mit dementsprechendem
Fassungsvermögen notwendig. Das hier gezeigt Objekt misst eine Höhe von
49 cm und wurde vermutlich für diesen Zweck in Auftrag gegeben.
Kelch - Silber getrieben, vergoldet, Emailmedaillons, Freistempel 1809/10
Sechspässiger Fuß und Cuppa mit reichem Bandlwerk, Engel mit den
Leidenswerkzeugen. Die Emailmedaillons auf dem Fuß und der Cuppa
stellen die wichtigsten Stationen der Leidensgeschichte Christis dar
(Fuß: Abendmahl, Christus am Kreuz, Grablegung; Cuppa: Ölberg,
Dornenkrönung, Kreuzweg). Die Ybbsitzer Bürger und Bauern schenkten den
Kelch Abt Benedikt anlässlich seines Goldenen Priesterjubiläums 1711.

Sonntagberger Monstranz -
Joseph Wilhelm Riedl (Meistermarke IWR), Wiener Beschauzeichen 1762,
Wiener Repunzierungszeichen 1806/07 bzw. Freistempel 1809/10, Silber
vergoldet, mit verschiedenen Edelsteinen besetzt, Fassung der
Edelsteine von Franz Kick
Anders als bei vielen Goldschmiedearbeiten ist die
Entstehungsgeschichte der Sonntagberger Monstranz fast lückenlos
gesichert: 1759 beauftragte der Seitenstettener Abt Dominik Gußmann den
Wiener Goldschmied Joseph Wilhelm Riedl mit der Fertigung der Monstranz
laut vorgelegter Entwurfszeichnung. Der Steinbesatz stammt vom Juwelier
und Goldschmied Franz Kick. Die originale Lunula (sichelförmige
Halterung für die Hostie) wurde gegen ein mit Rubinen besetztes
Exemplar ausgetauscht (Prager Beschauzeichen 1756), das Gräfin Wrbna
aus Prag stiftete.
Das reiche Figurenprogramm der Monstranz thematisiert die Verklärung
Christi auf dem Berg Tabor in Verbindung mit der Heiligen
Dreifaltigkeit. Die Inschrift auf der Rückseite des Fußes weist
zusätzlich auf die entsprechenden Stellen in der Bibel hin (Matth. 17,
1-9, 2 Petrus 1, 18), die von der Verklärung erzählen. Vom Fuße der
Monstranz blicken die Apostel zum verklärten Licht empor. Rechts neben
dem Schaugehäuse steht Elias auf einer Wolkenbank, aus der ein Wagen
mit Feuerrädern fährt. Auf der linken Seite schwebt Moses mit den
Gesetzestafeln, darüber thront die Heilige Dreifaltigkeit. Durch das
Einsetzen der Hostie wird die barocke Komposition vollendet und
versinnbildlicht wie sich das christliche Mysterium mit der
künstlerischen Ausführung zu einer Einheit verbindet.
Der gut dokumentierte Entstehungsprozess der Sonntagberger Monstranz
beinhaltet auch einen Riss (Entwurfszeichnung), der verglichen mit der
Ausführung kaum abweicht. Vor allem in der Barockzeit begannen die
Künstler für die Auftraggeber Risse anzufertigen, die sich in der Folge
zu einer eigenen Kunstgattung entwickelten. Der Autor der Sonntagberger
Risszeichnung ist nicht bekannt. Aufgrund stilistischer Vergleiche mit
gesicherten Werken von Joseph Wilhelm Riedl ist dessen Urheberschaft
eher unwahrscheinlich. Möglicherweise stammen das Figurenprogramm und
der Riss der Monstranz von Pater Joseph Schaukegl, da er unmittelbar am
Entstehungsprozess beteiligt war. So reiste er auch 1760 nach Wien um
mit dem Juwelier Franz Kick den Vertrag für die Fassung der Steine zu
fixieren.

Der Sonntagberg war ab dem 18. Jahrhundert neben Mariazell der
wichtigste Wallfahrtsort der Donaumonarchie. Rund 120.000 Wallfahrer
kamen aus Tschechien, der Slowakei, Ungarn, Deutschland und natürlich
aus Österreich auf den Berg im Mostviertel. Der Sonntagberger
Gnadenstuhl — die Darstellung der Dreifaltigkeit, die Sonntagberger
Fraisensteine, die Türkenquelle und die barocke Basilika ließen
europäische Tradition und Geschichte entstehen.
Neben den Gnadenbildern und liturgischen Geräten wie der barocken
Sonntagberger Monstranz präsentierten die Wallfahrtsorte den Pilgern
Reliquien, die sich zum Teil in der Schatzkammer, aber auch in der
Basilika befanden. Das Wort Reliquie leitet sich vom lateinischen Wort
reliquiae ab und bezeichnet Zurückgelassenes und Übergebliebenes.
Unterschieden werden dabei Reliquien erster Klasse (Körper oder Teile
davon) und Reliquien zweiter Klasse (Gegenstände, mit denen der
Verehrte oder sein Leichnam Kontakt hatte). Reliquien dritter Klasse
spielen vor allem für die Wallfahrt eine große Rolle, da es sich
hierbei um Gegenstände handelt, die mit einer Reliquie erster Klasse in
Berührung gekommen sind und dadurch die Heilkraft des Original
übertragen erhalten. Durch das Küssen oder Berühren von Reliquien
übermittelt der Bittende seine Sorgen und Anliegen an den Heiligen. Um
die immer stärkere Schau- und Berührungsfrömmigkeit der Menschen zu
erfüllen, wurden die Reliquien in eigenen Behältnissen in eine äußerst
kostbare und kunstfertige Ausstattung eingebettet und mit Perlen,
Edelsteinen und teuersten Stoffen verziert.

Entstehung des Gnadenortes und Gnadenbildes
In der sogenannten Ursprungslegende - der überlieferten
Entstehungsgeschichte - wird das Werden des heiligen Ortes erläutert.
Laut Gründungslegende des Sonntagberges verliert ein Hirte seine Herde.
Im Traum sieht er den Platz, an dem sich seine Schafe befinden. Als er
erwacht, liegt auf dem Stein neben ihm ein Laib Brot, und er findet
seine Herde wieder. Sehr bald nach dieser Begebenheit beginnen die
Menschen mit ihren Anliegen zum „Zeichenstein" zu wandern. Über dem
Stein wurde bald darauf eine hölzerne Kapelle errichtet. Die
Reformation ließ den Vorwurf laut werden, man bete am Sonntagberg ein
heidnisches Kultobjekt an. Daraufhin gab Abt Kaspar Plautz 1614 das
Gnadenbild mit einer Darstellung der Dreifaltigkeit in Auftrag. Heute
ist das Gnadenbild in einem prächtigen Silberrahmen über einem Teil des
Steines aufgehängt und wird vom barocken Hochaltar umfangen. Im Rahmen
einer Führung ist es möglich, auf die Rückseite des Hochaltares zu
gelangen um einen exklusiven Blick auf den Zeichenstein zu werfen.

Die Schatzkammer am Sonntagberg: Seit Jahrhunderten bringen Wallfahrer
und Pilger ihre Anliegen, Geschichten und ihren Dank auf den
Sonntagberg. Diese Votivgaben werden hinter dem Hochaltar der barocken
Basilika in der Schatzkammer verwahrt. Der von außen zugängliche
Ausstellungsbereich zeigt in beeindruckender Weise seltene und seltsame
Votivgaben der Pilger, wertvolle Priestergewänder sowie spannende
Einblicke in die Mirakelbücher der Bibliothek.
Viele Votivtafeln erzählen die Geschichte von Unfällen. Die Bandbreite
reicht dabei von Hundebissen bis hin zu Arbeitsunfällen. In den meisten
Verkehrsunfällen bis in das 19. Jh. ist ein Pferd involviert.
Reitunfälle oder Unfälle mit Gespannen standen an der Tagesordnung. Das
schlecht ausgebaute Straßennetz, der Zustand der Straßen und Wege, die
Witterungsbedingungen und die Beschaffenheit der Kutschen begünstigten
die Unfälle. Auch das Überqueren von Flüssen war äußerst gefährlich, da
es nur an den wichtigsten Straßen Brücken gab. Unfälle auf dem Wasser
waren meist für alle Beteiligten tödlich, da nur wenige schwimmen
konnten. Im Zeitalter der Motorisierung berichten Votivtafeln auch
immer wieder von Verkehrsunfällen oder Unfällen mit
Landwirtschaftsmaschinen.

Paramentenraum
Paramente bezeichnen die im Kirchenraum und in der Liturgie verwendeten
Textilien. Gemäß der Definition Papst Benedikts XVI. trägt die
liturgische Kleidung auch eine Botschaft in sich: Sie verweist auf
Grund ihrer hohen symbolischen Bedeutung auf zentrale Inhalte des
christlichen Glaubens. Denn nicht die Person, die die Paramente trägt,
ist wesentlich, sondern die sakramentale Handlung, die sie
stellvertretend für Christus vollzieht. Die Verwendung edler
Materialien und das technische Können bei der Herstellung der Paramente
entsprechen den hohen Anforderungen der Liturgie. Form und Aussehen
änderten sich über die Jahrhunderte hinweg. Die feine und prunkvolle
Ausgestaltung der Oberbekleidung erreichte im Barock ihren Höhepunkt.
Im Zuge der liturgischen Erneuerung im 20. Jh. fand eine Rückbesinnung
auf den ursprünglichen mittelalterlichen Gewandcharakter statt, wodurch
viele der wertvollen historischen Paramente ihre liturgische Funktion
verloren.

Die Vorschriften bezüglich der Verwendung und der Verarbeitung von
Stoffen sowie die Zuordnung der Farben zum liturgischen Jahreskreis
entwickelten sich erst langsam. Bis ins 16. Jh. war es mehr Brauch als
Gesetz, welche Farben verwendet wurden - vielfach war es die Qualität
des Paraments, die den Einsatz bestimmte. Papst Pius V. (1566-1572)
nahm 1570 den römischen Farbkanon unter die allgemeinen Rubriken des
römischen Missales auf. Damit wurde der römische Farbkanon für die
gesamte katholische Kirche verbindlich. Es gab somit die Beschränkung
auf die Farben Weiß, Rot, Grün, Violett und Schwarz. Gelb, Grau, Blau
und bunt kamen nicht mehr vor.
Kasel mit Zubehör, weiß, 1860-1890
Seitenteile Seidendamast mit Vierpassmotiv, Kreuz und Stab
Kreuzstichtechnik in Wolle, gewebte Goldborten, zwei Wappen auf der
Rückseite unten, Baumwollfutter, Originalzustand
Kasel, weiß, 1910-1940
Seitenteile Seidensatin, Stäbe Muste-rung in Tamburiertechnik mit
groben Seidengarnen, ältere geklöppelte Goldborten, Seidentaftfutter,
überarbeitet
Kasel, weiß, 1880-1890
Seitenteile Seidensatin, Stäbe Kreuzstichtechnik in Wolle, gewebte Goldborten, Baumwollfutter, überarbeitet
Kasel mit Zubehör, weiß, um 1870
gesamte Kasel gestickt, Muster in feiner Petit Point Technik mit
Seidengarnen, gewebte Goldborten, Baumwollfutter, Originalzustand

Kardinal Carlo Borromeo (1538-1584) verfasste sein Werk Instructiones
fabricae et supellectilis ecclesiasticae, in dem genaue Angaben über
Form und Ausschmückung liturgischer Gewänder gemacht wurden.
Diese Angaben wurden schließlich auch überregional verbreitet und
verpflichtend, schon bald nach 1600 war es in allen deutschsprachigen
Bistümern im Süden eingeführt. In den letzten Jahrzehnten ging vor
allem das 2. Vatikanische Konzil auf die liturgische Gewandung ein,
außerdem das Messbuch von 1970 und das Zeremoniale für die Bischöfe von
1984.
Kasel mit Zubehör, Ende 18. Jh.
Seidengewebe mit broschierten Blüten, Seitenteile mit Silberfäden im
Grund, Kaselstäbe mit Goldfäden im Grund, Seidentaftfutter,
Überarbeitet - tlw. neue Goldborten, Velum mit originaler
Goldklöppelspitze
Kasel mit Zubehör, Ende 18. Jh.
Seidengewebe mit floraler Musterung und Landschaft, Überarbeitet neue Silberborten und Baumwollfutter, Velum Originalzustand

Die Schatzkammer als eigens eingerichteter und prachtvoll
ausgestatteter Raum sollte den Votivgaben einen würdigen Platz bieten.
Ihre direkte Lage neben der Basilika ist bezeichnend für den
Stellenwert des Raumes und seine Ausstattung im barocken Gesamtkonzept.
Primäre Aufgabe einer Schatzkammerist es nicht, Reichtümer anzuhäufen,
sondern das Geweihte zu bewahren und zur Schau zu stellen, um damit dem
Betrachter bewusst zu machen, mit welcher Hingabe die Menschen Gott
verehrten und wie sehr dieser Gott geholfen hat.
Fiakerkreuz, 1720-1730, Kupferblech versilbert, vergoldet, Steinbesatz
1731 spendeten die Wiener Fiaker dieses Kreuz mit der Darstellung des
Sonntagberger Gnadenstuhles. Bei besonders festlichen Prozessionen wird
es auch heute noch verwendet.

Bischof im Pontifikalornat
Die Einheit von Kasel, Dalmatika, Pluviale und Zubehör in gleicher
Farbe und Ausführung nennt man Ornat (lat. ornatus = Ausrüstung,
Ausstattung, Schmuck), früher auch „Kapelle". Vor allem in der
Barockzeit sind hier umfangreiche Ensembles entstanden, mit denen große
Hochämter mit vielen Beteiligten gefeiert werden konnten.
Mitra, Humerale, Pallium (für den Bischof eine besondere Auszeichnung,
sonst nur dem Papst und Erzbischöfen vorbehalten),
Pontifikalhandschuhe, Kasel, Manipel, Dalmatika, Tunika, Stola, Albe,
Pontifikalschuhe
Die Kasel (lat. casula =
kleines Häuschen) geht auf die antike Paenula zurück. Erst nachdem im
10. Jh. der Chormantel als liturgische Kleidung hinzukam, war die Kasel
als Gewand ausschließlich für die Messe vorgesehen. Im Schnitt wandelte
sich vor allem die Kasel stark die anderen liturgischen Kleidungsstücke
blieben im Wesentlichen gleich. Die Kasel war ursprünglich ein Mantel
nur mit einem Kopfdurchlass, der den Träger ganz umschloss. Sie umgab
ihn wie eine Glockenform, daher wurde sie auch „Glockenkasel" genannt.
Nach dem 13. Jh. wurde der Halbkreisschnitt zu einem
Viertelkreisschnitt. Ab dann wurde diese Armfreiheit immer mehr
vergrößert, bis es im Barock zur sogenannten „Bassgeigenkasel" kam.
Dadurch bekam der Priester mehr Bewegungsfreiheit bei den rituellen
Handlungen (etwa bei der seit dem Mittelalter praktizierten Elevation
der Hostie). Erst im Laufe des 20. Jh.s kehrte die sogenannte „gotische
Form" der Glockenkasel zurück.
Die Dalmatika ist das
Obergewand des Diakons, kann aber auch dem Bischof als Untergewand
unter der Kasel, seit dem 10. Jh. auch unter dem Pluviale, dienen. Ab
dem 15. Jh. sind Quastenbehänge als Zierrat entstanden.
Das Pluviale (lat. pluvia
Regen), auch Vespermantel oder Chormantel, wird seit dem 10. Jh.
außerhalb der Messe in vielen liturgischen Feiern vom Priester getragen
(bei Segnungen, Prozessionen, Begräbnissen etc.). Seine Form leitet
sich vom antiken Pluviale (Regenmantel) ab. Heute ist das liturgische
Pluviale ein beinahe im Halbkreis geschnittener, mantelartiger Umhang,
meist durch eine Schnalle vorne geschlossen. Am Rücken ist es als
„Überbleibsel" der Kapuze mit einer schildförmigen cappa (Kappe)
geschmückt; auch bei der Kasel gab es diesen Besatz bis ins hohe
Mittelalter.
Die Stola (lat. für langes
Gewand der vornehmen Römerin) ist das Abzeichen für Bischöfe, Priester
und Diakone; sie wird um den Hals getragen. Man unterscheidet jene, die
unter der Kasel getragen werden von den sogenannten Außenstolen.
Zu den Paramenten gehört noch der Manipel
(lat. manus Hand, Arm), der ursprünglich von den Diakonen am linken
Unterarm getragen wurde und sich aus dem römischen Etikettetuch
entwickelt hat. Er wurde bis zur liturgischen Reform nach dem 2.
Vatikanischen Konzil (1962-1965) verwendet und ist noch vielfach
erhalten. Der Manipel besteht aus einer Schlaufe und zwei meist
schaufelförmigen Enden.
Das Sakraments- bzw. Segens- oder Schultervelum (lat. velare verhüllen) wird für Prozessionen verwendet. Gleich gestaltet wie die liturgischen Gewänder, gehört es zum Ornat.
Für Privatmessen sowie Messen an gestifteten Altären der Zünfte,
Patrizier oder Bruderschaften wurde auch passende textile Ausstattung
benötigt. Daher muss es schon im Spätmittelalter eine Fülle von
sakralen Textilien gegeben haben. Stilistisch wandelte sich die Kasel
nach und nach. Auf den meist aus profanem Umfeld stammenden Grundstoff
wurden die Besätze appliziert. Diese waren das Schmuckelement mit
theologischem Inhalt. Formal an der Rückseite als Kreuz (lateinisch
oder Gabelkreuz) und vorne als Stab. Die Rückseite wurde zur Schauseite.

Glaubensgegenwart im Alltag
Vor allem im ländlichen Bereich bestimmte der kirchliche Jahresablauf
das Leben der Menschen bis weit in das 20. Jh. Dazu gehörte auch, dass
man das Haus, die Wohnung oder den Hof religiös schmückte. Mit
religiösen Symbolen versehene Gebrauchsgegenstände, Verzierungen an
Häusern und Möbeln, religiöse Andenken und segenspendende Devotionalien
waren ein fester Bestandteil in der häuslichen Umgebung. Religion war
immer und überall präsent: ob im Herrgottswinkel über dem Esstisch oder
in Form des Rituals, auf einem frischen Laib Brot ein Kreuz zu machen,
bevor man es anschnitt. Diese zwei Beispiele zeigen exemplarisch, wie
religiöses Denken im Alltag der Menschen verankert war.

Im Ausstellungsraum wird der Besucher auf die Reise geschickt: Der
Mensch soll sich selbst erkennen zwischen Himmel und Erde, zwischen dem
irdischen und himmlischen Reich. Vielleicht ist ein Ausruhen bei Gott
ein Anreiz zur Wallfahrt, den wir in der hektischen Alltagswelt
dringender denn je brauchen.

SONNTAGBERG
48°0′ nördl. Breite 14°46' östl. Länge, 712m über dem Meeresspiegel
Einwohner: 3.824 (Stand: 1. Jän. 2016)
Namensherleitung: vom Wochentag Sonntag (in der kath. Kirche besonders der Verehrung der Hl. Dreifaltigkeit gewidmet)
WALLFAHRER IN ZAHLEN
um 1700: 70-90 Prozessionen jährl., an hohen Feiertagen
3.000-4.000 Wallfahrer
um 1750: 268 Prozessionen jährlich
1752: 8.000 Kommunionen am Dreifaltigkeitssonntag
1757: Wallfahrtshöhepunkt! 132.000 Kommunionen
um 1830: 97.000 Kommunionen jährlich
1857: 38.000 Wallfahrer
1929: 5.000 Pilger feiern den 200. Kirchweihetag
1941: Wallfahrtstiefpunkt: 9 Prozessionen
1988-1991: 370-390 angemeldete Wallfahrergruppen

Bibliotheken bilden vielfach neben Kirche und Refektorium das Herzstück
im klösterlichen Gemeinschaftsleben. In einer Bibliothek verbinden sich
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Wissens und Erkennens. Eine
Bibliothek ist keine museale Vergangenheitsschau, sondern ein Ort, der
zu verschiedenen Themen Informationen sammelt und systematisiert.
Diesem Motto gemäß sollte die Neuadaptierung des Bibliotheksraumes mit
den alten Bücherkästen einen Ausstellungsraum schaffen, in dem Themen
rund um die Wallfahrt präsentiert werden. Neben schriftlichen
Zeugnissen der Wallfahrtsgeschichte wird auch der große Bereich der
wirtschaftlichen Komponente der Wallfahrt beleuchtet.
Die Bibliothek als Zentrum des Wissens, Lesens und Schreibens soll im
neu ausgestatteten Ausstellungsraum durch Erhaltung der originalen
Bücherkästen das Flair des ehemaligen Bibliotheksraumes vermitteln.
Hier werden neben der wirtschaftlichen und finanziellen Seite der
Wallfahrt die schriftlichen Zeugnisse der Wallfahrtsgeschichte gezeigt.
Einen weiteren wichtigen Bereich für Werbe- und Marketingzwecke
stellten die Devotionalien und Andenken dar, die man vom Sonntagberg
mit nach Hause brachte.

Die wichtigste Quelle der Wundertätigkeit des Gnadenbildes vor Ort
stellt das Mirakelbuch dar. Die darin aufgeführten Mirakel (= Wunder)
geben den Büchern ihren Namen. Die Tradition der Mirakelbücher lässt
sich wie das gesamte Wallfahrtswesen bis in die vorchristliche Zeit
zurückverfolgen. Schon in ägyptischen Tempeln wurden Wundererlebnisse
der Betenden schriftlich für die Nachwelt festgehalten. Im Christentum
setzte sich diese Tradition fort. Die ältesten Mirakelberichte stammen
aus dem 5. Jh. und beinhalten schon das Eintragungsschema, das fortan
Gültigkeit besitzt: Namen und Herkunft des Votanten, Ursache des
Gelöbnisses, Beschreibung des Wunders und Dank dafür.
In den meisten Büchern findet sich darüber hinaus eine Vorrede, in der
die Verehrung des Gnadenbildes gerechtfertigt wird. Weitere
Informationen beziehen sich auf die wunderbare Herkunft des
Gnadenbildes und auf Wunder, die schon früher an diesem Gnadenort
gewirkt wurden. Diesem einführenden Bericht ist oftmals ein Gebetsteil
angefügt. Die Hochblüte erlebte das Mirakelbuch im 17. und 18. Jh., wie
die erhaltenen Bücher am Sonntagberg zeigen. Während die Mirakelbücher
vor allem die gebildeteren und lesekundigen Schichten der Bevölkerung
ansprachen, versuchte man durch das Andachtsbild auch die einfachen
Leute für die Wallfahrt zu gewinnen.
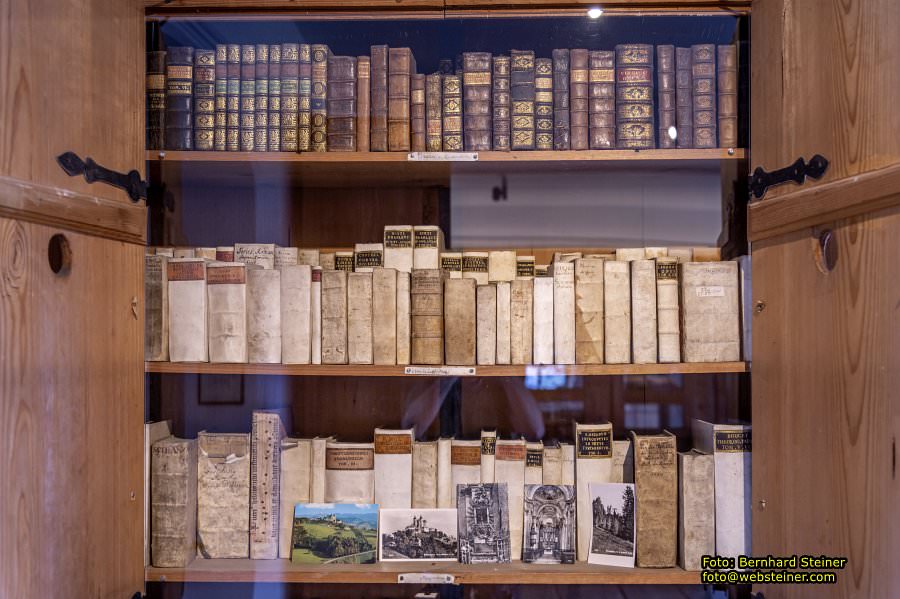
Das Andachtsbild entstand aus dem mittelalterlichen Brauch heraus, für
den rechtlichen Nachweis der Buß- und Sühnewallfahrt ein Pilgerzeichen
als Beglaubigung mit nach Hause zu bringen. Bereits im 14. Jh. gibt es
Hinweise, dass Nonnen miniaturgemalte kleine Andachtsbilder hergestellt
haben. Die Erfindung der Druckgrafik ermöglichte eine neue Dimension
der Verbreitung, da eine viel höhere Auflage hergestellt werden konnte.
So wurden im 17. und 18. Jh. tausende Andachtsbilder gedruckt. Wegen
ihrer weitläufigen Verbreitung erfüllten sie eine wichtige
Werbefunktion. Auch wenn das Grundmotiv der Andachtsbilder über die
Jahrhunderte gleich blieb, sind Unterschiede im Lauf der Zeit in
Material und Technik erkennbar. Im Laufe des 18. Jhs. wurde das
Andachtsbild auch als Heilmittel eingesetzt. Dabei übertrug sich die
Heilkraft des Gnadenbildes durch Berührung auf das Bildchen. Auf kranke
Körperteile gelegt, sollte dieses Linderung verschaffen. Andachtsbilder
wurden auch zur Abhaltung von Unglück, Krankheit und Katastrophen an
der Haustüre oder im Stall angebracht.
Eine Spezialität dieser Wallfahrt sind die Sonntagberger Fraisensteine
(ovale Tafeln aus gebranntem Ton, versehen mit einer reliefartigen
Darstellung des Gnadenstuhles), die vor allem im 18. und 19.
Jahrhundert ausgegeben wurden und als heilkräftig galten.

Was von der Wallfahrt bleibt... Devotionalien - Andachtsbildchen, Talismane, Andenken, Mitbringsel
Nichts ist naheliegender, als dass die Menschen das Heil und die Bitte
um Gebetserhörung, die sie sich am Wallfahrtsort erhofften, auch in
materialisierter Form mit nach Hause nahmen. Die Möglichkeiten an
„Mitbringseln" waren schier unüberschaubar und reichten von
Betpfennigen, Weihemünzen, Rosenkränzen, Wachsstöcken, Gebetbüchern
über Bildchen, Kupferstiche bis hin zu den verschiedensten Kreuzen.
Wegen der starken Nachfrage entstand eine Andenken- und
Devotionalienproduktion, die an den Wallfahrtsorten einen zusätzlichen
Wirtschaftszweig schuf.

Matrikelbuch der Sonntagberger Dreifaltigkeitsbruderschaft
Wolf Nicolaus Thurmann, 1685, Miniatur, Tempera auf Pergament Leihgabe Stiftsarchiv Seitenstetten
Bruderschaften, wie die 1651 am Sonntagberg gegründete, erfüllten im
Wallfahrtswesen eine wichtige Aufgabe, zu der vor allem die
Organisation von Wallfahrten und Prozessionen zählte. Im Matrikelbuch
wurden die Mitglieder nach Jahren geordnet angeführt.
Das Doppelblatt, das ursprünglich aus einem älteren Matrikelbuch der
Bruderschaft stammt, wurde 1707 im Zuge des Besuches von Kaiserinwitwe
Eleonore Magdalene Therese in ein neues Buch eingebunden. Kirchliche
und weltliche Vertreter der Christenheit - darunter als prominenteste
Personen Papst Innozenz XI. sowie Kaiser Leopold I., der Polenkönig
Johann Sobierski und Kurfürst Max Emanuel von Bayern (jeweils mit
Ehefrau) - beten den Sonntagberger Gnadenstuhl, der von Heiligen
umgeben ist, an.

Sonntagberger Fraisensteine
19./20. Jh., Terrakotta, Leihgabe Stiftsarchiv Seitenstetten
Wie der Name - Fraisenstein - schon verrät, versuchte man damit
hauptsächlich die Fraisen (Epilepsie oder Krampfanfälle, die besonders
für Kleinkinder sehr gefährlich waren) zu heilen. Da dem Zeichenstein
eine besondere Heilkraft zugesagt wurde, begann im 18. Jh. die
Produktion der Steine, bei der kleine Teile des Zeichensteines mit Lehm
vermischt in Modeln gegossen und mit dem Dreifaltigkeitssymbol versehen
wurden. In Wasser eingelegte Steine sollten als Trank genossen gegen
Fieberschübe helfen. Aber auch bei zahlreichen anderen Krankheiten
erhoffte man sich Heilung, indem man die Steine auf die erkrankten
Körperteile legte. Bis ins 19. Jh. war in jeder guten Hausapotheke ein
Fraisenstein enthalten.

Breverl - 19./20. Jh., Papier bedruckt und gefaltet
Eine besondere Form des Andachtsbildes waren die sogenannten Breverl:
Die kleinen kissenartigen Gegenstände waren mehrmals gefaltet und
geklappt. Sie wurden wie ein Amulett um den Hals getragen oder in die
Kleidung eingenäht. Erst nach der Segnung konnten sie ihre Wirkung
entfalten. Aber nur ein verschlossenes Breverl besaß eine helfende
Kraft. Geöffnet und auseinandergefaltet zeigte es meist Kupferstiche
mit Heiligendarstellungen oder ein bestimmtes Gnadenbild, das von einer
„geistlichen Hausapotheke" in der Form von Miniaturen wie
Schluckbildchen, Sebastianspfeilen, Nepomukszungen etc. umgeben war.

Hl. Benedikt von Nursia
Diese Darstellung des Heiligen ist eine Nachbildung der 1735
vollendeten Benediktus-Statue des italienischen Bildhauers Pietro Paolo
Campi in Monte Cassino. Der heilige Benedikt ist der Gründer des
Benediktinerordens und der Vater des abendländischen Mönchtums. Der
Stab weist auf seine Abtwürde hin, das Buch auf die benediktinische
Ordensregel ora et labora - bete und arbeite. Der Rabe hat ihn der
Legende nach vor dem Genuß eines vergifteten Brotes bewahrt. Geboren
wurde der heilige Benedikt um 480 in Nursia, gestorben ist er um 547 in
Monte Cassino. Er ist der Patron der Schulkinder und der Lehrer und
wird als Fürbitter um eine gute Sterbestunde angerufen. Papst Paul VI.
proklamierte ihn 1964 zum Patron Europas - im selben Jahr in dem er die
Wallfahrtskirche auf dem Sonntagbe zur Basilika erhob.

Die älteste Kapelle auf dem Sonntagberg wurde im Jahr 1440 errichtet.
Sie unterstand dem Stift Seitenstetten. Bald darauf wurde eine zweite
Kapelle angebaut. Um 1490 entstand eine größere gotische Kirche. Sie
faßte ungefähr 700 Gläubige. Mit der steigenden Bedeutung der Wallfahrt
in der Barockzeit wurde dieses Gotteshaus bald zu klein. So errichtete
man ab 1706 nach den Plänen des Baumeisters der Melker Stiftskirche,
Jakob Prandtauer, eine barocke Kirche. Fertiggebaut wurde sie von Josef
Munggenast, eingeweiht am 28. Juli 1729 vom Passauer Fürstbischof Josef
Dominik Graf von Lamberg. Die Wallfahrtskirche auf dem Sonntagberg gilt
heute als eine der bedeutendsten Schöpfungen der österreichischen
Barockkunst.

Sandsteinbögen - Im 18. und 19.
Jahrhundert hatte die Sandsteingewinnung auf dem Sonntagberg
überregionale Bedeutung. An der Westflanke des Berges befinden sich
noch heute Stollen, in welchen in früheren Zeiten Sandstein für
Schleif- und Wetzsteine gebrochen worden ist. Um 1900 wurde die
Wetzsteinerzeugung auf dem Sonntagberg jedoch völlig eingestellt. Die
Ursache war die Erfindung des künstlich erzeugten Carborundums, aus dem
man die Wetzsteine preislich und qualitativ günstiger herstellen
konnte. Der heimische Sandstein wurde auch schon zum Bau der
Wallfahrtskirche ver-wendet. Bei den hier zu sehenden Sandsteinbögen
wurden die Sandsteine ohne Mörtel mit großer Geschicklichkeit händisch
zu Rundbögen verlegt, die durch ihre gediegene Verarbeitung
beeindrucken.

Der Prandtauer-Brunnen wurde
zur Erinnerung an den Erbauer der Wallfahrtsbasilika 1994 von der
Marktgemeinde Sonntagberg im Rahmen der Dorferneuerung errichtet. Jakob
Prandtauer wurde 1660 in Stanz bei Landeck in Tirol geboren, lebte
später als Baumeister und Architekt in St. Pölten und gilt als einer
der bedeutendsten Kloster - u. Kirchenbaumeister des österreichischen
Barock. Sein Hauptwerk ist das Stift Melk, an der Kirche am Sonntagberg
arbeitete er von 1706 bis 1718. Fertiggestellt wurde der Bau von dem
mit ihm verwandten Josef Munggenast. Jakob Prandtauer starb 1726 in St.
Pölten.

Die barocke Basilika am Sonntagberg zählt zu den markanten Wahrzeichen
des Mostviertels. Ihre Lage ist außergewöhnlich: Von oben reicht der
Blick nahezu übers ganze Mostviertel und weit darüber hinaus. Vom Tal
aus bewundern Besucher und Durchreisende die Kirche schon von weitem.
Der Sonntagberg ist Wallfahrtsort, Ausflugsziel und Ort mit Geschichte.
Schon 1440 wurde hier die erste Kapelle gebaut. Die heutige Basilika
minor stammt von den Barockbaumeistern Jakob Prandtauer und Josef
Mungenast. Der Sonntagberg ist ein außergewöhnlicher Ort: Dem Himmel
näher! Wer die letzten Meter durch das schmale Gässchen zur Basilika
empor steigt, erreicht die Pilgerinformation Sonntagberg. Pilger,
Besucher und Wallfahrer werden dort herzlich willkommen geheißen und
erhalten Auskunft zu Führungen und der Umgebung, können sich bei einer
Tasse Kaffee und den bekannten Mohnzelten stärken oder finden ein
kleines Andenken für zu Hause.

Die Niederösterreichische Eisenstraße
führt durch jene Gebiete im Ybbs- und Erlauftal, die früher durch ein
intensives Kleineisengewerbe geprägt waren. Der alte Begriff
"Eisenwurzen", zuerst nur für die "Wurzel des Eisens", den steirischen
Erzberg, gebräuchlich, ging ab dem 17. Jahrhundert auch auf die
angrenzenden Gebiete der Steiermark, Nieder- und Oberösterreichs über.
Südlich von hier schließen sich hinter den Ybbstaler Alpen das
Innerberger (= Eisenerzer) und das Vordernberger Bergbaurevier an. Im
westlich benachbarten Oberösterreich reicht die Eisenwurzen über die
Enns bis ins Steyr- und Almtal. Seit dem 15. Jahrhundert genoß diese
Region als kaiserliches "Kammergut" die besondere Förderung des
Staates. Seine einstige wirtschaftliche Bedeutung drückt sich bis heute
in der ersten Strophe unserer Bundeshymne aus.
In Waidhofen lebten schon um 1300 zahlreiche Klingen- und
Messerschmiede sowie Schleifer. Vom 14. bis zum 16. Jahrhundert blühte
das Eisenhandwerk auf. Die Hammerherren, die "Schwarzen Grafen",
erhielten große Bedeutung - sie wirkten neben den Kaufleuten sogar in
der Stadtverwaltung mit. Um 1500 bestanden allein in Waidhofen und
seinen Vororten etwa 290 Betriebe des Kleineisengewerbes. Das "eiserne
Gewerbe" entwickelte sich jedoch nicht nur an Ybbs und Erlauf, sondern
vor allem auch an zahlreichen kleinen Bächen in der
Eisenstraßen-Region. Während der Gegenreformation wanderten viele
Schmiede vor allem in die süddeutschen Reichsstädte ab. Waidhofen
konnte die damals verlorene wirtschaftliche Bedeutung nie wieder ganz
zurückerlangen. Dafür entstand im 19. Jahrhundert Großindustrie am Fuße
des Sonntagberges.

Bergfriedhof - Der nach der
Errichtung der Pfarre Sonntagberg (1783) angelegte Friedhof
(Benediktion 1785) ist einer der höchstgelegenen Bergfriedhöfe
Niederösterreichs. Er hat seinen ursprünglichen Charakter als Friedhof
der überwiegend bäuerlichen Bevölkerung weitgehend erhalten und ist mit
seinen schlichten Kreuzen und gepflegten Gräbern ein wunderschön
gelegener Ort der Beschaulichkeit und Besinnung.

Die Türkenbrunnenkapelle und die Quelle
Der Sonntagberg als großer Kraft- und Wallfahrtsort verfügt auch über
besonders segensreiche und kraftspendende Plätze. Neben dem
Zeichenstein in der Basilika zählt besonders die Quelle bei der
Türkenbrunnenkapelle dazu. Seit jeher holen Menschen von ihr das
Wasser, Besonders die Heilung von Augenleiden wird der Quelle
zugesprochen. Die barocke Kapelle aus dem Jahr 1745 ist üppig mit
Muscheln und Skulpturen ausgestattet und liegt östlich der Basilika
idyllisch auf einer Waldlichtung, nur einen kurzen Spaziergang entfernt.
Die nordöstlich der Wallfahrtskirche in einem Waldstück gelegene
Brunnenkapelle erinnert an das sagenhafte Rosswunder des Jahres 1529.
Hier sollen die Pferde der türkischen Heerschar, die den Sonntagberg
erstürmen wollte, ihren Herren den Dienst verweigert und ihre Knie
gebeugt haben. Den kurz danach errichteten Bildstock ersetzte man 1677
durch eine Kapelle, an deren Stelle 1745 der heutige Bau entstand. Der
gebänderte, mit Pilastern belegte Rechteckbau wird von einer Skulptur
des Erzengels Michael von Peter Widerin bekrönt, von dem auch die
Madonnenfigur vor der Kapelle stammt. Der als künstliche Grotte
ausgestaltete Innenraum birgt eine plastische Darstellung des
Sonntagberger Gnadenbildes aus der 1. Hälfte des 18. Jh.s, das von
Engeln und den hll. Petrus und Hieronymus flankiert wird. Das
Stirnwandfresko von Franz Josef Wiedon aus dem Jahre 1748 schildert das
Rosswunder.

Sandsteinbruch - Zur Errichtung
des Panoramaweges wurden große Mengen heimischen Sandsteins benötigt.
Für dieses Vorhaben wurde dieser Sandsteinbruch geöffnet, wo nun der
früher weithin bekannte Sonntagberger Sandstein wieder gewonnen werden
kann. Solche Sandsteinbrüche gab es bis um 1900 bei einer Reihe von
Höfen am Sonntagberg. Die Gewinnung des Sandsteins und dessen
Verarbeitung zu Wetz- und Schleifsteinen war seinerzeit für die Bauern
ein willkommener Nebenerwerb. Bei der Grundsteinlegung für das
Regierungsviertel in der Landeshauptstadt St. Pölten wurde 1992 als
Beitrag des Mostviertels Sonntagberger Sandstein aus diesem Steinbruch
verwendet.

Der 714 Meter hohe Sonntagberg dürfte vor 1250 gerodet worden sein.
Damals hieß der Höhenrücken noch "Ruznik". Dieser Name geht auf das
slawische Wort "ruda" (= Erz) zurück und weist auf das Vorkommen von
Sumpfeisen hin. Der Sonntagberg erhebt sich zwischen dem Alpenvorland
und den Kalkalpen. Bei gutem Wetter genießt man hier eine prächtige
Fernsicht über beide Gebiete, die für die Entwicklung der
Eisenstraßen-Region von besonderer Bedeutung waren: Im Süden boten Wald
und Wildwasser die nötigen Energiequellen für die Eisenverarbeitung;
aus dem fruchtbaren Norden kamen die Lebensmittel zur Versorgung der
Bergknappen und Hammerschmiede in der historischen "Eisenwurzen".

Wem der viele Text zu lange war und lieber Bewegtbilder mit Musik mag,
kann sich gerne dieses Video antun: