web steiner
Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen
Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.
+43/2624/54014 - office@websteiner.com
Berndorfer Stilklassen
Berndorf/Triesting, September 2023
Von 1908 bis 1909 wurden von der Stadtgemeinde Berndorf zwei Volks- und Bürgerschulen errichtet. Die Innenausstattung, die wohl weltweit einzigartig ist, ließ Arthur Krupp auf eigene Kosten gestalten. Er gab die verschiedenen Stilrichtungen vor, die es zu entdecken gilt.

Zu Zeiten von Arthur Krupp beherbergte die heutige Neue Mittelschule
die Bubenklassen und die jetzige Volksschule die Mädchenklassen. Die
Innen-Einrichtung wurde für beide Schulen gleich gemacht, allerdings
gibt es in manchen Klassen feine Unterschiede: So wurde das
Barockzimmer bei den Buben mit Fresken der Wissenschaft verziert, bei
den Mädchen hingegen mit den Schönheiten und Künsten der 4
Jahreszeiten...

Dorisches Lehrzimmer - Epoche: 600 - 338 v.Chr.
Die dorische Ordnung mit den Grundelementen Sockel, Säule und Gebälk
fand ihre Anfänge in Griechenland und war insbesondere auf der Insel
Rhodos sehr verbreitet.
Die Besucher erwartet eine Balkendecke mit vertieften Feldern
(Kassetten), in denen die Sonne Griechenlands vom ewig blauen Himmel
strahlt. Die Bemalung der Wände und die vertieften Fugen sollen
aufeinandergelegte Steinquader vortäuschen. Die Bronzetüre ist eine
Nachbildung des Tores am Turm zu Mykenä. Der Kasten, die Stirnseite der
vorderen Bänke, Lehrertisch und Lehrersessel zeigen überall die
dorische Säule.



Byzantinisches Lehrzimmer - Epoche: 500 - 840 n.Chr.
Die byzantinische Architektur ist im Wesentlichen eine
Fortsetzung der römischen Architektur, die Einflüsse aus dem Nahen
Osten aufnahm. Bei den Baumaterialien wurden vermehrt Ziegel verwendet,
ein zentrales Element wurden Mosaike.
Die Besucher erwartet eine reichbemalte Balkendecke mit teilweise
dreidimensional hervortretenden Schmuckformen, von Tragsteinen
(Konsolen) getragen. Die Türumrahmung ist überwölbt von einem
halbkreisförmigen Feld (Tympanon) mit dem byzantinischen (oströmischen)
Kreuz und üppiger Bemalung. Als Vorbild diente Arthur Krupp die
Sergiuskirche in Konstantinopel.



Ägyptisches Lehrzimmer - Epoche: 2500 - 1260 v.Chr.
Ägypten war für Arthur Krupp eine prägende Epoche für Wissenschaft und
Fortschritt. Die Besucher erwartet eine reich bemalte Balkendecke mit
vertieften Feldern, in denen der dem Sonnengott geheiligte Mistkäfer
(Skarabäus) mit der roten Sonnenscheibe erscheint. Unterhalb der Decke
ziert eine um den ganzen Raum laufende Malerei (Fries) das
Klassenzimmer. Sie stellt Bilder aus dem Volksleben dar. Die Tür ist
eine getreue Nachahmung der Scheintüre in der Grabkammer zu Eimisi in
Denderah in Oberägypten.



Pompejische Lehrzimmer - Epoche: 100 - 49 n. Chr.
Mit dem pompejanischen Stil brachte Arthur Krupp den Kindern die
weitverbreitesten Wandmalereien der Welt näher. Durch den Ascheregen
beim Ausbruch des Vesuv 79 n. Chr., der die römische Stadt Pompej
völlig zerstörte, wurden viele Kunstwerke konserviert und konnten als
Vorlage dienen.
Die Decke ist völlig flach und zeigt Gemälde von Tieren, Blumen und
Dekorationen. Die Wände des Klassenzimmers sind im berühmten
pompe-janischen Rot gehalten.




Maurisches Lehrzimmer - Epoche: 786 - 1492 n.Chr.
Der maurische Baustil und seine typischen Stil-Elemente diente späteren
Baumeistern und auch Arthur Krupp als Inspirationsquelle. Besonders die
Dekorelemente wie Flechtbänder, Rauten, Sechsecke, Sterne etc., die zu
unendlich scheinenden Mustern verbunden wurden, ließen wahre
Meisterwerke entstehen.
Die Decke ist eine Nachahmung der alten maurischen Holzdecke in der
Universitätskirche zu Alkala de Heinares in Spanien. Das Portal ist
eine Kopie des "Goldenen Tores" (Porta aurea) in Cordoba und besteht
aus vier freistehenden Marmorsäulen, deren obere Enden (Kapitäle)
farbenprächtig geschmückt sind (Vorbilder in der Alhambra).




Rokoko - Epoche: 1715 - 1774 n.Chr.
Mit dem Rokoko wollte Arthur Krupp das Lebensgefühl der Franzosen
veranschaulichen - eine heitere, leichte Architektur, mit eleganten und
verspielten Details. Sie entwickelte sich aus dem Spätbarock, der Name
stammt von dem französischen Wort Rocaille (‚Grotten- und Muschelwerk‘).
Dieser Raum befindet sich nur in der Mädchenschule und diente als
Handarbeitssaal. Die Decke zeichnet sich durch die heitere, kühn
geschwungene und freie Linienführung des Rankwerkes aus, die in weiß
mit dezenter Vergoldung gehalten ist. Die Türumrahmung ist damit in
Einklang gebracht und ist eine Nachbildung der charakteristischen
Türumrahmung der Presbyteriumtür in der Pfarrkirche Mariabrunn bei Wien.



Berndorfer Stilklassen
„Kunst und Kunstgefühl sollen bereits
im Kinde geweckt, das Auge an das Schöne gewöhnt, der Geschmack an den
reinsten Formen der Kunst aller Zeiten gebildet werden.“
Aus der Festschrift vom 11. 12.1909 zur Eröffnung der Schulen, Arthur Krupp

Stil Ludwig XIV - Epoche: 1643 - 1715 n.Chr.
Der Stil Ludwig XIV. zeichnet sich durch den Triumph des Klassizismus
aus. Ebenso wie in der Malerei und der Bildhauerei, beides Künste,
denen der Sonnenkönig mit der Gründung der Kunstakademie seine eigene
Prägung verlieh, wünscht der Monarch einen von seiner Herrschaft
gezeichneten Dekorationsstil.
Im Klassenzimmer zeigt Arthur Krupp dem Rokokostil verwandte Formen.
Als Vorbild für die Ausstattung dieses Raumes diente das Lustschloss in
Versailles. Zu beachten auch die schönen, fein geschnitzten
Verzierungen an der Türe.


Barockes Lehrzimmer - Epoche: 1580 - 1780 n.Chr
Als Kunstform ist der Barock durch üppige Prachtentfaltung
gekennzeichnet. Von Italien ausgehend, verbreitete er sich zunächst in
den katholischen Ländern Europas, bevor er sich in abgewandelter Form
auch in protestantischen Gegenden durchsetzte.
Wir befinden uns jetzt im Schloss des Prinzen Eugen in Wien, dem
bekannten Belvedere (Erbauer Lukas von Hildebrand). Anmutig geschmückte
senkrechte Mauerstreifen (Lisenen) teilen die Wandflächen harmonisch
ab. Die Umrahmung der Türe hat ihr Vorbild in den Türen des Belvederes.
Die Türe selbst zeigt eine Einlegearbeit in Wurzelholz, ebenfalls in
barocker Zeichnung gehalten.



Empire - Epoche: 1804 - 1814 n.Chr.
Der Empirestil hatte vor allem Repräsentation und Dekoration zum Ziel.
Geradlinigkeit, Strenge und Feierlichkeit sollten Größe und Macht
veranschaulichen.
Das Palais Modena in Wien gab die Vorbilder zu der Ausstattung dieses
Raumes. Beachtenswert ist die zarte, zurückhaltende und wohlabgestimmte
Tönung der Decke und der Wände.


Gotisches Lehrzimmer - Epoche 1180 - 1460 n.Chr.
Die Gotik ist eine Epoche der europäischen Architektur und Kunst des
Mittelalters, der Verbildlichung der christlichen Ideenwelt. Sie
bediente sich dabei in großem Umfang der Symbolik und Allegorie.
Herausragende Kunstschöpfung ist die gotische Kathedrale, die als
Gesamtkunstwerk Architektur, Plastik und Malerei des Mittelalters
vereint.
Diesem Lehrzimmer hat Arthur Krupp eine Balkendecke in Tiroler Gotik
gegeben, mit Kerbschnitt und Tiroler Schnitztechnik und reich bemalt.
Die Türumrahmung ist nach den Vorbildern aus Steinakirchen in
Niederösterreich und Pettau (Jugoslawien).



Ausblick vom Gotischen Lehrzimmer auf die Katholische Kirche Berndorf - St. Margareta

Das spitzbogige Feld oberhalb der Türe zeigt drei Engel, die das Stadtwappen von Berndorf, den Bären, halten.

Romanisches Lehrzimmer - Epoche: 1050 - 1250 n.Chr.
Seit dem Ende der Antike gilt die Romanik als erste große europäische
Kunstepoche, einer der Gründe, warum Arthur Krupp dieser Stilrichtung
ein Lehrzimmer widmete. Als „typische“ Erkennungsmerkmale romanischer
Bauten gelten Rundbögen, Rundbogenfenster, Säulen mit blockartigen
Kapitellen und Wände mit betont wuchtigen Steinmassen.
Die säulengeschmückte Türe ist eine Nachbildung der Seitenportale der
Schlosskirche in Trebitsch, Mähren. Die Eichentüre ist geschmückt mit
romanischen, schmiedeeisernen Türbändern und ebensolchem Türklopfer mit
Löwenkopf.





Römisches Renaissance - Epoche: 1461 - 1580 n.Chr.
Das Wort „Renaissance“ stammt vom italienischen Ausdruck „la rinascita“
für „die Wiedergeburt“. Die Studien der römischen Bauwerke führten zur
Einbeziehung und Übernahme der altrömischen Vorbilder wie der
Säulenordnung, der Ornamentik und weiterer Details. Eine wichtige
Kunstepoche, die Arthur Krupp den Kindern näher bringen wollte.
Das Lehrzimmer hat eine in Weiß, Blau und Goldgelb gehaltene Decke mit
vieleckigen (polygonalen) und vertieften Feldern (Kassetten), so wie
man sie im Palazzo Massimi von Baldassare Peruzi in Rom vorfindet. Die
Türumrahmung ist die Nachbildung eines Seitenaltares im Dome zu
Fünfkirchen (Ungarn), der von König Bela IV. im 13. Jahrhundert von
Italien aus dorthin gebracht wurde. In der Türe sind kunstvolle
eingelegte Holzarbeiten (Intarsien), nachgeahmt jenen der Certosa
(Karthäuserkloster) von Pavia.




Bei den Berndorfer Schulen handelt es sich um eine Volks- und eine
Hauptschule in der niederösterreichischen Stadt Berndorf, in der sich
die sog. Berndorfer Stilklassen befinden. Zur Erbauungszeit waren sie
als Bubenschule (heutige Hauptschule) und als Mädchenschule (heutige
Volksschule) gedacht.
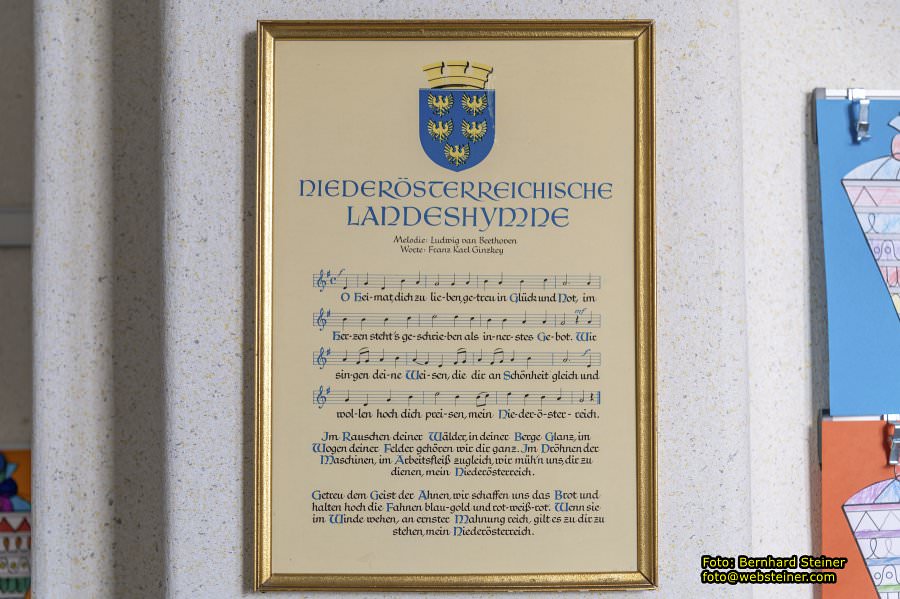
In den Jahren 1908-1909 wurden von der Stadtgemeinde Berndorf neben der
Margaretenkirche zwei Schulen - eine für Mädchen und eine für Buben -
errichtet. Die Innenausstattung ist weltweit einzigartig und
wurde von Arthur Krupp gestaltet und finanziert. Jedes der
Klassenzimmer wurde in einem anderen historischen Baustil ausgestattet.
Arthur Krupp wollte auf diese Weise den Kindern seiner Belegschaft die
Welt und ihre Geschichte zeigen. Die Schulen wurden damals auch mit
weitgehenden, gesundheitlichen Einrichtungen bedacht. Arthur Krupp
schuf die erste Schulzahnklinik in der damaligen
österreichisch-ungarischen Monarchie und machte sie allen Schülern
kostenlos zugängig.

Das Besondere an den beiden Schulen ist die Gestaltung und Einrichtung
in verschiedenen kunsthistorischen Stilen. Sie wurden nach zweijähriger
Bauzeit im Jahr 1909 eröffnet. Die Finanzierung erfolgte durch Arthur
Krupp. Die architektonische Beratung des Gesamtprojektes übernahm der
Architekt Ludwig Baumann. Den Auftrag für den Bau der Schulen bekam Max
Hegele. Die Dekoration wurde durch die beiden Maler Franz Wilhelm
Ladewig und Robert Jüttner ausgeführt. Krupp wollte damit den
Arbeiterkindern geschichtliches Wissen anschaulich vermitteln.

In jeder der beiden Schulen gibt es elf Lehrzimmer, die bestimmten
Baustilen nachempfunden sind, in der Volksschule darüber hinaus noch
ein zwölftes. Die Baustile sind auch in großen Lettern in den
jeweiligen Räumen zu lesen. Ursprünglich gehörten zu jedem Lehrzimmer
auch Schülerbänke, ein Lehrertisch und ein Schrank im gleichen Stil,
die jedoch nicht mehr alle in Verwendung sind. Die beiden Schulgebäude
stehen symmetrisch zu beiden Seiten der ebenfalls von Krupp
finanzierten Margaretenkirche, und auch die Stilklassen sind in jeder
Schule mehr oder weniger gleich. Kleinere Unterschiede findet man z. B.
in der Lage der Tür oder etwa darin, dass beim Ägyptischen Zimmer den
Buben kriegerische Motive zugemutet wurden, während die Mädchen Feld-
und Hausarbeiten zu sehen bekamen.

Krupp sorgte dafür, dass in der Schule eine Zentralheizung eingebaut
wurde. Außerdem gab es Duschen für die Kinder – zur Erbauungszeit ein
ungeheurer Luxus, über den die Arbeiterbevölkerung des Ortes in ihren
Häusern nicht verfügte. Außerdem sorgte Krupp für das, was man heute
schulärztliche Betreuung nennen würde: In der Mädchenschule gab es
einen von Krupp bezahlten Zahnarzt, der regelmäßig die Zähne der
Schülerinnen inspizierte und gegebenenfalls auch reparierte.
Heute sind die Schulen neben dem Unterricht nach wie vor eine
touristische Attraktion, die in unterrichtsfreien Zeiten besichtigt
werden kann. Da sie in erster Linie dem Gebrauch dienen, können die
Schulen frei über die Inneneinrichtung verfügen. Insbesondere in der
Volksschule ist statt der originalen Einrichtung oder zusätzlich dazu
modernes Mobiliar aufgestellt; auch wurden 2008 die originalen,
dezenten Lampen durch große moderne Beleuchtungskörper ersetzt.

Wem der viele Text zu lange war und lieber Bewegtbilder mit Musik mag,
kann sich gerne dieses Video antun: