web steiner
Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen
Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.
+43/2624/54014 - office@websteiner.com
Drosendorf
im Bezirk Horn, Niederösterreich, Mai 2023
Drosendorf-Zissersdorf ist eine Stadtgemeinde im
Bezirk Horn, liegt an der Thaya im nördlichen Waldviertel in
Niederösterreich und damit an der Grenze zu Tschechien. Im Juli 1278
widerstand die Stadt 16 Tage lang der Belagerung durch den böhmischen
König Ottokar II., der damit wertvolle Zeit verlor, währenddessen sich
sein Kontrahent Rudolf I. gut auf die Schlacht bei Dürnkrut und
Jedenspeigen vorbereiten konnte. Drosendorf zählt zu den wenigen österreichischen Städte, die noch von einer vollständig erhaltenen Stadtmauer umgeben sind. Und außerdem ist dort die Endstation vom Reblaus-Express, der Lokalbahn Retz–Drosendorf der NÖVOG.

Die 1,7 km lange Stadtmauer der Stadtbefestigung Drosendorf umfasst die
ganze Altstadt von Drosendorf, die sich auf einem Bergstock in einer
Thayaschleife befindet. In der Mauer befanden sich zwei Stadttore, das
Horner Tor und das Raabser Tor, wovon das Raabser Tor noch erhalten
ist. Die Mauer bindet auch die ehemalige Burg, das Schloss Drosendorf,
mit ein. Auf der Terrasse der Mauern führt heute ein Themenwanderweg
rund um die Stadt.

Links des Horner Tores, dem südlichen Stadttor von Drosendorf, steht an
der Stadtmauer auf einem Granitquader der sogenannte Wappenstein von
Drosendorf. Der scheibenförmige Stein besteht aus Zogelsdorfer
Kalksandstein und zeigt außen noch Ansätze von Kreuzrippen. Aus der
erhabenen profilierten Umrahmung des Steins lösen sich nach innen drei
profilierte Bögen in Halbkreisform (Maßwerk), die ein Wappenschild
umrahmen bzw. halten: ein einfacher Bogen oben, zwei weitere im Winkel
von ca. 120 Grad dazu im unteren Drittel des Steins. Diese beiden Bögen
sind spiegelgleich angelegt und laufen mit dem oberen Bogenteil in das
Wappenschild hinein, um in spitzem Winkel zurück zum Rand und wieder
zum Schild zu laufen. Diese Maßwerkteile erinnert ein wenig an die
Ziffer 3.
Der Wappenstein war ursprünglich einer der gotischen Schlusssteine der
Altstadtkirche von Drosendorf, die Ansatzstellen von acht Kreuzrippen
sind heute noch erkennbar. Die Altstadtkirche wurde im 30jährigen Krieg
1620 und 1648 verwüstet und danach im barocken Stil wieder aufgebaut.
Der Schlussstein mit dem Stadtwappen wurde zuerst bei der Richtstätte
an der Friedhofsmauer eingemauert, wechselte 1959 in das
Freilichtmuseum und steht seit den1980er Jahren beim Horner Tor.
Frühe Darstellung des Stadtwappens (gotischer Schlußstein aus der Altstadtkirche)

Oberes Torwartlhaus - Wohnhaus des Torwächters (bis etwa 1840)

Das Bürgerspital wurde 1536 von Johann Mrakes von Noskau für zehn
hausarme, fromme Leute, fünf Männer und fünf Frauen, gestiftet. Die
Stiftung war reich mit Feldern, Wäldern, einer Mühle und zwei Dörfern
ausgestattet und bestand in der vom Stifter bedachten Weise bis in das
20. Jahrhundert. Heute wird das Stiftungsgut von der Gemeinde
verwaltet. Der Ertrag der Stiftung wird an das Altersheim in Horn
abgegeben, also immer noch zweckgebunden verwendet. Ein Teil des
leerstehenden Spitalgebäudes wurde dem um Drosendorf sehr verdienten
Heimatforscher Ingenieur Franz Kießling zur Verfügung gestellt. Dieser
richtete hier 1925 das nach ihm benannte Drosendorfer Heimatmuseum ein.
Gegenwärtig wird das Museum neu eingerichtet.
1981-82 wurde das gesamte Gebäude renoviert. In der Spitalskapelle war
eine Galerie untergebracht. In den Jahren 2005 bis 2007 wurden mithilfe
der Dorf- und Stadterneuerung Seminarräume eingerichtet. Auch
Hochzeiten, Ausstellungen und andere Veranstaltungen können hier
abgehalten werden. Eine schwarze Kuchel wurde zugänglich gemacht.
Weiters wurde die Infrastruktur im ganzen Gebäude erneuert, das Dach
neu gedeckt und der Hof gepflastert. Damals wurde der barocke Hochaltar
aus der Kapelle in die Wallfahrtskirche Maria Schnee gebracht. Diese
Kirche steht an der Straße nach Zissersdorf in einem kleinen Wald und
gehört auch zur Spitalsstiftung.

Stefan von Maisau konnte 1278 die Stadt gegen das Heer des
Böhmenkönigs Ottokar II. Přemysl 16 Tage lang verteidigen. So konnte
Rudolf von Habsburg sein Heer bei Dürmkrut sammeln und formieren.
Ottokar verlor die Schlacht und auch das Leben. Die Habsburger
regierten fortan mehr als 600 Jahre in Österreich. Drosendorf bekam für
diese Hilfe verschiedene Privilegien, zum Beispiel das Recht, den
Doppeladler im Wappen zu führen.
Barbara von Nikomedien ist eine populäre christliche Heilige. Der
Überlieferung zufolge war sie eine christliche Jungfrau, Märtyrerin des
3. Jahrhunderts. Sie wurde demnach von ihrem Vater Dioscuros
enthauptet, weil sie sich weigerte, ihren christlichen Glauben und ihre
jungfräuliche Hingabe an Gott aufzugeben. Die heilige Barbara zählt zu
den Vierzehn Nothelfern und ist Schutzpatronin der Artillerie und der
Bergleute.
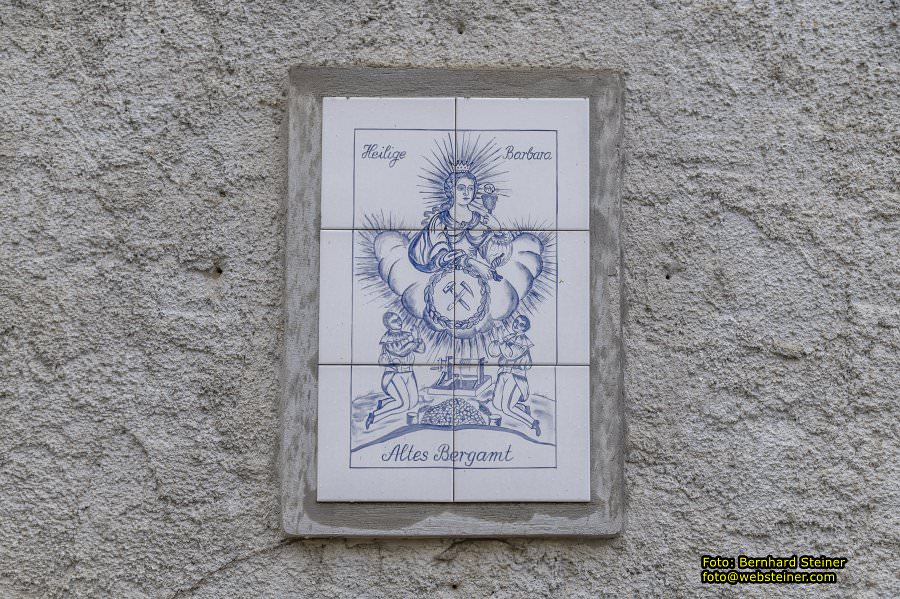
Etwa in der Mitte der Bürgerspitalgasse, direkt hinter dem Rathaus steht das Bürgerspital mit der Spitalskapelle.
Es wurde 1536 von Johann Mrakesch von Noskau (er war auch Herr von
Litschau) für "Zehen Haußarm fromb Leuth" gestiftet. Die Stiftung war
reich an Wäldern, Feldern, einer Mühle und zwei Dörfern versehen und
bestand in der vom Stifter gedachten Weise bis etwas zur
Jahrhundertwende. Ein Teil des nun leerstehenden Gebäudes wurde später
dem um Drosendorf sehr verdienten Heimatforscher Ing. Franz Kiesling
zur Verfügung gestellt. Dieser richtete hier 1925 das nach ihm benannte
Drosendorfer Heimatmuseum ein.
Bürgerspital, gestiftet von Johann Mrakesch v. Noskau im Jahre 1536 für
10 verarmte Bürger. Die Kapelle war der heiligen Dreifaltigkeit geweiht.

Zum Dank dafür, dass Drosendorf von der Pest verschont geblieben ist, wurde 1714 am Hauptplatz die barocke Pestsäule
errichtet. Sie zeigt die drei Pestheiligen Rochus, Sebastian sowie den
Brückenheiligen Johannes Nepomuk. Auf dem Sockel befindet sich ein
Relief der Heiligen Rosalia, ebenfalls eine Pestheilige. Darüber die
Madonna und die Dreifaltigkeit. Die Inschrift auf dem Sockel enthält
ein sogenanntes Chronogramm, das heißt, die Großbuchstaben ergeben,
wenn man sie als römische Ziffern liest, das Jahr der Errichtung 1714.
Dreifaltigkeitssäule - Pestsäule im barocken Stil erbaut durch die Herrschaft und Stadt Drosendorf 1714

Im Rathaus ist heute das
Gemeindeamt untergebracht. 1542 wurde es vom Rat dem Besitzer der
Hofmühle abgekauft. Das Dach trug einen Glockenturm, mit dessen Geläute
die Ratsherren zu den Sitzungen gerufen wurden. Er verbrannte beim
großen Brand 1846. 1933 wurde die Fassade von dem akademischen Maler
August Hoffmann aus Wien mit Sgraffitomalerei versehen (restauriert
1982 und 2008).
Die Abbildungen zwischen den Fenstern des 1. Stockes zeigen
- Stefan von Maissau (Verteidiger gegen Ottokars Herr 1278)
- Bildnis des Hl. Martin, Schutzpatron der Stadtkirchen
- Ehrentafel für viele ungenannt gebliebene Bürger, die der Stadt im Lauf der Jahrhunderte gedient haben.
- Oswald von Eitzing, 1453, der sich bei der Errichtung der Martinskirche große Verdienste erwarb.
Rechts und links vom Tor sind der Stadtschreiber und der Nachtwächter
abgebildet, über dem Tor das Stadtwappen mit dem Doppeladler (1560). In
der Einfahrt des Rathauses sind die Modelle der Ruine Kollmitz und des
Schlosses Frain (Vranov) zu sehen. Das sind maßgetreue Anfertigungen
vom Drosendorfer Spenglermeister Suchy in der 30iger Jahren.

Das "Bergamtshaus" mit den
beiden Ecktürmen liegt rechts neben dem Rathaus. Es soll früher dem
Besitzer eines Alaunbergwerkes gehört haben. Eine Sage erzählt, dass
sich in Notzeiten oder wenn Gefahr droht, in dem Haus eine "weiße Frau"
zeigt. Das Haus befindet sich im Privatbesitz. Wo genau dieses
Alauenbergwerk war, ist nicht bekannt. Alauenstein war in der Medizin
als Blutstiller begehrt und daher wertvoll. 1846 gab es einen großen
Stadtbrand in Drosendorf. Damals brannte die gesamte Stadt ab bis auf
sieben Häuser, die bereits mit Tonziegeln gedeckt waren. Der
fürchterliche Brand war übrigens im Hinterhof dieses Hauses, in dem
sich eine Seifensiederei befand, ausgebrochen. Mit dem Haus ist die
Sage von der weißen Frau verbunden. Diese Gestalt erscheint in
Notzeiten oder wenn Gefahr droht.
Bergamtshaus - Patrizierhaus aus dem Jahre 1576. Es gehörte dem Besitzer eines Alaun-Bergwerkes.

Die Prangersäule, das Wahrzeichen der Gerichtsbarkeit und des
Marktrechts. Sie wurde um 1500 erbaut und ist eine der höchsten noch
bestehenden Säulen (8,30 m). Der untere Teil zeigt gotische Kielbögen.
Der obere Teil mit dem steinernen Mann wurde 1616 neu angefertigt, da
die alte Figur von einem großen Sturmwind heruntergeworfen worden war.
Der Ritter hielt ein Schwert im Arm. Das war das Zeichen der
Blutgerichtsbarkeit. Das heißt, der Stadtrichter hatte das Recht, auch
Todesurteile zu verhängen.
Der Arm mit dem Schwert brach später ab, sodass an Markttagen ein
Ersatzschwert an einer langen Stange an den Pranger gelehnt wurde. Das
Schwert sollte ja als Zeichen der Gerichtsbarkeit sichtbar sein. Im
Jahr 2000 wurde der Pranger renoviert. Der Ritter bekam ein neues
Schwert, auf das er sich nun stützt. Die an der Säule befestigte
Steinkugel ist ca. 40 kg schwer. Das ist ein sogenannter Parkstein. Für
kleinere Vergehen musste dieser Stein vom Rathaustor über die damals
unbepflanzte Angerwiese zum Pranger getragen werden. Für jedes Mal
Absetzen musste Bußgeld bezahlt werden. Mit der Prangersäule sind viele
Bräuche verbunden. Man machte Maissteige in der Walburgisnacht,
Brautpaare gingen nach der kirchlichen Trauung dreimal um den Pranger
herum, als Zeichen der staatlichen Anerkennung der Ehe.
Rolandsäule "Pranger" - Sittenlose Weiber und trunksüchtige Männer wurden hier angeprangert.

Der Stadtbrunnen befindet sich
im Stadtpark. Er ist 52,5 Meter tief in den Felsen gebaut. Es stand ein
Brunnenhaus darüber und das Wasser wurde mit Hilfe eines Rades
heraufgeschöpft. Der Drehbrunnen war bist Mitte der Zwanzigerjahre in
Betrieb. Der Brunnenrand wurde 1985 neu aufgemauert. Der über 50 Meter
tiefe Brunnen wurde von Bauleuten aus Jamnitz, heute Jemnitze, aus dem
Felsgestein gehauen. Unter dem Hauptplatz befindet sich ja Felsen. Der
Brunnen war ein Drehbrunnen. Mithilfe eines Rades wurde der Kübel an
einer eisernen Kette hinuntergelassen. 1925 wurde das Pumpwerk für den
elektrischen Betrieb eingerichtet. Bereits vorher waren die hölzernen
Röhren der städtischen Wasserleitung durch Eisenrohre ersetzt worden.
Alter Stadtbrunnen - Dieser Ziehbrunnen ist 52,5 m tief und wurde bis um 1926 benützt.

Die Stadtkirche wurde 1461-1464
im gotischen Stil an Stelle einer hölzernen Kapelle erbaut. Sie ist dem
Hl. Martin geweiht. Der Hochaltar und die Kanzel sind barock, ebenso
die Seitenaltäre und die Kreuzwegbilder. Der rechte Seitenalter zeigt
die Hl. Mutter Anna. Links ist der Hl. Antonius von Padua abgebildet,
er hilft, Verlorenes wiederzufinden. Die Statue des Hl. Martin auf dem
Hochaltar stammt aus der Zeit um 1900. Die Pfarre Drosendorf wird seit
der Gründung des Stiftes Geras im Jahr 1153 von den Prämonstratenser
Chorherren aus dem Stift Geras betreut. Die Gebeine der Hl. Valentina
stehen in einem barocken Glassarg in einer Fensternische.
Sehenswert ist auch das Heilige Grab in der Stadtkirche - es befindet
sich ganz hinten unter der Orgelempore. Dieses Grab wurde aus
handgeschliffenen Gablonzer Glassteinen von der in der ganzen Monarchie
berühmten Firma Zbitek aus Olmütz/Olomouc in Mähren hergestellt. Seit
1881 steht es in diesem Raum und war früher nur in den Tagen der
Karwoche zu besichtigen.

Marktkirche St. Martin in Drosendorf an der Thaya
Nachdem die Altstadtkirche, die schutzlos auf einem kleinen Hügel
liegt, durch die Errichtung der befestigten Burg auf dem Plateau
jenseits der Thaya immer mehr ihre ursprüngliche Bedeutung verlor, und
nachdem sich um die Burg reges Leben aufbaute, wurde es als
selbstverständlich empfunden, in der Stadt eigene Gottesdienste zu
feiern. So wurde schon bald, vermutlich im 13. Jahrhundert, eine
Martinskapelle errichtet, die „ausgestattet" wurde mit Priestern,
bestiftet mit einem Altar. Das Alter dieser Kapelle ist unbekannt, die
erste Erwähnung einer Stiftung finden wir aber bereits um 1408 beim
Barbaraaltar (diesen Altar gibt es nicht mehr). Die Kapelle hatte eine
eigene Meßlizenz, aber alle pfarrlichen Agenden (Sakramentenspendung,
Beerdigungen und vieles mehr) wurden in der Altstadtkirche vollzogen.
Drei bzw. vier Chorherren wurden der Pfarre vom Stift Geras zur
seelsorglichen Betreuung zur Verfügung gestellt.
Die Martinskapelle wurde zwischen 1461 und 1464 zu einem spätgotischen
Hallenbau erweitert. Feierlich konsekriert wurde diese neue Kirche am
2. Dezember 1464. Ein besonderer Gönner der Martinskirche war Oswald
von Eytzing (gestorben 1476), Inhaber der Herrschaft Drosendorf, der
testamentarisch eine reiche Stiftung verfügte, die sein Bruder Stephan
vollziehen mußte. Sie erstreckte sich auf die Altäre der Lieben Frau,
der hl. Barbara und der Zwölf Boten (1413 wird bereits ein
Achazienaltar, 1569 ein Georgsaltar erwähnt). Von den früher
zahlreichen Altären sind heute nur mehr zwei erhalten: Antoniusaltar
und Annaaltar, die beiden Seitenaltäre.

Besonders erwähnenswert ist der Glasschrein (links vorne im
Kirchenschiff) mit den kostbaren Reliquien der hl. Märtyrerin
Valentina, die 36jährig in Rom starb. Diese Reliquien sind ein Geschenk
der Gemahlin des kaiserlich österreichischen Botschafters am
päpstlichen Hof. Sie stammen von der römischen Katakombe San Lorenzo di
Ciriaca. Die Gräfin wiederum hatte diese Reliquien als Geschenk vom
Papst bekommen. Die Echtheit ist beurkundet in Rom am 1. Mai 1702. Die
kleine Marmorsteinplatte, die vorne links im Schrein liegt, war
ursprünglich am Grab der Heiligen angebracht. Die Inschrift lautet
übersetzt: Gebeine der Valentina, welche 36 Jahre lebte und starb am
Freitag den 18. März. Der rechts unten in die Tafel eingeritzte Fisch
war schon im Urchristentum Symbol und Bezeichnung für Christus und gilt
überhaupt als Symbol der Christen. Die „Fischblase", ein Ornament, u.
a. im Maßwerk gotischer Kirchenfenster, deutet ebenfalls darauf hin.
Der barocke Glassarg wurde zuerst in der Schloßkapelle aufbewahrt. Am
15. Mai 1704 ist er dann, laut Gedenkbuch der Pfarre, feierlich in die
Martinskirche übertragen worden.
Heilige Valentina - In einer
Nische in der Kirche am Hauptplatz befindet sich in einem barocken
Glassarg mit Akanthusdekor (um 1700) die sterblichen Überreste der
Heiligen Valentina mit einer Inschrift Tafel aus dem 3. Jahrhundert aus
einer römischen Katakombe. Auf der kleinen Steintafel stehen die
Sterbedaten der Toten. Sie starb mit 37 Jahren im Jahr 317. Diese Tafel
ist der älteste beschriftete Stein in Drosendorf. Diese wurden von
Papst Clemens XI. Katharina Eleonora Gräfin Lamberg zum Geschenk
gemacht und 1702 nach Drosendorf gebracht, wo sie zunächst in der
Schlosskapelle ausgestellt war. 1704 wurde Sie hierher in die Kirche
gebracht.

Das Innere ist ein vierjochiger Saalbau mit einfachem
Kreuzrippengewölbe und Wappen an den Schlußsteinen (Stadtwappen, Oswald
von Eytzing, Bindenschild). Zwischen den nach innen gestellten
Strebepfeilern wölben sich breite Arkaden mit verstäbtem Steingewände,
darüber liegen die Emporengänge. In den durch die Strebepfeiler
entstandenen Nischen befanden sich die zahlreichen Altäre der früheren
Zeiten. Den Chor überwölbt ein Kreuzgratgewölbe, an seiner rechten
Seite ist ein Oratorium eingebaut.
Die beiden Seitenaltäre kamen um 1783, nach Schließung der
Wallfahrtskirche Maria Schnee (im Wald zwischen Zissersdorf und
Drosendorf) unter Kaiser Joseph II., dem Sohn Maria Theresias, in die
Martinskirche. Die beiden sehr fein geformten, graziös und beschwingt
gestalteten Seitenaltäre sind mit qualitätvollen Bildern geschmückt:
links der hl. Antonius von Padua mit dem Jesuskind (im Oberbild der hl.
Petrus), rechts die hl. Anna, wie sie sich ihrem Kind, der
Gottesmutter, in typisch mütterlicher Haltung zuwendet (im Oberbild die
hl. Magdalena).

Diese Seitenaltarbilder wurden vermutlich vom berühmten Barockmaler
Franz Anton Maulpertsch oder von einem seiner Schüler angefertigt. Dies
trifft auch auf die an den Seitenwänden angebrachten Kreuzwegbilder zu,
die farblich und kompositorisch sehr dramatisch angelegt sind. Von
gleicher Qualität wie der Aufbau der Seitenaltäre ist die Rokokokanzel.

Der monumentale Hochaltar aus marmoriertem Holz erstreckt sich mit
Säulen und Pilastern über die ganze Apsiswand. Im erneuerten Mittelteil
steht unter dem Baldachin eine um 1900 entstandene Skulptur des hl.
Martin. In den Räumen zwischen den Säulen stehen große, bemalte
Holzfiguren der hll. Joachim, Joseph, Anna und Johannes des Täufers.
Davor, auf dem freistehenden Altartisch, der kuppelartige Tabernakel
mit einem Relief des hl. Norbert in der gerundeten Tür. Norbert von
Xanten, ca. 1082-1134, ist der Gründer des Prämonstratenserordens,
dessen Lebensform die Chorherren des Klosters Geras heute noch zu
verwirklichen suchen. Von Norberts Stammkloster Premontré bei Laon in
Frankreich kommt der Ordensname.

Hinzuweisen wäre noch auf das Taufbecken aus Sandstein, das Formen der
Spätrenaissance aufweist und anfangs des 17. Jahrhunderts entstanden
ist, sowie auf die 1896 vom Wiener Orgelbauer Kaufmann aufgestellte
Orgel.

Der spätgotische, einschiffige Bau wurde im ersten Drittel des 18.
Jahrhunderts außen und innen barockisiert. Damals wurden die Außenwände
des Langhauses mit einer barocken Dekoration überzogen, die jeweils die
zum Teil noch mit qualitätvollem gotischem Maßwerk versehenen Fenster
mit den darüberliegenden kleineren Rundfenstern zu einer Einheit
zusammenfaßt. Nord- und Südportal blieben unverändert gotisch. Am
Südportal befindet sich ein spätgotischer Griffring mit barockem
Beschlagstern und barocker Klinke. Der Chor mit 5/8-Schluß ist stark
einspringend und niedriger, mit Anbauten in den Zwickeln zum Langhaus:
im Norden die Sakristei, im Süden ein Stiegenhaus zum Oratorium der
Herrschaftsinhaber. Der Turm steht vor der westlichen Giebelfront und
ist in diese mit einer Seite integriert.

Vermutlich in den Jahren um 1180/1200 ließen die Grafen von Pernegg auf
einem von der Thaya ausgebildeten, felsigen Geländesporn eine
befestigte Siedlung anlegen. Dieses so genannte forum Drozendorf
wurde mit einer neuen Burg ausgestattet, dürfte aber zunächst nur von
Palisaden und Wällen umgeben gewesen sein. Da der letzte Pernegger Erbe
ein narre unt ein tore war,
kam Drosendorf bereits um 1220 in landesfürstlichen Besitz. In den
folgenden Jahrzehnten entstand der erste, von Zinnen bekrönte Mauerring.
Als 1278 der Entscheidungskampf zwischen den
Königen Rudolf I. von Habsburg und Premysl Ottokar II. entbrannte,
erwartete Stephan von Maissau das Heer König Ottokars in Drosendorf.
Ottokar verlor vor den gut verteidigten Mauern wertvolle 16 Tage.
Rudolf konnte diese unverhoffte Atempause zu weiteren Vorbereitungen
nützen und bald darauf die Schlacht von Dürnkrut für sich entscheiden.
Ohne den Drosendorfer Mauerring des 13. Jahrhunderts hätten vielleicht
niemals Habsburger in Österreich regiert!
Vor allem dank seiner Hochlage zählte Drosendorf über Jahrhunderte zu
den wehrhaftesten Städten des Herzogtums. Zudem kam es wiederholt zu
aufwändigen Ausbauten der Befestigungsanlagen, die ab dem 15.
Jahrhundert auf den Einsatz von Feuerwaffen ausgerichtet wurden. Damit
konnte die Stadt auch ihre letzte große Belagerung während des
30-jährigen Krieges glücklich überstehen. Als 1620 ein feindliches Heer
11 Tage lang vor den Mauern ausharrte, wurde - wie eine Hausinschrift
spöttisch bemerkt - nur ein Schwein am Rüssel verletzt.

Das Raabser Tor war das zweite
der beiden Stadttore. Hier ist noch der Torbogen erhalten. Links und
rechts oberhalb des Torbogens befinden sich die rechteckigen Öffnungen
für die Rollen der Zugbrücke, die über den Stadtgraben führte und bei
Gefahr aufgezogen werden konnte. Über dem Tor befand sich ein mächtiger
Torturm. Er brannte 1846 beim großen Stadtbrand ab und wurde nicht mehr
aufgebaut. Innerhalb des Tores befindet sich ein Graffito des
akademischen Malers August Hoffmann, der auch die Fassade des Rathauses
gestaltete. Der Mann auf dem Bild begrüßt die Hereinkommenden. Neben
dem Bild steht ein Hinweis auf die Geschichte des Tores und ein
sinnvoller Willkommensgruß.
Jahrhunderte bei Tag und Nacht, das Raabser Tor hielt treue Wacht.
Ließ niemals einen Feind herein, Das heißt fürwahr ehrwürdig sein.
Drum, Wanderer, kommst du vor das Tor, Bleib stehen und denk daran zuvor.
Bist du dem Städtchen Feind, kehr um, Hier ist das Tor, es wehrt dir stumm.
Doch bist du gut ihm, wie wir hoffen. Willkommen, Freund, das Tor steht offen.
Das Haus an der Stadtmauer rechts vom Raabser Tor war das Torwärterhaus
(Nr 3). Im Haus links vor dem Raabser Tor war einige Zeit die Schule
untergebracht. Vor dem Tor finden Sie Reste des Stadtgrabens. Die
Häuser jenseits des Grabens sind direkt in den Mauern der Vorwerke
hineingebaut. Das kleine Haus ganz rechts am Weg zur Promenade (Raabser
Tor 7) war das Mauthaus.

Elf reizvolle Städte liegen im
Schutz historischer Stadtmauern: Drosendorf, Eggenburg,
Groß-Enzersdorf, Horn, Hainburg an der Donau, Laa an der Thaya,
Marchegg, Retz, Waidhofen an der Thaya, Weitra und Zwettl - die Stadtmauerstädte Niederösterreich.
Sie bezaubern mit ihrem historischen Flair und laden ein zu
Entdeckungen und kulinarischen Genüssen. In allen Städten können Sie
die Stadtmauern entlang von Themenwegen bei einem Spaziergang oder
einer Stadtmauernführung erkunden.
Das Vorwerk (um 1550/1620)
Außerhalb der Stadtgräben waren an den beiden Torseiten mächtige
Vorwerke angelegt. Angreifer konnten so auf Distanz gehalten werden.
Von dem vor dem Raabsertor gelegenen Vorwerk blieb an der Straße die
Nordmauer mit dem Ansatz des Torbogens erhalten.

Entlang der Drosendorfer Stadtmauer bringt Sie ein Erlebnisweg in
müßige Urlaubsstimmung; lädt zum Nichtstun ein, aber auch zu bewährten
Straßenspielen und zeigt einen nostalgischen Rückblick auf die
Sommerfrische von Anno dazumal. Ein Spaziergang mit Ausblicken in die
Natur des Thayatales und auf ein Bollwerk mittelalterlicher
Stadtbefestigung.
Wegecharakteristik: 2 km; nahezu ebener Gehweg; Beleuchtung: Juli und August bis 23.00 Uhr, ansonsten bis 22.00 Uhr

Die Stadtmauer umschließt
Drosendorf noch vollkommen. Sie ist 1.750 m lang und mit 12 Türmen, an
einigen Stellen noch mit Zinnen, versehen. Umwandern Sie auf den beiden
Promenaden, Sommerpromenade und Winterpromenade Drosendorf und genießen
Sie den Anblick und Ausblick rund um Drosendorf.
Drosendorf gehört zu den elf reizvollen Städten, die im Schutz
historischer Stadtmauern liegen: Drosendorf, Eggenburg,
Groß-Enzersdorf, Horn, Hainburg an der Donau, Laa an der Thaya,
Marchegg, Retz, Waidhofen an der Thaya, Weitra und Zwettl - die
Stadtmauernstädte Niederösterreichs.

Das Schloss Drosendorf wurde an
der östlichen Ecke des Stadtgebietes angelegt, um die ungeschützte
Seite des Umlaufberges verteidigen zu können. Das Schloss besteht aus
vier dreigeschoßigen Flügeln, die einen viereckigen Innenhof bilden.
Das Schloss beherbergt auch eine Kapelle, die 1681 barockisiert wurde.
Die heutige Form des Schlosses erhielt es nach einem Brand im Jahr
1694, als das gesamte Gebäude abbrannte. Das Schloss Drosendorf ist in
Privatbesitz der Familie DI Markus Hoyos, seit März 2022 verpachtet und
seither wieder öffentlich zugängig. Der Pächter Baudouin de
Troostembergh betreibt eine Frühstückspension.

Die Stadt Drosendorf wurde auf einem Umlaufberg der Thaya erbaut. Der
Fluss schützt die Stadt also an drei Seiten. Die ungeschützte Ostseite
wurde besonders befestigt. Hier errichtete man eine mittelalterliche
Burg, an deren Stelle sich jetzt das Schloss befindet. Die heutige Form
erhielt es nach einem Brand 1694, bei dem nach einem Blitzschlag das
ganze Gebäude abgebrannt war. Der romanisch-gotische Gebäudekern wurde
im Renaissance-Stil ausgebaut. Das Schloss hatte auch einen Turm, der
aber schon 1710 abgetragen wurde. Weiters ein Wappenstein mit der
Jahreszahl 1548. Es ist der älteste Wappenstein im Hof und das ist das
Wappen der Grafen Mrakesch. An der Westseite ist eine Sonnenuhr zu
sehen. Am Südtrakt des Schlosses sehen wir das gemalte Wappen der
jetzigen Schlossbesitzer, der Grafen Hoyos. Es ist in den Farben
Blau-Weiß gehalten und mit goldenen Drachenköpfen versehen. Die
Schlosskapelle wurde 1681 in den damals noch tiefen Burggraben gebaut.
Sie ist Maria Himmelfahrt geweiht, jedoch derzeit nicht allgemein
zugänglich.
Gleich nach der Schlacht auf dem Machfeld 1278 ging die Herrschaft
Rosendorf in den Besitz der Habsburger über, wurde aber immer
verpachtet, und zwar zuerst an die Herren von Kapellen, die Rudolf in
der Schlacht gegen Ottokar entscheidend unterstützt hatten, und an die
Herren von Wallsee, dann an die Eizinger. 1534 für 40 Jahre an Johann
Mrakesch von Noskau. Er war der Gründer der Bürgerspitalstiftung im
Jahr 1536. Ab 1606 folgten die Grafen Mollard, die die Herrschaft als
Eigentum erwarben, also keine Pächter mehr waren. Seither ist das
Schloss in Privatbesitz. Die nächsten Besitzer waren die Reichskrafen
Kurz, die auch Horn besaßen. Durch Heirat gelangte der Besitz an
Ferdinand von Sprinzenstein, ab 1704 ebenfalls durch Heirat an die
Familie Lamberg. Seit 1822 ist das Schloss im Besitz der Familie
Hoyos-Sprinzenstein.

Im geräumigen, rechteckigen Hof befindet sich ein stimmungsvoller Brunnen mit dem Wappen der Grafen Lamberg.

Wappen der Hoyos an der Südfassade des Schlosshofes

Schloß: Alte Wehranlage aus dem 11. Jhdt. Babenberger-Besitz bis 1246.
Im Besitz der Habsburger 1278-1606. Die ehemals romanisch-gotische
Burganlage wurde im 16. Jhdt. im Renaissancestil ausgebaut und nach
einem Brand 1694 teilweise barockisiert. Über dem Tor das Wappen des
Reichsgrafen Kurz. Kapelle 1681. 1972-1981 Gesamtrenovierung Dipl. Ing.
Hans Graf Hoyos.

Drosendorf zählte über Jahrhunderte zu den wehrhaftesten Städten des
Herzogtums. Noch heute sind die ehemaligen Befestigungsanlagen in
beeindruckender Vollständigkeit erhalten. Freilich geht das weitläufige
Ensemble von Mauern, Türmen, Toren und Gräben auf unterschiedliche
Bauzeiten zurück: Die erste Stadtmauer wurde um die Mitte des 13.
Jahrhunderts errichtet. In den folgenden Jahrzehnten erhielt das
Hornertor zwei mächtige frühgotische Türme mit bewohnbaren
Obergeschoßen. Vor allem im 14. Jahrhundert wurde die alte Stadtmauer
verstärkt bzw. durch eine neue, rund 10 m hohe und bis zu 1,9 m starke
Mauer ersetzt, hinter der sich die Drosendorfer wieder sicher fühlen
durften. Im 15. Jahrhundert musste auf das Aufkommen der Feuerwaffen
reagiert werden, wobej die spätgotische Zwingerbefestigung mit ihren
Flankierungstürmen hervorzuheben ist. In der Renaissance wurden weitere
Modernisierungen vorgenommen und starke Vorwerke errichtet. Daher
konnte sich die Stadtbefestigung auch bei ihrem letzten großen „Test" -
der Belagerung von 1620 - bestens bewähren.

THUMERITZBACH-BRÜCKE, INSTANDSETZUNG 1998
ZUL. BELASTUNG: LKW MIT 25 t UND GLEICHLAST 500 kg/m² ODER 1 RFZ 60t IM ALLEINGANG

Wenn man von Zissersdorf nach Geras fährt, quert man im Johannesthal
den Thumeritzbach. Auf dem Pfeiler des rechten Brückengeländers steht
eine barocke Statue des Hl. Johannes Nepomuk. Der Heilige trägt - wie
in üblicher Ausführung - ein Priestergewand und Birret und hält ein
Kreuz mit Corpus Christi in seinen Händen. Die Sandsteinplastik wirkt
etwas disproportioniert., Oberkörper, Arme und Hände sind im Vergleich
zum übrigen Körper zu klein. Die Statue aus Zogelsdorfer Sandstein
steht auf einer quaderförmigen Platte, vom ursprünglichen Postament ist
nur noch die Abdeckplatte, ebenfalls aus Zogelsdorfer Stein, vorhanden.
Der derzeitige Pfeiler, auf dem die Heiligenstatue steht, ist aus
Betonguss und zeigt allseitig eingetiefte Kartuschen, auf der
Vorderseite ist eine Metalltafel angebracht.
Die Statue des Brückenheiligen wurde an der Querung des Thumeritzbaches
1755 aufgestellt. Zur Renovierung im 20. Jahrhundert gibt es folgende
überlieferte Geschichte: In den Kriegswirren des 2. Weltkriegs wurde
der Heiligenfigur der Kopf abgeschlagen und später unter der Brücke im
Bach gefunden. Als bei einem schrecklichen Verkehrsunfall an der Brücke
niemand 'wie durch ein Wunder' zu Schaden kam, wurde von den
Betroffenen dies zum Anlass genommen, die Statue als Dank renovieren zu
lassen. Mit dem Neubau der Thumeritzbachbrücke 1973 erhielt der Heilige
das heutige Postament, im Jahr 2000 wurden die Brücke und auch die
Figur saniert.

Altstadtkirche St. Peter und Paul in Drosendorf an der Thaya
Bei der Gründung des Stiftes Geras durch den Grafen Ulrich von Pernegg
um 1153 wurde die schon bestehende Pfarre Drosendorf dem Stift
einverleibt, es muß also, vermutlich an Stelle der heutigen Peter- und
Paulkirche, ein Vorgängerbau vorhanden gewesen sein. Die heutige
Pfarrkirche wurde aber viel später, im ersten Viertel des 16.
Jahrhunderts, als dreischiffige Anlage mit höherem Mittelschiff und
niedrigeren Seitenschiffen unter einem gemeinsamen Dach (Staffelkirche)
erbaut. Der Chor mit 5/8-Schluß ist eine Verlängerung des Mittelschiffs
in Breite und Höhe nach Osten. Die Chorfenster, die bei der
Barockisierung im 18. Jahrhundert verschieden hoch abgekappt wurden,
tragen noch Reste des ursprünglich gotischen Gewändes. Vor der Mitte
der Westwand, an einer Seite mit ihr verbunden, steht der quadratische
Turm. An jeder Langhauswand stehen fünf zweifach gestufte Strebepfeiler
mit geschweiften Giebeldächern, an der Westkante jeweils über Eck
gestellt, und an der Südwand des Langhauses befindet sich ein reich
verstäbtes, spätgotisches Kielbogenportal. In der Ecke zwischen dem
Chor und der Südwand des Langhauses steht der rechteckige
Sakristeianbau mit einem kleinen Fensterchen, ebenfalls aus der
Spätgotik. An der Südseite der Sakristei findet man ein Blechkästchen
mit einer Exvoto-Tafel „1816".

Im Inneren sind Mittel- und Seitenschiffe durch auf Pfeilern ruhende
Rundbogen miteinander verbunden (17. Jahrhundert). Die Seitenschiffe
sind bedeutend schmäler als das Mittelschiff. Der Chor ist um drei
Stufen höher, er ist gegenüber dem Mittelschiff durch zwei
vorspringende Halbpfeiler und einen darüber liegenden Rundbogen optisch
abgeteilt. Gemalte Pilaster flankieren die Fenster des Chores.

In den Gewölben sind eindrucksvolle Fresken vom Trogerschüler Lukas
Stipperger zu sehen, entstanden um 1780. Im Langhaus Szenen aus dem
Leben der beiden Kirchenpatrone, von Ost nach West: Wunderbarer
Fischfang; Petrus vor dem hohen Rat; Paulus vor dem Statthalter. Über
der Orgelempore: König David mit der Harfe. Im Chor von Ost nach West:
die drei göttlichen Tugenden Glaube, Liebe, Hoffnung, dargestellt durch
zwei Frauengestalten und einen Putto; über einem stürzenden Dämon der
Triumph der Religion, von Putten umgeben. Die Seitenschiffe sind
ornamental und floral bemalt.

Beim Hochaltar mit seinem gemalten Aufbau, neobarockem Tabernakel und
der freistehenden Mensa beeindruckt vor allem das zwischen zwei
gemalten Pilastern hängende, qualitätvolle, monumentale Bild. Es zeigt
die beiden Kirchenpatrone: Paulus vor dem knienden Petrus - darüber die
thronende Dreifaltigkeit in Freskomalerei - und könnte eventuell eine Arbeit
Paul Trogers oder von einem seiner Schüler sein.
Im Chorraum steht links vom Hauptaltar ein kunstvoll gemeißeltes
spätgotisches Sakramentshäuschen (um 1515), das sich vom Boden bis zur
Decke erstreckt, mit Astwerk, Fialen und krabbenbesetzten Kielbögen
sowie zwei spätgotischen Eisentürchen. Es ist eine Meisterleistung der
Steinmetzarbeit. Gegenüber eine ebenfalls spätgotische Sitznische sowie
die reich verstäbte Tür zur Sakristei.


Die historisch wertvolle Orgel stammt aus dem Spätbarock und mit
ziemlicher Sicherheit aus der Werkstatt des berühmten Orgelbauers
Casparides aus Znaim, der sie um das Jahr 1729 hergestellt hat. Es ist
eine mechanische, zweimanualige Schleifladenorgel. 1978 wurde sie
restauriert.

Die marmorierte Holzkanzel ist mit Bandlwerkdekor aus der Zeit um 1730 geschmückt.

Links und rechts vom Triumphbogen stehen auf
Konsolen kunstvoll gearbeitete, überlebensgroße, polychromierte und
vergoldete, spätbarocke Statuen der hll. Florian und Johannes Nepomuk.
Auf dem linken der beiden illusionistisch gemalten Seitenaltäre, die
anfangs des 19. Jahrhunderts entstanden sind, eine ausdrucksvolle
barocke Pietà in einer Rokokovitrine. Das Altarbild mit der Darstellung
der Taufe Christi schuf M. Reis 1856.

Auf dem rechten Seitenaltar
ebenfalls ein Altarbild von M. Reis, das St. Ulrich darstellt.

Im linken hinteren Seitenschiff steht ein zehneckiger, spätgotischer Taufstein aus rotem Marmor.

Die römisch-katholische Pfarrkirche Drosendorf, auch Altstadtkirche
genannt, steht in der Stadtgemeinde Drosendorf-Zissersdorf im Bezirk
Horn in Niederösterreich. Die Pfarrkirche Peter und Paul – dem Stift
Geras inkorporiert – gehört zum Dekanat Geras in der Diözese St. Pölten.
Die demnach schon früher bestehende Pfarre wurde um 1153 dem Stift
Geras inkorporiert. 1517 wird eine Weihe des Chores berichtet. 1597
wurde der Kirchturm erbaut. Im Gegensatz zur bestehenden Kirche war die
ursprüngliche Kirche in gotischem Stil errichtet, Reste sind in Form
eines gotischen Sakramentshäuschens (um 1515) im Chor links vom Altar
und des spätgotischen Südportals erhalten. In den Jahren 1620 und 1645
wurde die Kirche im Dreißigjährigen Krieg verwüstet und danach als
dreischiffige Kirche mit höherem Mittelschiff unter gemeinsamem Dach
(Pseudobasilika) wiederaufgebaut. Im Zuge der Barockisierung im 18.
Jahrhundert wurden die gotischen Fenster des offenbar noch erhaltenen
gotischen Chors vermauert oder verschieden hoch abgekappt.

Die Baugeschichte der Stadtbefestigung
Aus der Gründungszeit der befestigten Siedlung haben sich nur die
ehemalige romanische Filialkirche - heute ein Wohnhaus - und Teile der
Burg erhalten. Die Burg besaß einen im 18. Jahrhundert abgetragenen
Turm, der weithin sichtbar den Sitz der Herrschaft markierte. Die Stadt
selbst dürfte damals eine Holz-Erde-Befestigung geschützt haben. Die
erste Stadtmauer wurde um die Mitte des 13. Jahrhunderts errichtet. Sie
war an den beiden Torseiten rund 8 m hoch und erreichte Mauerstärken
von mehr als 1,5 m. Wo sie durch das zur Thaya abfallende Vorgelände
geschützt war, wurde sie schwächer ausgeführt und musste später der
gotischen Stadtmauer weichen. Daher findet sie sich heute vor allem an
den Torseiten erhalten. Sie zeigt uns hier noch spätromanisch geprägte
Mauertechnik.
In den Jahren um 1260/1300 wurde die südliche Stadtansicht in
spektakulärer Weise aufgewertet: Das Hornertor erhielt zwei mächtige,
den Torweg flankierende Türme mit bewohnbaren Obergeschoßen.
Mauertechnik, Detailformen und Steinmetzzeichen verweisen auf die
frühgotische Bauzeit. Nicht lange danach entstand auch an der Westseite
der Stadt ein hoher Turm. Er befand sich seitlich des Raabsertors und
wurde leider im 19. Jahrhundert abgetragen. Als nächste große
Unternehmung stand der Ausbau der bereits in die Jahre gekommenen
Stadtmauer an. Sie wurde an den Torseiten erhöht bzw. an den
Längsseiten verstärkt oder abgetragen und durch eine neue, rund 10 m
hohe und bis zu 1,9 m starke Mauer ersetzt, hinter der sich die
Drosendorfer wieder sicher fühlen durften. Die Bauarbeiten waren
spätestens in den ersten Jahrzehnten des 15. Jahrhunderts abgeschlossen.
1405 war Drosendorf von schweren Kämpfen betroffen, bei denen die Burg
mit Steinen und Pfeilen mannhaft verteidigt wurde. Auch die folgenden
Hussitenkriege boten reichlich Anlass, weitere Investitionen in die
Stadtbefestigung ins Auge zu fassen. So ist etwa der Rundturm an der
Südwestecke mit seinen rund 3 m dicken Mauern als frühe Antwort auf die
zunehmende Bedeutung von Belagerungsgeschützen zu sehen. Eine gewaltige
Bauleistung stellt die starke spätgotische Zwingerbefestigung dar. Sie
wurde der Stadtmauer mit Ausnahme der Südwestseite durchgehend
vorgelegt. Die zahlreichen Rondelle und anderen Flankierungsbauten des
Zwingers sind bereits mit Schießscharten für den Einsatz von
Feuerwaffen eingerichtet.
Im 16. und 17. Jahrhundert musste der zerstörenden Wirkung der
Geschütze weiter Rechnung getragen werden. Dies zeigen etwa die
massiven Verstärkungen des südöstlichen Zwingers. An den beiden durch
ebenes Vorgelände gefährdeten Torseiten entstanden starke Vorwerke, die
heute großteils verschwunden sind. 1667 wurde südwestlich des Schlosses
eine Schießstätte angelegt. Bald danach traten die militärischen
Interessen immer mehr in den Hintergrund. Die Zwingerbereiche wurden in
Gärten verwandelt und auf den Rondellen des seiner Wehreinrichtungen
beraubten Schlosses standen nun statt der Kriegsknechte schmückende
Steinvasen.

Die unerschütterliche Standfestigkeit der mittelalterlichen Stadtmauer von Drosendorf bis heute
In der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts entsteht an der Mündung des
Thumeritzbaches in die Thaya ein Dorf. Die Grafen von Pernegg gründen
um 1100 dort eine Pfarre. Hiermit beginnt die Besiedlung des Hausberges
über dem Kirchenort. Bald entsteht daraus eine neue Burgstadt. Ein
Mauerring, 1,5 Meter dick und 8 Meter hoch, wird errichtet. In die
Stadt hinein führen zwei Tore. Drosendorf ist nun eine der
Festungsstädte an der Grenze zu Böhmen, wie auch Raabs oder Hardegg.
1240 wird Drosendorf zur Stadt erklärt. Ihre große Stunde kommt dann
1278, als die Stadt unter Stephan von Maissau über 16 Tage gegen die
Truppen von Böhmenkönig Ottokar II. verteidigt wird. Damit gewinnt
König Rudolf von Habsburg Zeit für das Sammeln seines Heeres für seine
siegreiche Schlacht gegen Böhmen im Marchfeld. Als Dank dafür wird
Drosendorf zur kaiserlichen Stadt erhoben. Da im 15. Jahrhundert die
Hussitenkriege aufflammen und die Feuerkraft der Geschütze zunimmt,
wird die Stadtmauer auf fast 2 Meter Dicke und 10 Meter Höhe verstärkt.
Zusätzlich erhält sie Zwinger mit Schießscharten. Im Dreißigjährigen
Krieg ziehen die Schweden an der Festungsstadt vorbei. Vermutlich hat
ihnen die Mauer zu viel Respekt abverlangt. Heute steht sie als einzige
noch vollkommen geschlossene Stadtmauer Österreichs unter
Denkmalschutz. Sie bietet vorzügliche Ausblicke auf die Thayaschleife,
und Stadtführungen bieten interessante Einblicke in ihre bewegte
Geschichte.

Wandert man vom Horner Tor entlang der Horner Straße zur Schule, kommt man nach dem Kreisverkehr zum Drosendorfer Kriegerdenkmal.
Man erreicht den in die Böschung eingelassenen Standplatz über vier
Stufen, die Seiten des Platzels sind mit Bruchsteinmauerwerk armiert.
Auf einem Sockel, der zur Nischenöffnung hin mit drei Stufen
unterbrochen ist, setzt eine Fassade aus Steinquadern an, die
Eckpilaster an den Kanten und der Nischenöffnung und dazwischen
vertikale stabförmige Verzierungen ausweist. Über diesen befindet sich
je ein Lorbeerkranz mit den Jahreszahlen beider Weltkriege. Auf den
Pilastern der Nischenöffnung setzt ein gestelzter Bogen an, der auf den
Kapitellen in einer kantigen Spirale ausläuft. Darüber wölbt sich ein
Scheingiebel in abgesetzter Bogenform mit seitlichen Voluten. Den
Nischenbogen begleitet ein verschlungenes Spruchband mit der Inschrift:
'Unseren Helden zur Ehre'.
Das Kriegerdenkmal wurde 1922 errichtet; davor wurde die 1905 dorthin
versetzte Pestmarter abgetragen und auf der anderen Straßenseite wieder
errichtet. Nach dem 2. Weltkrieg wurden die Tafeln mit den Gefallenen
und vermissten dieses Krieges ergänzt. Auf der rechten Seitenwand wurde
1995 über den Marmortafeln eine verzierte Holztafel mit der Inschrift
'Sie haben den Kampf gekämpft den Lauf vollendet und den Glauben
bewahrt' von K. Ruscha, 1995, angebracht.

Der Reblaus Express verbindet auf einer Strecke von 40 km die
rebenbewachsenen Hügel des Weinviertels mit den stillen Wäldern und
Teichen des Waldviertels. Mitunter weitab von Straßen und Siedlungen
geht die Reise durch ausgedehnte Wälder und kleinräumige Feldflure,
über Hügelland und Flussniederungen. Zehn Bahnstationen (Retz, Hofern,
Niederfladnitz, Pleißing-Waschbach, Weitersfeld, Hessendorf
Anglerparadies, Langau, Geras-Kottaun, Zissersdorf, Drosendorf) laden
zum Verweilen und Entdecken ein.

Wem der viele Text zu lange war und lieber Bewegtbilder mit Musik mag,
kann sich gerne dieses Video antun: