web steiner
Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen
Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.
+43/2624/54014 - office@websteiner.com
Friedensburg Schlaining
Stadtschlaining, Juli 2024
Die Friedensburg Schlaining diente einst als Verteidigungsfestung und ist heute ein bedeutendes Symbol des Friedens. Die Burg lädt unter dem Leitgedanken „Von der Wehrburg zur Friedensburg“ zu sechs neuen faszinierenden Ausstellungen ein, die Geschichte, Frieden und Demokratie in den Mittelpunkt rücken. In der malerischen Kulisse der Friedensburg werden Besucherinnen und Besucher auf eine packende Zeitreise von der mittelalterlichen Festung bis hin zu einem Zentrum des Friedens eingeladen.

Eine kurze Geschichte
Die Region um Stadtschlaining war schon 1200 v. Chr. für seine reichen
Antimonvorkommen bekannt. Eisengewinnung lässt sich bis 200 n. Chr.
nachweisen. Aus der darauf folgenden Zeit bis ins frühe Mittelalter
sind keine nennenswerten Funde aus dieser Gegend bekannt. Die
Geschichte von Stadtschlaining ist nicht untypisch für Kleinstädte
entlang der heutigen österreichisch-ungarischen Grenze. Damals im
Grenzraum des ungarischen Königreiches zum Heiligen Römischen Reich
gelegen, war für die Herrschaftsbesitzer die Gefahr groß, zwischen
benachbarten Mächten zerrieben und für politisch-militärische
Interessen vereinnahmt zu werden. Sie konnten sich aber auch durch
geschicktes Paktieren mit diesen Mächten arrangieren und so eigene
Vorteile und Rechte sichern. Im Friedensvertrag des Jahres 1271
zwischen König Stefan V. von Ungam und König Ottokar II. von Böhmen
wird erstmals der Name Schlaining („Zloynuk/Slomuk") genannt. Zu dieser
Zeit war die Befestigung im Besitz des Adelsgeschlechts der Güssinger.
Der in Wiener Neustadt residierende König Friedrich IV - besser bekannt
als der spätere Deutsche Kaiser Friedrich III. (Vater von Maximilian
I., bekannt als der „letzte Ritter") - ließ 1445 eine Reihe von Burgen
in Westungarm erobern, darunter auch Schlaining. Er verpfändete den
Besitz Schlaining an seinen Gefolgsmann und Heerführer Andreas
Baumkircher, der ihn in den nächsten Jahren von den ehemaligen Besitzen
käuflich erwarb. Baumkircher baute die Herrschaft aus und gründete die
an die Burg anschließende, befestigte Stadt. Als Anführer des
steirischen Adelsbundes wandte sich Andreas Baumkircher jedoch gegen
Friedrich III. Er wurde dafür 1471 in Graz hingerichtet.
Im Jahr 1544 fiel der gesamte Besitz der Herrschaft Schlaining an die
Familie Batthyány. Von der Eroberung durch die Türken blieb der Ort
zwar verschont, geriet aber in die Pufferzone zwischen Osmanischem
Reich und den Habsburger Ländern. Gemeinsam mit anderen Festungen hatte
die Herrschaft Schlaining nun eine strategische Bedeutung in der
Verteidigungslinie der österreichischen Länder gegen Osten. Nach dem
Ende der Türkenkriege ging diese Bedeutung verloren. In der Zeit der
Türkenkriege erlangten die Burgen der Familie Batthyány auch Bedeutung
durch ihr höfisches Leben. Mit der Berufung von Carolus Clusius an den
Hof Balthasar III. Batthyány in den Jahren 1577-1582 kam der
bedeutendste Botaniker seiner Zeit auf die Burg Schlaining. Innerhalb
der Stadtmauern von Stadtschlaining lebten Familien mit verschiedenen
religiösen Bekerintnissen und prägten den Ort durch ihre
unterschiedlichen Lebens- und Glaubenswelten. Neben Katholiken lebten
Protestanten in der Stadt, die in der Zeit der Reformation das
Wohlwollen der Familie Batthyány genossen. Mit der Ansiedlung jüdischer
Familien im 17. Jahrhundert entwickeite Stadtschlaining ein für diese
Region charakteristisches Merkmal religiöser Vielfalt.
Wirtschaftlich wurde Stadtschlaining während der Herrschaft der Familie
Batthyány zu einem lokal bedeutenden Ort mit einem großen Anteil an
Handwerkern unter den Stadtbewohnern. Mit der ungarischen Revolution
1848 endete die Zeit des Feudalsystems endgültig und damit auch die
Dienstleistungspflicht der Untertanen und die grundherrschaftliche
Gerichtsbarkeit. Die Familie Batthyány stellte den ersten
Ministerpräsidenten des neuen, nachfeudalen Königreichs Ungarn, das
sich vom Kaiserhaus in Wien nationale Selbstständigkeit sichern wollte,
Graf Ludwig Batthyány wurde jedoch im Jahr 1849, nach der
Niederschlagung der ungarischen Revolution in Budapest, hingerichtet.
Oberwart begann im 19. Jahrfiundert Stadtschlaining den Rang als
Verwaltungs- und Wirtschaftszentrum abzulaufen. Dies auch deshalb, weil
die damals errichtete Bahnlinie Szombathely - Pinkafeld einige
Kilometer an Stadtschlaining vorbei führte.
Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges verior Ungam zwei Drittel seines
Staatsgebietes. Darunter auch Teile Westungarns, die als Bundesland
Burgenland an Österreich angegliedert wurden. Abseits von den Zentren
und darüber hinaus nun auch in einem wirtschaftlich rückständigen
österreichischen Bundesland gelegen, verzeichnete der Ort einen
stetigen Bevölkerungsrückgang. Der Beginn der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft leitete das endgültige Aus des jüdischen Lebens in
Stadtschlaining ein. Von den um 1850 etwa 650 im Ort lebenden Juden und
Jüdinnen wurden die wenigen hier verbliebenen Familien - 1934 waren es
19 Personen - im März 1938 aus ihrer Heimatstadt vertriebern. Die Burg
wurde zwischen 1939 und 1945 als Zwangsarbeitslager für etwa 300
Zwangsarbeiterinnen verwendet. Zwischen 1945 und 1947 war sie ein Lager
für Entnazifizierungsmaßnahmen für ehemalige SS-Angehörige und führende
Parteimitglieder der NSDAP.
Nach der Niederschlagung des ungarischen Volksaufstandes im November
1956 wurde die Burg Schlaining eines der vielen Auffanglager für die
Flüchtlinge. Knapp 1.400 von ihnen waren hier untergebracht.
Bundesminister a. D. DDDr. Udo Illig erwarb die Burg 1957 und begann
mit den Renovierungsarbeiten. 1980 kaufte das Land Burgenland sie und
setzte die Renovierung fort. Nach dem Beitritt Ungarns zur Europäischen
Union (2004) liegt Stadtschlaining nach jahrzehntelanger Randlage am
Eisernen Vorhang nun in einer wieder zusammenwachsenden Region mit
offenen Grenzen, deren gemeinsame Wurzeln und Geschichte über 800 Jahre
zurückreichen. Heute ist die Burg Sitz des „Österreichischen
Studienzentrums für Konflikt- und Friedensforschung". Nach sehr
umfangreichen Sanierungsarbeiten in den Jahren 2020 und 2021 beheimatet
die Friedensburg Schlaining nun die Jubiläumsausstellung „Wir sind 100.
Burgenland schreibt Geschichte", die in multimedialer Weise die
100-jährige Geschichte des Burgenlandes beleuchtet und erlebbar macht.

ZUR JUBILÄUMSAUSSTELLUNG „100 JAHRE BURGENLAND. WIR SCHREIBEN GESCHICHTE"
Die Tore der Friedensburg Schlaining stehen seit dem 15. August 2021
offen und die Jubiläumsausstellung lockt mit einem breit gefächerten
Wissensangebot über das Burgenland. Ein historischer Anlass ganz im
Zeichen des Miteinanders. Das Burgenland hat sich im vergangenen
Jahrhundert von einer der ärmsten Gegenden Europas zu einer
Vorzeigeregion in Österreich, aber auch innerhalb der gesamten
Europäischen Union entwickelt. Wesentlich dazu beigetragen haben der
starke Zusammenhalt und das positive Wir-Gefühl in der Bevölkerung.
Besucherinnen erfahren auf rund 1.300 m² barrierefreier Fläche,
gegliedert in 12 Themenbereiche, Wissenswertes, Kurioses, aber auch
Nachdenkliches über die Entstehung, politische Geschichte, Identität
und Heimat, Wirtschaft und Umwelt, Auswanderung und die
Fluchtbewegungen sowie über kulturelle, sprachliche und religiöse
Vielfalt des Burgenlandes. Mit 850 Objekten von über 120 LeihgeberInnen
in 160 Vitrinen sowie 30 Medienstationen wird die burgenländische
Geschichte anschaulich erzählt. In den Mittelpunkt gerückt werden
packende Lebensgeschichten und Erinnerungen burgenländischer
Persönlichkeiten ebenso wie interessante Fakten zu landestypischer
Kulinarik und zu Genuss.
* * *
Der Burggraben
Die Burg steht auf einem Felssporn über dem Tauchental und war im
Mittelalter wegen der steilen Hänge von Norden und Osten kaum
anzugreifen. Im Süden und Westen trennt ein bis zu 10 m tiefer Graben
die Burg von der Stadt. Die ungewöhnliche Tiefe des Grabens ist ebenso
wie seine Breite von 80 m darauf zurückzuführen, dass im 15.
Jahrhundert das Baumaterial für die Errichtung der Burg aus dem Graben
gewonnen wurde. Gleichzeitig entstand dadurch ein eindrucksvolles
Annäherungshindernis, das insofern von fortifikatorischer Bedeutung
war, als sich knapp südlich der Burg ein kleiner Hügel befindet, von
dem es möglich gewesen wäre, die Burg zu beschießen. Die Breite des
Grabens trug demnach dazu bei, die Wucht der Geschosse zu reduzieren.
Die Außenbefestigung
Die Brücke über den Burggraben endet am äußeren Burgtor, das in dieser
Form seit der Mitte des 17. Jahrhunderts einen älteren Durchlass
ersetzt. Beidseits des Tores sowie dahinter sind weitere Teile der
Befestigung staffelartig zu sehen: Im Vordergrund verbindet eine
zweigeschoßige Zwingermauer mit Schartenöffnungen das Burgtor mit einem
halbrunden Batterieturm, dessen beide untere Geschoße im 15.
Jahrhundert entstanden. Im Hintergrund ragt der Torturm aus der Mitte
des 15. Jahrhunderts auf. An den Torturm schließt rechts der Bering der
Vorburg aus dem späten 13. Jahrhundert an, der im 15. und 16.
Jahrhundert erhöht wurde. Links sind im Hintergrund ein Stück des
Vorburgberings, der Bergfried und der Bering der Kernburg zu sehen, die
in zwei Ausbauphasen im 15. Jahrhundert errichtet wurden. Der Bering
der Kernburg erhielt dabei als Zierde umlaufend zwei Gesimsbänder aus
flachen Steinen. Über dem oberen Gesims sind abgeschnittene Holzbalken
für Konsolen zu sehen, die einen außenliegenden Wehrgang (eine
sogenannte Hurde), trugen, von dem der Mauerfuß verteidigt werden
konnte. Die in der Höhe gestaffelte Befestigung erlaubte es nicht nur,
die Burg aus allen Winkeln zu verteidigen, sondern sollte auch die
Bedeutung des Burgherrn demonstrieren.

Das Äußere und das Innere Burgtor
1648 errichtete Johannes de la Torre das äußere Rustikaportal, dessen
Inschrift C. A. 1. 6. / .4 .8 .D .B für Comes (Graf) Adamus de Batthyán
steht. Im Giebelfeld erscheint das von Genien mit Grafenkrone gerahmte
Familienwappen - oben auf dem Gipfel eines Felsens der Pelikan, der
seine Brust aufreißt, um seine hungrigen Jungen im Nest zu nähren, und
in der Höhle darunter ein wachsender Löwe, im Rachen einen Türkensäbel
haltend. Am Tor konnten die letzten Meter der Brücke hochgezogen
werden, wie die nischenartigen Rücksprünge und kleinen Ausnehmungen
belegen, in denen sich Flaschenzüge befanden. Aus der Zeit eines
früheren Burgbesitzers, Veit von Fladnitz, stammen zwei Wappensteine,
die neben dem äußeren Burgtor und einige Meter weiter innen über dem
Tor der Vorburg eingelassen sind.

In der Ausstellung „Burggeschichte“ auf der Burg Schlaining können die
BesucherInnen mittelalterliche Geschichte entdecken. In mehreren Räumen
im Untergeschoss der Burg erhalten sie einen umfassenden Einblick in
die verschiedenen Aspekte der Burg und ihre einstigen Bewohner. Von der
Gründung der Burg über den ersten Burgherrn Andreas Baumkircher bis hin
zu den Grafen Batthyány und dem Gelehrten und Botaniker Carolus Clusius
werden die vielfältigen Facetten dieser historischen Stätte beleuchtet.
Die Transformation der Burg Schlaining von einer militärischen Festung
zu einem Symbol des Friedens ist eine der bemerkenswertesten Episoden
ihrer
Geschichte. Heute beherbergt die Burg das „Austrian Centre for Peace“,
das sich der Förderung von Frieden durch Bildung und wissenschaft liche
Forschung widmet. Neben der reichen Geschichte bietet die Ausstellung
„Burggeschichte“ auch eine Reihe von interaktiven Stationen.
BesucherInnen können ihr Können im Schwertschwingen und
Armbrustschießen testen, ihr Wissen in einem botanischen Quiz unter
Beweis stellen und durch ein Heraldik-Memory spielerisch mehr über die
Wappenkunde lernen.

Der Hof der Vorburg
Nach der Durchquerung des inneren Burgtors gelangt man seit dem späten
13. Jahrhundert in die sogenannte Vorburg, in der das Alltagsleben der
meisten Burgbewohner stattfand: Hier wohnte die Besatzung der Burg,
lagerten die Waffen im Zeughaus, befand sich die nicht mehr
lokalisierbare Küche mit ihrem Lebensmittellager und stand die
Schmiede, in der die Werkzeuge und Waffen gewartet wurden. Von den
spätmittelalterlichen Häusern der Vorburg ist nichts erhalten geblieben
- die heutigen Gebäude stammen aus dem 16. und 18. Jahrhundert.
Lediglich der in der Mitte des 15. Jahrhunderts errichtete quadratische
Glockenturm steht noch, der 1646 bis 1649 möglicherweise nach Plänen
von Filiberto Lucchese zu einem Uhrturm ausgebaut wurde. Der sogenannte
Tiefe Graben trennt die Vorburg von der Kernburg, in der im 13.
Jahrhundert die Herrschaftsinhaber, die Güns-Güssinger, ab der Mitte
des 15. Jahrhunderts Andreas Baumkircher und in der Neuzeit die
Batthyány lebten. Die Brücke über den Graben befindet sich unmittelbar
neben dem Bergfried, der unter Baumkircher erneuert und erhöht wurde.

Die umfassende Ausstellung „Burgenland ab 1921“ ist eine Zeitreise
durch die politischen, sozialen und kulturellen Entwicklungen dieser
einzigartigen Region Österreichs. Die Tour erstreckt sich über zwei
Stockwerke und acht Räume und beginnt im 1. Obergeschoss mit dem Raum
„Land der Dörfer“, in dem alle 171 Gemeinden des Burgenlandes
repräsentiert werden. „Das Werden des Burgenlandes“ beschreibt die
entscheidenden diplomatischen Verhandlungen und Verträge von
Saint-Germain und Trianon, die zur Entstehung des Burgenlands geführt
haben. Im Raum „Identitätssuche“ wird die Landesgründung, von der
Entwicklung eines Landeswappens bis hin zur Komposition einer
Landeshymne beleuchtet. Der „Kleine Engelsaal“ gibt unterschiedliche
Einblicke in das gesellschaftliche und soziale Leben der Burgenländer
und Burgenländerinnen. „Die politische Geschichte ab 1921“ befasst sich
mit der ersten Sitzung der burgenländischen Landesregierung, über die
Herausforderungen der beiden Weltkriege und der Nachkriegszeit. Ein
besonderer Fokus wird auf das dunkelste Kapitel bis hin zur Gegenwart
der Geschichte gelegt. „Verfolgt, vertrieben, vernichtet“ gedenkt der
Opfer des Nationalsozialismus und erinnert an das Massaker von Rechnitz.

Besitzer der Burg Schlaining
Die 1271 erstmals urkundlich genannte Burg wurde von den
Güns-Güssingern erbaut. In deren Besitz befand sie sich bis in das
erste Drittel des 14. Jahrhunderts und wurde vom ungarischen König
eingezogen. 1342 überließ König Ludwig I. die Burg der Familie
Kanizsai, nahm sie aber bereits 1371 wieder zurück. Nach 30 Jahren in
königlichem Besitz übertrug König Sigismund die Herrschaft an die
Familie Tompek von Oroszvár, von der sie Andreas Baumkircher erwarb.
Franz Batthyány erhielt Schlaining 1527 von König Ferdinand I.
übertragen, musste seine Rechte gegenüber den Baumkircher Erben jedoch
erst durchsetzen. Die Familie Batthyány teilte sich ab 1659 in mehrere
Linien, wobei die Schlaininger Linie ab 1778 gleichzeitig zwei
Burgbesitzer stellte. Die eine Hälfte ging nach dem Hochverratsprozess
gegen Ludwig Batthyány 1849 an den Staat und wurde vom Eisenbahnpionier
Franz Schmidt erworben. Diesen Teil erwarb 1911 Dr. Demeter Selesky,
der auch die andere Hälfte von der zweiten Batthyány Linie kaufte.
Kurzzeitig im Besitz des Gemeindeverbandes Oberwart ging die Burg 1956
an DDDr. Udo Illig über, der sie schließlich 1980 an das Land
Burgenland verkaufte.

Das Rondell
Andreas Baumkircher ließ in den 1450er Jahren ein viergeschoßiges
Rondell an der Ostseite des Palas errichten. Über Schlüsselscharten in
den unteren Geschoßen konnte man den schmalen Bereich südlich und
nördlich der Bastion einsehen und verteidigen. Im heutigen 1.
Obergeschoß blieben an der Fassade Entlastungsbögen von zwei hohen
Lanzettfenstern erhalten. Bauzeitlich trennten Holzdecken die Geschoße
(nur das halbe Klostergewölbe im heutigen Keller stammt aus dem 15.
Jahrhundert). Eine oberste Geschützplattform zeugte zwar von modernster
Waffentechnik, doch, da das Rondell an einem steilen, somit kaum
bezwingbaren Abhang stand, besaß es nur wenig fortifikatorische
Bedeutung - für den im Tauchental Vorbeiziehenden war es allerdings
weithin sichtbar und somit ein repräsentatives Zeichen des
Herrschaftsanspruchs des Burgherrn.

Gerald Mader (* 1. April 1926 in Payerbach; † 6. Mai 2019 in
Mattersburg) war ein österreichischer Politiker (SPÖ) und Rechtsanwalt.
Er war von 1971 bis 1984 Landesrat in der Burgenländischen
Landesregierung (Kery II, III, IV und V). Mader war ab 1983 Präsident
des Österreichischen Studienzentrums für Frieden und Konfliktlösung in
Stadtschlaining aktiv. 1988 gründete er die European Peace University.
Dr. Gerald Mader (1926-2019)
Gründer des Friedenszentrums Schlaining

Carolus Clusius Biografie
Am 19. Feber 1526 in Atrecht/Arras in der Grafschaft Artois in eine
kinderreiche und wohlhabende Familie geboren, wuchs Charles de
l'Escluse, wie er ursprünglich hieß, vielsprachig auf. Nach der
Lateinschule in Gent studierte er Rechtswissenschaften in Löwen sowie
Medizin in Marburg. Während eines kurzen Philosophiestudiums in
Wittenberg traf er 1549 mit Philipp Melanchthon, auf einer Reise nach
Genf 1550 mit Johannes Calvin die Spitzen der deutschen Reformation.
Sein Medizinstudium setzte er in Montpellier, wo er Zoologie und
Botanik bei Guillaume Rondelet hörte, und Paris fort. Von 1564 bis 1565
bereiste er mit Jakob III. Fugger Spanien und Portugal. Das Ergebnis
seiner dortigen Forschungen ist die „Spanische Flora". Darin legte er
das Grundschema für seine späteren Werke an. 1573 wurde er als Präfekt
der kaiserlichen Gärten an den Wiener Hof berufen. Nach dem Tod von
Maximilian II. 1576 entließ sein Nachfolger Rudolf II. den Protestanten
Clusius, der daraufhin auf Einladung von Balthasar Batthyány von 1576
bis 1588 Aufnahme in Güssing, Schlaining und Rechnitz fand. In dieser
Zeit entstanden die Hauptwerke von Clusius: der „Nomenclator", die
„Pannonische Flora" und die „Pilze Pannoniens". 1588 ging Clusius nach
Deutschland. Ab 1593 wirkte er in Leiden, wo er am 4. April 1609 starb.

Der Hauptsaal des Palas
Der von Andreas Baumkircher ab 1463/64 errichtete Palas wurde an den
nur wenig älteren Bering angestellt, weshalb der ehemals ungeteilte und
von einer Holzdecke überspannte Saal an seiner Ost- und Südseite tiefe
Nischen in Mauerstärke erhielt, über welche man im Osten auf hölzerne
Erker gelangte. An der Westseite der westlichen Nische der Südwand ist
ein Fragment der ursprünglichen Wandbemalung zu sehen - grünes
Rankenwerk mit einem Vogel sowie im oberen Bereich links einem Hirsch,
der sich zu einem Jäger zurückwendet, der gerade mit Pfeil und Bogen
auf das Tier zielt. Weiter unten rechts zeugt das Fragment eines
weiteren Hirsches (Hinterbeine), dass die Jagd offensichtlich das
Leitmotiv der Malerei war. Inhaltlich drängt sich ein Zusammenhang mit
der lokalen Legende vom Hirschenstein auf - dem höchsten Berg des
Burgenlands. Andreas Baumkircher und König Matthias Corvinus hätten
dort gemeinsam einen Hirsch gejagt und erlegt. Das enge Verhältnis
zwischen dem König und seinem Gespan in den Jahren zwischen 1463 und
1465 lässt es möglich erscheinen, dass in der Sage ein wahrer Kern
steckt, den Baumkircher als Demonstration seines Stellenwertes im
Hauptraum der Burg hätte verbildlichen lassen können.

Das Werden des Burgenlandes
Die deutschsprachigen Einwohner der drei westungarischen Komitate
Wieselburg, Ödenburg und Eisenburg hatten enge kulturelle, ökonomische
und ethnische Verbindungen zum angrenzenden, nach dem Ersten Weltkrieg
1919 neu entstandenen Staat Deutschösterreich. Der Wunsch nach einer
Angliederung an diesen wurde mit dem Selbstbestimmungsrecht der Völker
begründet und in den Friedensverträgen von Saint Germain-en-Laye und
Trianon verankert. Ungarn versuchte die Durchführung der Landnahme
durch Deutschösterreich mittels paramilitärischer Freiwilligenverbände,
den sogenannten Freischärlern, zu verhindern. Erst nach zähen
Verhandlungen unter italienischer Vermittlung gab Ungarn im sogenannten
Venediger Protokoll dem internationalen Druck nach. Allerdings musste
Österreich seine Ansprüche auf Ödenburg fallen lassen. Eine
Verbesserung der zwischenstaatlichen Beziehungen begann mit der
burgenländischen Flüchtlingshilfe im Zuge des Ungarn-Aufstandes 1956
und intensivierte sich nach dem Fall des Eisernen Vorhanges sowie dem
Beitritt beider Staaten zur Europäischen Union.

Der Saal im ehemaligen zweiten Obergeschoß des Palas
Der von Baumkircher ab 1463/64 errichtete Palas wurde an den kurze Zeit
davor fertiggestellten Bering angestellt, weshalb ein zunächst
ungeteilter und von einer Holzdecke überspannter Saal im 1. Obergeschoß
(im mittelalterlichen 2. Obergeschoß) wie schon im Geschoß darunter an
der Ostseite tiefe Nischen in Mauerstärke erhielt. Der Saal war über
einen innenhofseitigen, hölzernen Gang und ein Portal im Süden der
Westwand zu betreten. Sonst blieben an der Westseite tiefe
Fensternischen mit Sitzbänken erhalten, die zu Kreuzstockfenstern
gehörten, deren Werksteinrahmen fassadenseitig noch zu sehen sind. Der
Saal wurde in der Mitte des 16. Jahrhunderts eingewölbt, während die
heutigen Zwischenwände für Wohnräume erst in der Mitte des 17.
Jahrhunderts eingestellt wurden.

Die Kapelle
Im späten 16. Jahrhundert wurden die Geschoße des Rondells mit
Muldengewölben mit Stichkappenkränzen versehen. Der damals hoch
aktuelle Gewölbetypus wurde erst kurz zuvor im Sitzungssaal des
Niederösterreichischen Landhauses in Wien in die regionale Architektur
eingeführt. Im Erd- und 1. Obergeschoß entstand dabei die Kapelle, die
man zunächst als protestantische und seit der Gegenreformation als
katholische Kapelle nutzte. Der Hochaltar wurde im frühen 18.
Jahrhundert angefertigt und zeigt das Allianzwappen von Graf Sigmund I.
Batthyány (1673-1726) und seiner Gemahlin Isabella Rosina von
Gallenberg (1670-1731). Die Geburt Christi des Grazer Malers Johann
Baptist Raunacher (unter dem Hl. Josef im Aufsatz, bekrönt von der
Heiligsten Dreifaltigkeit) dürfte später hinzugekommen sein. Das
Manuale der Orgel auf der Empore wurde 1695 vom Grazer Orgelbauer Jakob
Hochinger geschaffen und erhielt im 3. Viertel des 18. Jahrhunderts ein
neues Gehäuse. Seit dem 2. Viertel des 18. Jahrhunderts konnte die
Empore für die Familie Batthyány mit dem bestehenden Ofen beheizt
werden.

Familienwappen der Batthyánys
Im Jahre 1481 wurde Balthasar I von König Matthias I Corvinus das
Familienwappen verliehen. Balthasar I (†1520) – dessen Großvater Albert
(† 1435) sich erstmals Batthyány nannte, nach dem Gut Batthyán, welches
die Familie im Jahre 1398 von König Sigmund für die Verdienste im Kampf
gegen die Türken erhielt – war Obersthofmeister unter König Matthias I
Corvinus.
Die Darstellung des Wappen läst sich folgender Maßen im kurzen beschreiben:
Auf dem Gipfel eines natürlichen Felsens befindet sich ein silberner
Pelikan mit seinen Jungen im Nest sitzend. Diese werden vom Pelikan
durch sein eigenes Blut genährt. In der Höhle im Felsen darunter sieht
man einen aus natürlichem Wasser wachsenden goldenen Löwen, im Rachen
einen gold-begrifften Türkensäbel haltend. Die Familien Farben sind
blau-gelb.

Über den Eingang zum Rittersaal, der bereits zur Zeit von Andreas
Baumkirchner (15. Jh.) als Repräsentationsraum diente, befindet sich
eine Dekorationsmalerei aus dem Jahr 1740. Die Freskendarstellungen,
die zu den ältesten profanen Raumausschmückungen des Burgenlandes
zählen, zeigen weltliche, geistliche und dekorative Schwerpunkte. In
der Kapelle befindet sich eine kleine Orgel aus 1695 von Jakob
Häcklinger.

Der Abort
In Ermangelung einer Kanalisation auf der Burg entsorgte man Unrat
meist auf Misthaufen oder kippte ihn über die Burgmauer. Für die
tägliche Notdurft der Burgbewohner wurden Aborte in oft
schwindelerregenden Höhen an der Außenmauer der Burg errichtet, in
Schlaining befinden sie sich seit 1463/64 jeweils im Norden der drei
mittelalterlichen Obergeschoße. Diese Abtritte besaßen Abfallschächte,
die innerhalb der Mauerstärke geführt wurden und nicht in eine Latrine
mündeten, sondern am Fuß der Mauer ins Freie traten. Die Schächte
mussten daher nicht regelmäßig entleert werden. Neben menschlichen
Exkrementen fanden auch Abfälle über das „Plumpsklo" ihren Weg in den
Burggraben und geben heute oft noch Aufschluss über den Konsum in der
Burg. Unmittelbar neben dem Abort blieb eine kleine Nische zum
Abstellen von Kerzen oder Talglampen erhalten.

Kulinarische Identität
Liebe geht bekanntlich durch den Magen. - Auch die Liebe zu einem Land.
Der Geschmack einer Region weckt Emotionen bis hin zur
Heimatverbundenheit. Die Kulinarik ist Teil der Identität. Heiß
umkämpft war nicht nur das uralte Grenzland, sondern auch der Platz am
pannonischen Herd. Im Burgenland treffen die alpenländisch-bäuerliche
Sterz-Region und die ungarische Gulaschtradition der Viehhirten
aufeinander. Unterschiedliche kulturelle Einflüsse haben die
kulinarische Identität des burgenländischen Raumes geprägt. Dazu kommt
das besondere Klima. Nicht nur die Zutaten für die Küche reifen
besonders gut, sondern vor allem auch jene für den Keller. Die Vielfalt
macht sich auch in den Weinregionen des Landes mit ihren
unterschiedlichen Böden bemerkbar. Im Hügelland des Südburgenlandes
musste der Wein vielerorts dem Apfel- und Birnenmost weichen.
Aufgespritzt mit Mineralwasser aus den Tiefen des Landes sorgen sie
nicht nur im Sommer für Erfrischung.

Ein fast vergessenes Kunsthandwerk ist das Flechten mit Weidenzweigen.
Das Korbflechten war in vielen burgenländischen Häusern eine typische
Winterarbeit. Als Material dienten Maisblätter, Weiden und Stroh. Für
die Ausstellung wurden poetische symbolhafte Objekte in
unterschiedlichen Techniken aus verschiedenen Rohstoffen geflochten.
Wir sehen einen Zander als Zeichen für die traditionsreiche Küche, ein
Segelschiff, für das auch Blaudruckstoffe verwendet wurden,
burgenländische Gänse für den Landespatron, den Heiligen Martin,
Windräder für das Heute. Alles bewegt sich auf die Sonne des
Burgenlandes zu. So finden Elemente und Techniken aus der Vergangenheit
mit dem Heute zusammen.

Die barocken Festräume
Sigmund II. Batthyány (1712-1777), war der Begründer des Schlaininger
Zweigs, wurde 1736 in den Herrenstand der Steiermark aufgenommen und
war ab 1746 Alleinbesitzer der Burg und Herrschaft Schlaining. Auf der
Burg sind ihm weitreichende Baumaßnahmen zuzuschreiben, wobei die
Adaptierungen vor allem der Erhöhung des Wohnkomforts dienten. Die
Wohnräume erhielten neue Fensteröffnungen, Türstöcke und Stuckdecken
sowie barocke Tafelparkettböden, die in den barocken Festräumen
erhalten geblieben sind. Die Decken der beiden Festräume zeigen
Bandelwerkstuck mit Laubwerk und können in die 1730er Jahre datiert
werden, also in jene Zeit, als Sigmund II. Rosalia Lengheim (1737)
heiratete.

Die figürlichen Elemente unterscheiden sich Raum für Raum inhaltlich
voneinander: Während sich im ersten, kleineren Saal Genien in liebender
Treue einander umarmen und küssen, lüften im großen Saal Genien
Vorhänge, hinter denen Trophäen und Soldaten in Erscheinung treten.
Damit kommt der zweiteilige Wahlspruch der Familie Batthyány zum
Ausdruck: „Fidelitate et Fortitudine" - mit Treue und Tapferkeit.

Der Ritter Andreas Baumkircher
Kein anderer Burgherr ist mit Schlaining so verbunden als der
Söldnerführer Andreas Baumkircher. In der Zeit des ausgehenden
Mittelalters als die Ritterheere allmählich von Söldnertruppen mit
Schusswaffen abgelöst wurden war er einer der verlässlichsten
Gefolgsleute von Kaiser Friedrich III. Als einer der letzten Ritter
konnte er als kaiserlicher Heerführer seinen Herrn zweimal aus fast
aussichtsloser Lage befreien. Durch die Thronwirren in Ungarn um die
Mitte des 15. Jahrhunderts war vor allem der westungarische Raum heiß
umkämpft. Davon profitierte nicht zuletzt Baumkircher, der hier mehrere
Herrschaften erwerben konnte. Schlaining machte er zu seinem Zentrum.
Im Konflikt zwischen Kaiser Friedrich III. und dem ungarischen König
Matthias Corvinus geriet er als Diener zweier Herren letztendlich
zwischen die Fronten. In der sogenannten Baumkircher-Fehde rebellierte
er ab 1469 gegen den Kaiser, was ihm 1471 den Kopf kostete.
Die Baumkircher und Schlaining
Andreas Baumkircher erfuhr durch die Gunst des Kaisers einen enormen
gesellschaftlichen Aufstieg, unter anderem als Burghauptmann und Gespan
von Pressburg. Er bekam nicht nur das Privileg sich Freiherr von
Schlaining zu nennen, sondern auch die Erlaubnis die Burg auszubauen
sowie eine Stadt und ein Kloster zu gründen. Ebenso erhielt er das
Recht zur Münzprägung. Seine Nachkommen konnten den Ausbau der
Herrschaft Schlaining durch den Erwerb weiterer Herrschaften sowie
einzelner Dörfer fortführen. Bereits nach zwei Generationen drohte
seine Familie auszusterben. Seine Enkeltochter versuchte den
eigentümlichen Besitz zu verteidigen und zu erhalten. Letztendlich
musste sich deren Tochter geschlagen geben und die noch verbliebenen
Teile von Burg und Herrschaft nach einem jahrzehntelangen Rechtsstreit
an die Familie Batthyány abgeben.
Der Kampf um das Erbe der Baumkircher
Barbara Baumkircher musste nach dem Tod ihres Onkels jedoch erst
nachweisen, dass die Besitzungen der Baumkircher erkauft und somit nach
ungarischem Recht auch an die weiblichen Linien vererbbar waren. Um
ihre Rechte abzusichern, setzte sie auf männliche Unterstützung. So ist
es zu erklären, dass sie drei weitere Male heiratete. Sie setzte auch
ihre Ehemänner Seifried von Polheim, Veit von Fladnitz und Longinus von
Puchheim als Mitbesitzer ein. Veit von Fladnitz wurde diese Strategie
insofern zum Verhängnis, als er sich 1526 von der Schlacht bei Mohács
fernhielt und trotz Aufforderung des Königs nicht teilnahm. Wegen
Untreue wurde ihm der Prozess gemacht und er seiner Güter für verlustig
erklärt. Der neue König Ferdinand I. übertrug deshalb die
Herrschaftsrechte für Schlaining an Franz Batthyány. Fladnitz konnte
jedoch die Besitzeinweisung verhindern. Der Prozess zwischen Batthyány
und den Baumkircher Erben dauerte mehrere Jahre an. Erst nach dem Tod
von Barbaras Tochter Magdalena, verehelichte von Radmannsdorf, konnte
Batthyány die letzten Anteile erwerben.
Von der Wehrburg zur Friedensburg
Die Gründung der Burg Schlaining fiel in eine Zeit, als das ungarische
Königreich im Mongolensturm des Jahres 1241 beinahe untergegangen war.
König Béla IV. förderte den allgemeinen Burgenbau zur Sicherung seines
Reichs. Der Adelige Heinrich II. von Güns-Güssing errichtete eine
dieser neuen Wehrburgen auf dem Schlaininger Felssporn und konnte damit
das Tauchental kontrollieren. Im Laufe der Jahrhunderte wechselte die
Burg oftmals ihre Besitzer, wurde vor allem unter den Familien
Baumkircher und Batthyány großzügig ausgebaut als auch erweitert und
verlor letztendlich ihre Funktion als Verteidigungsanlage und
Herrschaftszentrum. Vom 19. zum 20. Jahrhundert wandelte sie sich von
einem Wohnsitz über ein Gefangenenlager bis hin zu einer musealen und
öffentlichen Einrichtung, die sich letztendlich stark der
Friedensarbeit verschrieben hat. Aus der Wehrburg Zloynuk wurde die
Friedensburg Schlaining.

Rund 800 Jahre Burg Schlaining
Während Andreas Baumkircher Stadt und Kloster neu gründete, setzte er
für den Bau der Burg zwar wesentliche Akzente, doch gehen bei weitem
nicht alle Baukörper der Anlage auf seine Zeit zurück. Deren
vielschichtiger Entstehungsprozess kann in diesem Ausstellungsraum auf
mehreren Ebenen nachvollzogen werden. Die drei Modelle der Burg um
1300, um 1500 und um 1900 vermitteln einen Überblick über die Genese
der Anlage, das fliegende Modell im benachbarten Rondell gibt Einblick
in das Innenleben der Burg, die Digitalstation verschafft einen
Tiefblick in die neun Hauptbauphasen der Burg sowie ihre künstlerische
und handwerkliche Ausstattung, während der Film einen über die
Jahrhunderte kontinuierlichen Rundblick auf die Anlage mit ihren neu
errichteten und wieder abgekommenen Bauteilen gewährt. Über die
Wohnkultur auf der Burg legen archäologische Fundstücke beredtes
Zeugnis ab.

Burg Schlaining - um 1300
Burg Schlaining geht auf ein „Festes Haus" der Familie Héder aus dem
frühen 13. Jahrhundert zurück. Infolge des Mongolensturms des Jahres
1241 errichtete man zusätzlich einen Bergfried, der eine wesentliche
Steigerung der Verteidigungsfähigkeit brachte, sowie einen durchgehend
gemauerten Bering um die Kernburg. Nach der Güssinger Fehde 1289
erhielt auch die Vorburg einen Bering, der teilweise einen
außenliegenden Wehrgang aufwies. Gleichzeitig wurde das „Feste Haus"
abgebrochen, an seiner Stelle eine für den Fall einer Belagerung
lebensnotwendige Zisterne geschaffen und ein neuer Palas errichtet. Der
Bergfried ist im Modell als Baustelle nach den Zerstörungen von 1289
dargestellt.
Burg Schlaining - um 1500
Der für Schlaining wohl wichtigste Bauherr, Andreas Baumkircher, baute
die Burg massiv aus und vollzog damit die für die Zeit so typische
Wandlung zu einem wehrhaften Schloss, einem „gslos". Mit einzelnen
Baumaßnahmen wurde die Burg des 13. Jahrhunderts gegen die
Waffentechnik des 15. Jahrhunderts gesichert (Bastionen, Rondell, neuer
Bergfried, breiter Zwinger) und gleichzeitig ein neuer Palas mit einer
künstlerisch hochwertigen Ausstattung und gehobenem Wohnkomfort
(Festräume, Schatzkammer, Studierzimmer) geschaffen. Singulär ist das
sogenannte Baumkirchermonument, das ursprünglich vermutlich als
Wächterfigur am Tor der Vorburg angebracht gewesen ist (heute seitlich
des Tors der Kernburg).
Burg Schlaining – um 1900
Unter der Familie Batthyány wurde die Burg intensiv ausgebaut, indem
die Kubatur der Innenräume durch Aufstockungen und Zubauten deutlich
vergrößert wurde. Wandmalereien und Stuckausstattungen liefern
Zeugnisse für die renaissancezeitliche und barocke Wohnkultur. Auch das
äußere Erscheinungsbild wurde durch die Erhöhung des Südturms, die
Errichtung des äußeren Torbaus und der Brücke über den Graben in ihrem
Anspruch, den Status der Familie Batthyány zu repräsentieren, mehrfach
gesteigert. Die fortifikatorische Stärke der Anlage wurde zuzeiten der
Türkenkriege ausgebaut, danach jedoch geschwächt und damit das heutige
Bild der Burg geschaffen.

Das Erdgeschoß des Palas
Das Erdgeschoß des von Andreas Baumkircher ab 1463/64 errichteten Palas
ist seit der Anhebung des Bodenniveaus im Innenhof in der Mitte des 16.
Jahrhunderts ein Souterrainraum. An seiner West-, Nord- und Ostwand
blieben Mauerabschnitte von zwei unterschiedlichen Vorgängerbauten des
13. Jahrhunderts erhalten, die in den Neubau einbezogen wurden. Zu
Baumkirchers Zeit war der damals noch ungeteilte, mit einer Holzdecke
überspannte Raum vom Innenhof über einen Zugang südlich der heutigen
Eingangstreppe zu erreichen. Das Gewölbe wurde erst um 1586 über einem
Freipfeiler und Wandpfeilern errichtet, die vor den älteren Außenmauern
stehen und diese damit nicht belasten. Der Bodenbelag bestand ehemals
entweder aus Steinplatten oder aus gebrannten Ziegeln. Die
ursprüngliche Funktion des Saals ist zwar nicht überliefert, doch
könnte er wie im Burgenbau dieser Zeit üblich als Dürnitz (Speise- und
Gemeinschaftsraum) gedient haben. Im Süden wurde der Saal durch eine
Mauer von einem zweigeschoßigen Kellerraum getrennt, der einen eigenen
Zugang vom Innenhof besaß und als kühler Lagerraum für Lebensmittel
genutzt werden konnte.
NACHBAU DER WALLARMBRUST VON ANDREAS BAUMKIRCHER
ARMBRUSTBOLZEN (NACHBAU)
WINDE ZUM SPANNEN DER ARMBRUST (NACHBAU)
Alle Nachbauten wurden von Andreas Bichler angefertigt.

Was blieb von der Familie Baumkircher?
Die Familie Baumkircher war beinahe ein Jahrhundert im Besitz der Burg
Schlaining. Ihr Verdienst ist heute am deutlichsten in der Stadt selbst
und der Burg sichtbar. Im Burgbereich geben einige Stellen direkt
Einblick in die spätmittelalterliche Ausgestaltung. Vieles wurde durch
die anschließenden Jahrhunderte der Batthyány-Herrschaft wortwörtlich
übertüncht. Dennoch geben kleinere, im Boden des Burgbereichs zu Tage
geförderte Artefakte Hinweise auf das Leben der Menschen auf der Burg.
Meist ist es Gebrauchskeramik, die sie in der Küche ebenso verwendeten
wie bei Tisch. Tontöpfe dienten zum Kochen und als Vorratsgefäße,
Trinkbecher aus Ton waren das Alltagstrinkgeschirr sowohl an der Tafel
des Burgherrn als auch am Gesindetisch. Das Fragment eines Gusstiegels
aus Ton verweist auf den Bergbau um Schlaining und die Verarbeitung der
daraus gewonnenen Metalle. Die Produktion der Keramik dürfte ebenso in
der Nähe der Burg angesiedelt gewesen sein. Das eindrucksvollste Relikt
ist jedoch das Relief des Andreas Baumkircher am inneren Burgtor, mit
dem ihm ein immerwährendes Denkmal gesetzt wurde.

WAHLPLAKAT ZUR VOLKSABSTIMMUNG: „BURGENLÄNDER, ÖDENBURGER WEHRT EUCH
GEGEN DIE WIRTSCHAFTLICHE ABSCHNÜRUNG! SIE IST EUER UNTERGANG"
VERGRÖSSERTE POSTKARTE ZUR VOLKSABSTIMMUNG IN SOPRON/ÖDENBURG (PRO ÖSTERREICH) / 1921

Burgenland-Hymne
Text von Gustav Tintner, Musik von Rudolf Zechmeister
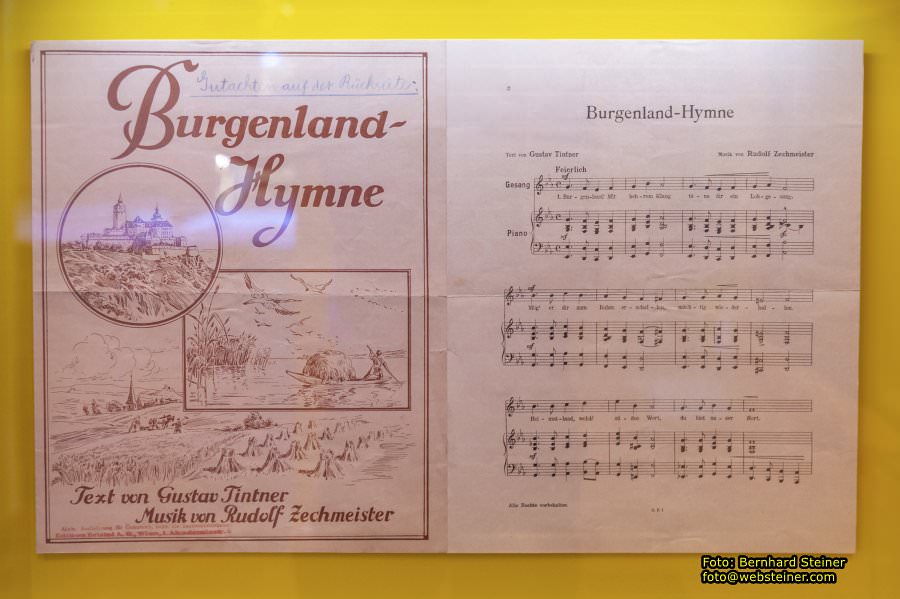
Identität suchen
Bei seiner Entstehung war das Burgenland kein einheitliches Gefüge. Es
gab kaum Straßen, die den Norden mit dem Süden verbanden und kein
geographisches Zentrum in dem schmalen Landstreifen. Auch die Menschen
entwickelten erst nach und nach ein „Burgenland-Bewusstsein". Die
Landessymbole wie das Landeswappen, die Landeshymne, der Landespatron
und der Landesfeiertag entstanden aus dem Wunsch nach einer
burgenländischen Identität. Sie repräsentieren die Zusammengehörigkeit
nach innen und außen. Heute können wir von einem Burgenland-Gefühl in
der Bevölkerung ausgehen. Die Volksgruppen des Burgenlandes
unterscheiden sich in ihren Alltagsroutinen als auch in ihrer Kleidung
kaum. Sprache, Tracht, Musik, Brauchtum sind Zeichen mehrfacher
Identitäten. So lässt sich die Gemeinsamkeit in der Vielfalt als das
burgenländische Identitätsmerkmal beschreiben.

Das Burgenland in 9 Einblicken
1921 hat das Burgenland in vielen Bereichen des Lebens einen Neustart
vollzogen. In den ersten 100 Jahren seines Bestehens konnte durch das
Engagement und den Willen der Burgenländerinnen und Burgenländer ein
Aufholprozess in Gang gesetzt und verwirklicht werden. Im Bildungs- und
Gesundheitswesen sowie in der Kultur lag das Burgenland zu Beginn
abgeschlagen im Reigen der österreichischen Bundesländer. Der Tourismus
steckte noch in seinen Kinderschuhen. Industrie, Landwirtschaft,
Weinbau waren kleinstrukturiert mit großen Wettbewerbsnachteilen. In
mehreren Etappen von Rückschlägen und äußeren Einflüssen begleitet
wurden diese Bereiche weiterentwickelt. Das Sicherheitswesen konnte
ständig den technischen Errungenschaften angepasst werden. Eine neue
Sicht auf Natur und Umwelt führte zu einer Neubewertung dieser
Lebensbereiche als Erholungs- und Schutzgebiet. Der allgemeine
gesellschaftliche Wandel hat zu einem veränderten Freizeitverhalten mit
intensiven Sport- und Vereinsleben geführt.

Verfolgt, vertrieben, vernichtet
Unmittelbar nach der nationalsozialistischen Machtübernahme im
Burgenland setzten brutaler Terror und Verfolgung ein. Die
Nationalsozialisten vertrieben, verhafteten und ermordeten tausende
Burgenländerinnen und Burgenländer - allein aufgrund ihres Glaubens,
ihrer Herkunft, ihrer Sexualität oder ihrer politischen Gesinnung. Die
mit Abstand größte Opfergruppe ist jene der Romnija und Roma.
Ausgewählte Biographien der Opfer sollen ihre Schicksale eindrücklich
schildern und unser Bewusstsein für bedrohliche Gefahren Tag für Tag
schärfen. Die jahrzehntelang ausgeblendete Rolle der Täter wird näher
beleuchtet und wir zeigen ihre Verantwortung im NS-Terrorsystem
deutlich auf. Das Burgenland verfügte mit 15.161
NSDAP-Parteimitgliedern (5,8% der Bevölkerung) über eine der geringsten
Organisierungsraten der Partei in Österreich. Nach Kriegsende wurden
rund 1.100 Burgenländerinnen und Burgenländer wegen ihrer Vergehen
während der NS-Zeit verhaftet und gegen 876 Personen wurden
Volksgerichtsverfahren eingeleitet, 196 Prozesse (22%) führten zu
Verurteilungen.
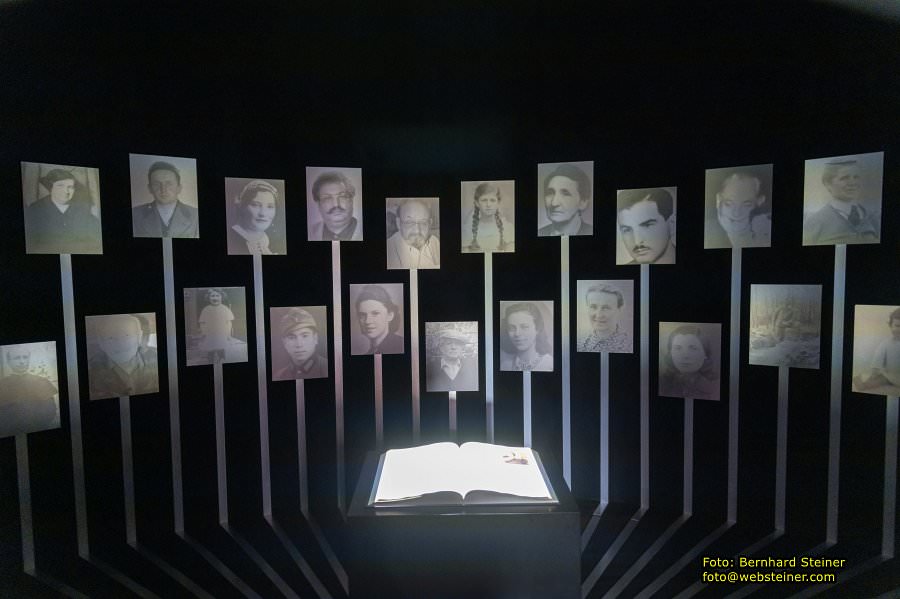
Das NS-Terrorsystem
Das Terrorsystem des NS-Staates wurde maßgeblich bestimmt durch das
Zusammenspiel der örtlichen NSDAP-Stellen mit der Gestapo, dem
Sicherheitsdienst der SS (SD), der Kriminalpolizei und der lokalen
Gendarmerie. "Vorbereitung zum Hochverrat", Vergehen nach dem
"Heimtücke Gesetz" und "Wehrkraftzersetzung" waren die häufigsten
Delikte, die zur Hinrichtung von Burgenländern und Burgenländerinnen
führten. Der NS-Staat bestrafte aber auch "Fahnenflucht" im Rahmen von
Standrechtsverfahren der Feldgendarmerie mit dem Tode. Nach den
Aufzeichnungen des Dokumentationsarchivs des österreichischen
Widerstandes wurden 512 Burgenländerinnen und Burgenländer Opfer von
politischen Verfolgungsmaßnahmen. 130 Personen aus dem Burgenland
wurden aufgrund von Widerstandstätigkeiten hingerichtet oder kamen
infolge von Misshandlungen oder katastrophalen Lebensumständen in
Konzentrationslagern zu Tode. Davon wurden 25 Männer und Frauen aus dem
Burgenland im Rahmen von Volksgerichtshofprozessen zum Tode verurteilt
und im Landesgericht Wien hingerichtet.
Dunkle Jahre - Von Tätern und Gerechten
Die Jahre 1938 bis 1945 gelten auch im Burgenland als das dunkelste
Kapitel der Geschichte. Die Sonderausstellung beleuchtet die Zeit des
Nationalsozialismus und die Schicksale der Menschen jener Epoche. Im
Mittelpunkt stehen Biografien von Tätern und Gerechten, die
eindrucksvoll das menschliche Handeln in diesen Jahren darstellen. Ein
Teil der Ausstellung widmet sich dem Rechtsextremismus und
Antisemitismus in der Gegenwart.
Der nationalsozialistische Terror im Burgenland dauerte vom 11. März
1938 bis 8. Mai 1945. Diese mehr als sieben Jahre stellen das dunkelste
Kapitel unserer Geschichte dar. Die Ausstellung „Dunkle Jahre. Von
Tätern und Gerechten.“ erzählt von Menschen, die sich in diesen Jahren
dem NS-Regime anpassten, sich an der Not anderer bereicherten, sie
misshandelten, verfolgten oder sogar ermordeten. Die Ausstellung
erzählt aber auch von denjenigen, die sich dem NSSystem nicht
unterordnen wollten, die Widerstand leisteten, Verfolgten halfen und
sich dabei selbst in Gefahr brachten. Diese Menschen handelten nach
ihrem individuellen Wertekompass. Manchmal widersetzen sich die
vorgestellten Biografien der eindeutigen Einordnung in die Kategorien
der TäterInnen oder Widerständigen. Auch auf diese Graubereiche möchte
die Ausstellung den Blick lenken und Uneindeutigkeiten thematisieren.
Aber die Schau richtet den Blick auch in die Gegenwart, eine
abschließende Medienstation dient der Darstellung dem Themenfeldes
Rechtsextremismus heute.

Täterschaft hat viele Gesichter
Die in diesem Ausstellungsteil beschriebenen Personen hatten einen
persönlichen Bezug zum Burgenland, weil sie hier zur Welt kamen oder
beruflich tätig waren. Viele von ihnen machten in NS-Staat Karrieren.
Sie waren Verhetzer, Schreibtischtäter, Denunzianten, Polterer - ja
sogar Mörder. Männer und Frauen dienten freiwillig und mit Überzeugung
einem grausamen und menschenverachtenden System. Ihre Opfer waren
Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen, Juden und Jüdinnen, Roma und
Romnija, Menschen mit körperlichen und geistigen Einschränkungen,
KZ-Häftlinge, Kommunisten und Kommunistinnen, Kriegsgefangene...
Nicht alle Täter und Täterinnen mussten nach dem Krieg für ihre
Verbrechen Verantwortung übernehmen. Zuständig für die Ahndung von
Kriegsverbrechen waren die österreichischen Volksgerichte. Diese
handelten in den Jahren zwischen 1945 und 1955 ca. 20.000 Fälle ab und
fällten 23.477 Urteile, davon 13.607 Schuldsprüche und 43 Todesurteile.
30 Todesurteile wurden tatsächlich vollstreckt. Eine Vielzahl dieser
Strafprozesse befasste sich mit den im Burgenland begangenen
Endphaseverbrechen, mit den Verbrechen in Konzentrationslagern und
Haftanstalten sowie mit den Massenmorden in den Euthanasiestationen.
Viele der Angeklagten argumentierten bei ihren Gerichtsverfahren damit,
nur "Befehle" ausgeführt zu haben und wiesen jegliche persönliche
Verantwortung für ihre Taten von sich. Tatsächlich ist jedoch kein Fall
dokumentiert, wonach die Nichtbefolgung eines verbrecherischen Befehls
schwerwiegende persönliche Konsequenzen nach sich gezogen hätte. Die
Lebensgeschichten analysieren das soziale Milieu der Täter und
Täterinnen, beschreiben ihre Verbrechen und befassen sich mit ihren
Schicksalen nach Ende den Kriegen. Dabei zeigt sich, dase viele
NS-Täter wieder rasch den Weg in die Mitte der österreichischen
Nachkriegsgesellschaft fanden.
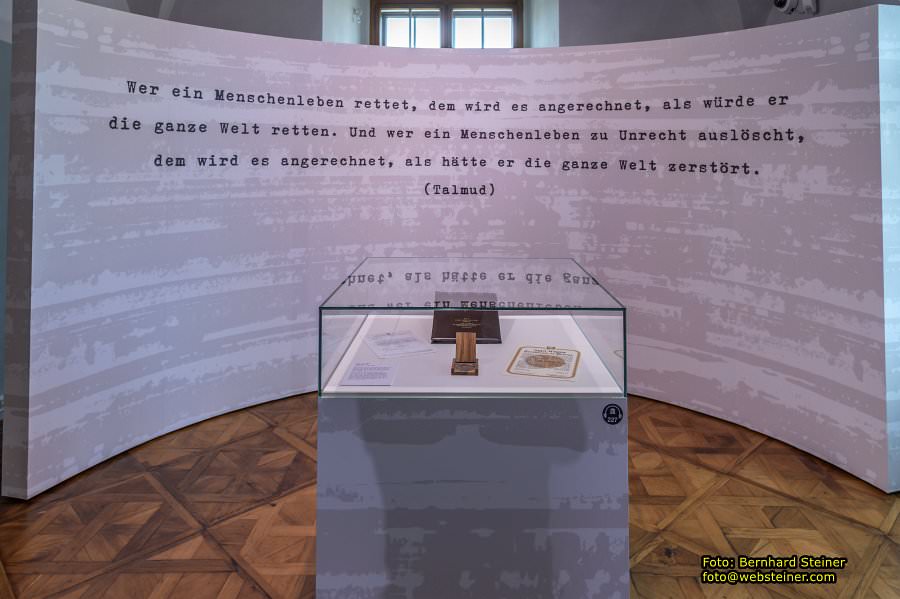
Das 17. Jahrhundert in Schlaining
Adam I. Graf Batthyány (1610-1659) gilt den heute noch lebenden
Batthyánys „als Stammvater der Familie im engeren Sinn". Als Calvinist
erzogen konvertierte er 1629 zum katholischen Glauben, wurde 1630 in
den Grafenstand erhoben sowie zum „wirklichen kaiserlichen Kämmerer"
ernannt. Hauptresidenz Batthyánys war Güssing, 1636 übernahm er auch
die Herrschaft Schlaining. Der Bereich zwischen Palas und Bergfried
wurde damals durch die Erstellung neuer Fußbodenniveaus verändert. Es
entstand ein großer Saal, dessen nördliche Hälfte auf einer
zweiteiligen Pfeilerstellung im Innenhof der Burg ruht, um den Raum
über die Breite des Berings hinausbauen und sie von beiden Seiten
belichten zu können. Der Saal wurde mit einer Stichkappentonne
überspannt, die auf mächtigen Wandpfeilern mit profilierten Kämpfern
steht. Zur Erschließung wurde hofseitig ein neuer Wendeltreppenturm
errichtet.

Die Ausstellung „Schlaining & Frieden“
erstreckt sich über mehrere Räume im dritten Obergeschoss und bietet
einen umfassenden Überblick über die vielfältigen Facetten von
Friedensbildung und -erhaltung. Diese reichen von der bewegenden
Geschichte Sadakos und ihren Kranichen über die friedensbildenden
Methoden bis hin zur globalen Perspektive auf unserer Erde als
gemeinsames Heimatland. Gerald Mader, der Gründer des Schlaininger
Friedenszentrums, vertrat die Überzeugung, dass Friedens-Visionen nicht
nur notwendig, sondern auch realistisch sind. Dieser Raum erzählt von
den Anfängen des Friedenszentrums in den 1980er Jahren, einer Zeit, in
der die Welt vom Kalten Krieg und der ständigen Drohung eines
Atomkriegs geprägt war. Das Friedenszentrum Schlaining hat sich dank
der Initiative von Gerald Mader zu einem Ort entwickelt, an dem
führende Friedensdenker weltweit zusammenkommen. Zusammengefasst bietet
„Schlaining & Frieden“ einen tiefen Einblick in die Komplexität und
Vielfalt von Friedensprozessen und zeigt auf, wie wichtig es ist, dass
jeder von uns aktiv an diesem Firedensprozess beitragen soll.
Die interaktive Ausstellung des ACP (Austrian Centre for Peace) bietet
einen umfassenden Einblick in die Entwicklung und Arbeit der
Friedensbewegung seit den 1970er Jahren bis hin zu den aktuellen
Konflikten unserer Zeit. BesucherInnen können sich intensiv mit den
verschiedenen Aspekten von Frieden, Friedenserziehung und
gesellschaftlich-politischer Partizipation auseinandersetzen.
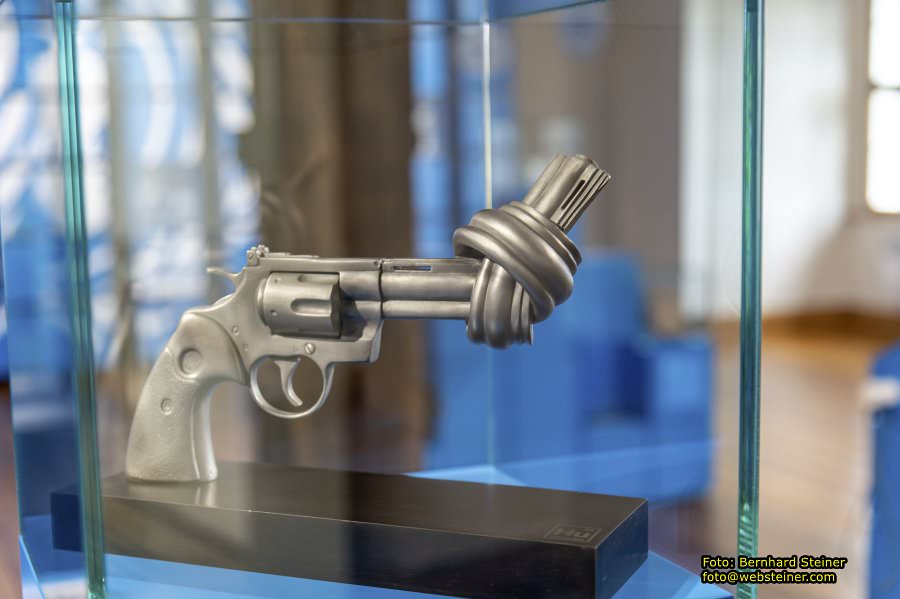
Sadakos Kraniche
6. August 1945: Ein US-amerikanisches Flugzeug wirft über Hiroshima
eine Atombombe ab. Die Folgen sind fatal: 80.000 Menschen sterben
sofort oder wenige Tage darauf. Auch ein kleines Mädchen namens Sadako
wird Zeugin. Zunächst scheint es, als ob sie den Anschlag unbeschwert
überstanden hätte. Doch mit zwölf Jahren erkrankt sie an Leukämie –
eine Spätfolge des Atombomben-Abwurfs. Ihre einzige Hoffnung liegt in
einem alten japanischen Glauben: Wer 1000 Papierkraniche faltet, hat
einen Herzenswunsch frei. So macht sich Sadako daran und faltet Kranich
für Kranich. Doch als die 1000 Kraniche fertig sind, geht es ihr
schlechter als zuvor und letztendlich stirbt sie kurz vor ihrem 13.
Geburtstag. Ihre Familie beschließt, die Kraniche des kleinen Mädchens
hinaus in die Welt zu tragen und mit ihnen die Botschaft des Friedens.
Einer dieser Kraniche wird auf der Friedensburg Schlaining aufbewahrt
und findet sich auch im Logo wieder.
Ich schreibe den Frieden auf eure Flügel.
Und ihr werdet über die ganze Welt fliegen.
SADAKO SASAKI

Der Hof der Kernburg
Der innere Burghof (Schwarzer Hof) geht auf Andreas Baumkircher zurück,
der auf der gegenüberliegenden Seite ab 1463/64 seinen neuen Wohnbau,
den Palas, errichten ließ. Das mittelalterliche Erd- sowie 1. und 2.
Obergeschoß werden heute als Halbkeller, Erd- und 1. Obergeschoß.
wahrgenommen, da der Boden im Innenhof im 16. Jahrhundert angehoben
wurde. In den drei von Baumkircher erbauten Geschoßen entstand je ein
großer Raum, der jeweils über Kreuzstockfenster belichtet und über
einen an der Fassade liegenden hölzernen Gang erschlossen wurde. Die
Außengänge mündeten links in einen ursprünglich breiteren Treppenturm.
Bei einem Umbau im 16. Jahrhundert wurden die Türen auf die Außengänge
durch Fenster ersetzt. Der Palas wurde dabei um ein Geschoß aufgestockt
und erhielt neue, schwarz gefasste, für den Hof namensgebende
Fensterrahmen. An den Treppenturm schließt im Norden und Westen die
über 6 m breite Umfassungsmauer, der Bering, an, der seit dem 17.
Jahrhundert als Rückwand für einen Gang dient, der auf hohen Bögen
erbaut wurde und in einen neu errichteten Treppenturm vor dem Bergfried
mündete. Bereits im 16. Jahrhundert wurde der Bering mit Wohnräumen im
zweiten Obergeschoß überbaut.

Im Zuge der Sanierungsarbeiten im Sommer 2020 wurden Fragmente einer
spätmittelalterlichen Wandgestaltung an der Ostwand des heutigen
Treppenhauses freigelegt. Zutage traten im oberen Teil Rankenmalerei,
die nach unten mit einem schwarzen Strich abgeschlossen ist, und im
unteren Teil zwei einander zugewandte Pferde, von denen links der
Vorderkörper und Reste eines Reiters (Arm) sowie rechts ein Kopf
erhalten sind. Möglicherweise handelt es sich dabei um die Reste einer
Schlachtenszene. Diese hochwertige freskale Ausstattung an einem
Geschoßpodest des mittelalterlichen Treppenturms steht in Zusammenhang
mit einem turmartigen Bauteil, der damals nördlich des Treppenhauses
neu entstand und etwas später ebenfalls malerisch ausgestaltet wurde.
Hier dürfte sich jener Raum befunden haben (Gewölbe im Turm), in dem
1539 nachweislich Urkunden und Kleinodien untergebracht waren.

Das Baumkircher-Monument
Neben dem Eingang zur Kernburg sind in die Mauer eine Bauinschrift
sowie das Relief eines Ritters eingelassen. Die Inschrift besagt: Nos
Andreas Pemkircher de Zolo / nok Comes posonien [sis] hoc magnificu[m]
/opus fortissimor[um] muroru [m] erig[i] feci / mus Inceptu[m] Anno dni
M / CCCCL/1450 (Wir Andreas Baumkircher von Schlaining, Burggraf zu
Pressburg, haben veranlasst, dass dieses großartige Werk mächtiger
Mauern errichtet wird, begonnen im Jahr 1450). Darüber steht eine
ritterliche Figur in Rüstung mit Schild und Fahne jeweils mit dem
sprechenden Wappen der Baumkircher, einem Kirchengebäude. Gesichert
ist, dass Inschrift und Relief hier in Zweitverwendung versetzt sind
und anfänglich nicht übereinander angeordnet waren. Über die
ursprüngliche Funktion und Platzierung herrschten bislang
unterschiedliche Meinungen. Nach neuesten Forschungen könnte es sich um
eine Wächterfigur am Burgtor gehandelt haben, zumal Baumkircher 1450
noch nicht in Besitz, sondern nur Pfandnehmer der landesfürstlichen
Burg war und sich in dieser Funktion im Sinne seiner Heldentat von
Wiener Neustadt als Wahrer der kaiserlichen Macht inszeniert hätte -
Baumkirchers Ruhm basierte darauf, 1452 ein Stadttor von Wiener
Neustadt vor den Feinden Friedrichs III. im Kampf geschlossen zu haben.

Die Bebauung innerhalb der Vorburg
Die Gebäude der Vorburg wurden in allen Jahrhunderten neuen
Bedürfnissen angepasst, wobei man den älteren Baubestand meist nicht
abriss, sondern integrierte. Links sieht man die Innenseite des unter
Andreas Baumkircher 1463/64 verstärkten Berings der Vorburg, der mit
fast 5 m Mauerstärke bis auf die Höhe des 1. Obergeschoßes
durchgemauert wurde. Erst darüber ließ der Bauherr ein zweites
Obergeschoß mit Innenräumen errichten. Auf Hofniveau entstanden kleine
Nischen. Seit der Mitte des 16. Jahrhunderts verstellt ein
zweigeschoßiges Gebäude die südliche Hälfte des Berings und den Zugang
zum Glockenturm. Rechts vom inneren Burgtor entstand ebenfalls in der
Mitte des 16. Jahrhunderts ein zweigeschoßiges Haus, in dessen
Erdgeschoß heute das Kaffeehaus untergebracht ist. In der 1. Hälfte des
18. Jahrhunderts wurde das zweite Obergeschoß aufgestockt. Vom 16. bis
in das frühe 20. Jahrhundert stand auch ein zweigeschoßiges Haus im
Tiefen Graben rechts der Brücke zur Kernburg, das schmale Haus rechts
daneben stammt aus der 1. Hälfte des 18. Jahrhunderts.

Die Glocken
Vom Turm der Vorburg blieb eine Glocke des 15. Jahrhunderts erhalten.
Am Mantel befindet sich ein Relief mit Christus am Kreuz (Astkreuz) mit
den Hll. Maria und Johannes sowie die Inschrift „O rex glorie veni
nobis cum pace, Hilf Got Dv ebgis" [ewig] in Gotischen Minuskeln. Das
im gesamten europäischen Mittelalter häufig auf Glocken wiederkehrende
Gebet König der Herrlichkeit, komm zu uns mit Frieden! könnte sich im
konkreten Fall auf die Eroberung der Burg im Jahr 1445 durch Friedrich
III. und die Hoffnung auf eine zukünftig friedliche Besitznahme durch
den neuen Pfandinhaber Andreas Baumkircher bezogen haben. Im Barock
erhielt der Uhrturm eine weitere Glocke. Signiert mit Martin Feltl hat
mich gegossen in Graz 1755 zeigt sie vier Reliefbilder, die auf Wolken
thronende Madonna mit Kind, den knienden hl. Donatus, Christus am Kreuz
und die Hl. Katharina.

Die Topografie
Die Burg wurde erst unter Andreas Baumkircher in den 1460er Jahren zu
einem Teil der damals neu gegründeten Stadt Schlaining. Bis dahin stand
sie isoliert auf einem Felsen über dem Tauchental (der Tauchenbach
entspringt in Niederösterreich in der Buckligen Welt) und sicherte die
dort verlaufende Verkehrsverbindung, die nach Süden durch die
Vorgängersiedlung der Stadt, das heutige Altschlaining, führte. In
Goberling nördlich der Burg lagen Erzabbaustätten, die ab dem frühen
15. Jahrhundert konsequent ausgebeutet wurden. Die Burg garantierte den
sicheren Abbau der Erze und ihren ungefährdeten Transport in das
südliche Flachland. Dadurch konnte der Erzabbau zum Wohlstand in der
gesamten Region beitragen.

Wem der viele Text zu lange war und lieber Bewegtbilder mit Musik mag,
kann sich gerne dieses Video antun: