web steiner
Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen
Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.
+43/2624/54014 - office@websteiner.com
Krems an der Donau
am Ende der Wachau, Juni 2023
Krems an der Donau ist die fünftgrößte Stadt
Niederösterreichs und liegt als Statutarstadt 70 km westlich von Wien.
Am Ende der Wachau ist sie auch Anfangs- und Endpunkt der Wachaubahn.
Besucht wurde diesmal Dominikanerkirche, museumkrems, Kremser Senf,
Stadtpfarrkirche St. Veit (Dom der Wachau) und Piaristenkirche Unsere
liebe Frau.
Im Zentrum der historischen Altstadt von Krems steht, weithin sichtbar,
das ehemalige Dominikanerkloster, das seit mehr als 130 Jahren das
museumkrems beherbergt. Neben der Dauerpräsentation zu Geschichte,
Kunst und Kultur der Stadt an der Donau werden auch regelmäßig
Sonderausstellungen gezeigt.

Die Dominikanerkirche Krems ist eine ehemalige Klosterkirche der
Dominikaner mit dem Patrozinium Peter und Paul in der Stadt Krems an
der Donau in Niederösterreich. Die Kirche dient seit 2011/2012 der
Landesgalerie für zeitgenössische Kunst für temporäre Ausstellungen im
Sommer.
An das dreischiffige, fünfjochige, Langhaus schließt im Osten der
vierjochige Chor mit 5/8-Schluss an. Die weitgehend schmucklosen
Fassaden zeigen Elemente von der Spätromanik bis zur Gotik. Über dem
Satteldach des Chors erhebt sich ein zierlicher Dachreiter. Das
Mittelschiff ist durch spitzbogige Arkaden zu den niedrigeren
Seitenschiffen geöffnet. Die nach der Profanierung eingezogenen
Zwischendecken und Trennwände wurden bei der Wiederherstellung in den
1960er Jahren entfernt.

Im Herzen der Altstadt von Krems an der Donau liegt das museumkrems –
im denkmalgeschützten Ambiente eines ehemaligen Dominikanerklosters aus
dem 13. Jahrhundert. Zum Museum gehören nicht nur der barocke Innenhof
und die Ordenskirche, sondern auch ein historischer Weinkeller.
In einer permanenten Schau werden Geschichte und Kultur der Donaustadt
gezeigt – bestehend aus umfangreichen Stadt- und Privat-Sammlungen.
Wechselnde Sonderausstellungen laden dabei zu immer neuen
Entdeckungsreisen ein. Mit ausgewählten Exponaten und archäologischen
Funden wird das „Leben mit dem Strom“ präsentiert. Die wirtschaftliche,
künstlerische und soziale Bedeutung der Stadt Krems seit dem
Mittelalter wird lebendig nachgezeichnet. Besondere Bedeutung kommt
dabei dem Kremser Barockmaler Martin Johann Schmidt zu.

STADTWAPPEN 1463
KAISER FRIEDRICH III. VERLEIHT DEN STÄDTEN KREMS UND STEIN DEN DOPPELADLER ALS STADTWAPPEN
WIENER NEUSTADT, 1. APRIL 1463
Als sich die Streitigkeiten zwischen Kaiser Friedrich III. und seinem
Bruder Albrecht VI. um die Nachfolge des 1457 verstorbenen Herzogs
Ladislaus Postumus entzündeten, kündigten die Wiener im Jahr 1462 dem
Kaiser den Gehorsam, was in der Belagerung der kaiserlichen Familie in
der Hofburg gipfelte. Auch Krems und Stein gehörten zunächst zu den
antikaiserlichen Städten, wechselten aber schließlich die Seiten und
unterstützten Friedrich III.
Als Dank erhielt die Doppelstadt 1463 das Recht, einen gekrönten
doppelköpfigen Adler in Wappen und Siegel zu führen und für die
Besiegelung von Urkunden rotes Wachs zu verwenden.

Der Rundgang durch den Kreuzgang des ehemaligen Klosters führt entlang
einer Reihe von eindrucksvollen Skulpturen aus den Sammlungen des
Museums. Sie bieten stilistisch einen zeitlichen Bogen von der Romanik
bis zum Barock. Die erste Figur wird in das 13. Jahrhundert datiert,
ist also rund 700 Jahre alt. Fachleute erkennen in der Kopfbedeckung,
dass sie einen Bischof oder gar den Papst darstellte. Sie stammt ebenso
aus einer Kirche wie alle weiteren Schnitzarbeiten, konkret aus der
Pfarrkirche von Weitra im Waldviertel.
Ein wenig jünger ist die Hl. Muttergottes mit dem Jesuskind, ebenfalls
eine beeindruckende Arbeit aus der Romanik. Der Apfel in der Hand
Mariens gibt Hinweis auf den Sündenfall, noch mehr aber auf die Frucht
ihres Leibes und damit den Sohn Gottes. Die Betrachter des
Mittelalters, meist Gläubige im Gebet, flehten sie wie alle
Heiligendarstellungen als Fürsprecher bei Gott für ihre Sorgen und Nöte
um Hilfe an. Die Künstler hatten sie in mühevoller Arbeit mit
einfachstem Werkzeug zum Lob Gottes und der Schöpfung, manchmal auch
zur Ermahnung der Gläubigen, geschaffen. Sie bewiesen für ihre Zeit
große Kunstfertigkeit und hohes Talent.
Die Art der Darstellung verändert sich im Laufe der Jahrhunderte. Neben
stilistischen Veränderungen sind auch theologische Einflüsse deutlich
zu erkennen. Beides - die steigende Kunstfertigkeit der Holzschnitzer
und die kirchliche Auslegung der dargestellten Figur und ihrer
Heilsgeschichte - führten dazu, dass sich der zunächst entrückt
wirkende Heilige oder der Gottessohn immer direkter an den Betrachter
wandte. Die Christusfigur am Ende des östlichen Kreuzganges ist 100
Jahre jünger als die erste Skulptur. Christus blickt auf die Gläubigen
und zeigt seine Wunden, wobei der Körper noch durch ein großes,
fließendes Tuch umhüllt ist. Sein Leiden als Mensch wird in der Kunst
immer stärker betont.

VENUS VOM GALGENBERG, Genannt „Fanny", Kreuzgang
ÄLTESTE VENUSSTATUETTE ÖSTERREICHS - Replik
Alter: über 32.000 Jahre, Größe: 7,2 cm, Gewicht: 10 Gramm
Am 7. Dezember 1988 wurde auf einer Pressekonferenz erstmals eine
kleine, unscheinbare Statuette präsentiert, die vor über 32.000 Jahren
geschaffen worden ist. Die nach der Tänzerin Fanny Elßler benannte,
„Fanny vom Galgenberg" ist nicht nur das bisher älteste Kunstwerk
Österreichs, sie ist weltweit als weibliche Plastik des Aurignacien
einmalig. Gefunden wurde sie in einem Ortsteil von Krems, in Rehberg.
Die Archäologen hatten auf dem Galgenberg zwischen Rehberg und der
Gemeinde Stratzing eine Lagerstelle von Eiszeitjägern entdeckt, die
unter anderem diesen Schatz freigab.
Zwischen Steingeräten und Knochensplittern fanden die Wissenschaftler
unter Leitung von Christine Neugebauer-Maresch acht Schieferstückchen,
die sie in akribischer Kleinarbeit zu der Frauenfigur zusammenfügen
konnten. An der Rückseite sind Reste einer Vorzeichnung zu erkennen.
Der rechte Arm scheint einen stabförmigen Gegenstand zu halten, an der
linken Körperseite sind ein gehobener Arm und die linke Brust in
Seitenansicht zu erkennen. Der Kopf ist leicht zur rechten Seite
geneigt. Das Spitzoval als Gravur und die Ausnehmung zwischen den
Beinen lassen an ein Vaginasymbol denken so die erklärenden
Interpretationen der Archäologen, die damit die Plastik in die Reihe
der Venusstatuetten aufnahmen. Die „Fanny vom Galgenberg" ist damit dem
kultisch-religiösen Bereich zuzuordnen, ebenso wie die viel jüngere
„Venus von Willendorf", die bekannte Kalksteinfigur aus der Wachau. Die
Originale beider Venusdarstellungen werden im Naturhistorischen Museum
in Wien in einem eigenen „Venuskabinett" präsentiert.
Zentrum der Altsteinzeitforschung: Das Alter der Stadt Krems und ihrer
Ortsteile ist mit diesem Fund natürlich noch nicht festzulegen: Die
altsteinzeitlichen Nomaden gaben ihren Lagerplatz über dem Kremsfluss
wieder auf und zogen weiter. Vier große altsteinzeitliche Fundstätten
sind bisher auf dem Stadtgebiet von Krems entdeckt worden, neben dem
Galgenberg sind dies der Hundssteig, der Wachtberg und die Ziegelei
Stein. In den Depots des museumkrems lagern über 70.000 Fundstücke,
darunter auch bemerkenswerte Tierknochenmaterialien wie die Reste eines
Mammuts und seltene paläolithische Tierfigürchen aus Lehm. Der Raum
Krems zählt damit zu den bedeutendsten Zentren der
Altsteinzeitforschung in Österreich. Die Archäologen sprechen ihm einen
Rang zu, der mit dem kunstgeschichtlichen und dem auf dem Gebiet der
Altstadterhaltung und des Denkmalschutzes durchaus vergleichbar ist.
Fanny vom Galgenberg, 30.000 v. Chr. Kopie, H 7,3 cm

Thronende Muttergottes mit Jesuskind, 2.H. 13.Jh./Holz, H 93 cm

DONAUBRÜCKE 1463
KAISER FRIEDRICH BEWILLIGT DEN STÄDTEN KREMS UND STEIN DEN BAU EINER NEUEN BRÜCKE ÜBER DIE DONAU
17. JUNI 1463
...daz sy daselbs zu Krembs oder
Stain, zwischen beden Steten oder wo in das an denselben ennden am
pesten fuget, ain prugken uber die Tunaw von newem zurichten und slahen
und die hinfur mit meutten, prugkrechten und allen anndern freyhaiten,
rechten und gerechtikaiten inmassen als die Tunawprugk daselbs zu Wienn
gehalten wirdet, haben und halten sullen ...
Die Erlaubnis des österreichischen Landesfürsten, Friedrich III., eine
Brücke über die Donau zu errichten, stellte einen wichtigen Meilenstein
im Ausbau der überregionalen Verkehrsverbindungen dar. Die konkrete
Umsetzung, sowohl was die Positionierung der Brückenköpfe als auch die
technische Ausführung betraf, oblag den beiden Städten Krems und Stein.
Die Brücke selbst wurde wohl erst gegen Ende des 15. Jahrhunderts
errichtet.

Weinbau als Wirtschaftsmotor
Der Weinbau war der Anlass und Motor für die intensive Erschließung der
Wachau Am Ende des Wettlaufes um die begehrten Flächen hatten über 50
Klöster hier ihre Lesehöfe. Sie exportierten den Wein mit Schiffen die
Donau aufwärts. Als Gegenfuhren kamen wertvolle Handelswaren wie Eisen,
Salz und bald auch Luxusgüter nach Krems-Stein, dem urbanen Zentrum der
Region. Der Wirtschaftsboom lockte viele Handwerker hierher. Sie
betrieben bald erfolgreich die Werkstätten in Krems und Stein. Die hier
ansässigen Meisterbetriebe waren weit über die Region hinaus angesehen.
So kam es, dass Handwerksverbände, sogenannte Innungen, aus weiten
Teilen des heutigen Niederösterreich hier ihre jährlichen Treffen
abhielten und ihre Zunftladen aufbewahrten. In den Truhen wurden die
Urkunden, Privilegien und Siegel verschlossen. Die traditionellen
Zunfttreffen dienten vor allem der Festlegung der Preise und Löhne für
das kommende Jahr.
Beispielhaft für die Handwerke sind die Insignien der Fassbinder
ausgestellt. Das Holzfass war der ideale Transportcontainer des
Mittelalters. Nicht nur Wein, sondern auch Salz, Eisen, Stoffe, sogar
Bücher wurden in Fässern verstaut. Fasszieher zogen sie mit Pferden
oder mit Manneskraft zu den Schiffen, die schwer beladen ankamen und
ebenso schwer beladen Krems wieder verließen. Die Holzfässer schwemmten
- auch das war ein Vorteil - so manche Ladung nach einem Schiffsunglück
an das rettende Ufer. Die mächtige Baumpresse wurde um 1930 in das
ehemalige Weinbaumuseum im Kloster gebracht. Sie wurde als reines
Schaustück aufgestellt und konnte hier nicht betrieben werden. Das
historische Filmdokument „Weinbau unter dem Hüterstern" aus 1943 zeigt
die mühevolle Weinlese in den Weinbergen bei Dürnstein und die Arbeit
der Hüter. Beeindruckend daran sind auch im Gegensatz zu manchen
Textpassagen die Kameraführung und die Lichtstimmung.

Zunftlade der Faßbindergesellen, 17. Jh./Holz, 60 x 57,5 x 38 cm

Das Dominikanerkloster beherbergte zeitweise neben den Mönchen eine
Vielzahl von Mitbewohnern und Gästen, die alle versorgt werden mussten.
Dementsprechend groß war der Bedarf an Wirtschaftsräumen für die
Insassen der großen Klosteranlage. Die Raumgruppen im Westen und Norden
des Kreuzganges wurden bis heute nicht auf ihre ursprünglichen
Funktionen im Mittelalter untersucht. Die Klosterküche, die Vorrats-
und andere Wirtschafträume waren unter anderem hier untergebracht. Im
Nordostbereich des Kreuzganges neben den Stiegen bei den Freskenresten
findet man bei genauem Hinsehen die Spuren eines heute vermauerten
Tores. Hier wurden die umfangreichen Mengen an Traubenmost in Bottichen
und Fässern in den Kreuzgang und zu den Kellerabgängen transportiert.

Kruzifixus aus Sandstein, 18. Jh.

Schmerz und Erlösung
Die Betrachter waren zutiefst irritiert, man könnte fast vermuten
geschockt von der drastischen Darstellung des Leidens in der Skulptur
„Christus als Schmerzensmann" (um 1490). Die künstlerische Umsetzung
der beeindruckenden Figur war neu. Der Sohn Gottes wurde für den
Betrachter zum leidenden Menschen. Die ganze Grausamkeit der
Misshandlungen Christi wurde als Ausdruck der Frömmigkeit des
Spatmittelalters gezeigt. Nicht mehr die spirituelle Betrachtung von
Kreuzestod und Auferstehung stand im Zentrum der Darstellung, sondern
das bittere Leiden Jesu.
Der unbekannte Künstler schaffte es, die Schmerzen
der gesamten Passion in seinem Werk zu verdeutlichen. Dargestellt ist
der Leichnam, der gleichsam zum Leben erweckt wird, mit all seinen
Leidensmalen Dornenkrone und die Wunden ziehen den Blick der Betrachter
auf sich. Es entsteht der Eindruck, die bleiche in sich gewundene
Gestalt zeigt ihre Wunden in verklarter Agonie Schmerz und Erlösung
liegen in der ausdrucksstarken Arbeit des unbekannten Künstlers nahe
beieinander.
Die nun folgenden Skulpturen beginnend mit Johannes den Täufer (um
1500) führen stilistisch durch die Darstellungsformen der Gotik. Ganz
im Gegensatz zur Figur des Schmerzensmannes prasentiert die Darstellung
der Hl. Margarethe auf dem Drachen (um 1510) eine modisch gekleidete,
über das Böse triumphierende Frau. Die Hl. Barbara stammt aus einer
Werkstatt des Alpenlandes. Sie offenbart ebenso wie die Hl. Anna
Selbtritt eine enge Verbindung zum bäuerlichen Leben, wobei sie an
Stelle des üblichen Apfels eine schwarze Traube reicht vermutlich als
Hinweis auf die Region und auch die enge Verbindung von Wein und dem
Blut Gottes in der Eucharistie des Mittelalters.

Wir stehen hier im Nordflügel des Klosters. Von hier aus führt ein
enger, 500 Jahre alter Stiegenabgang in die historischen Klosterkeller.
Bei einer bauhistorischen Befundung aus Anlass des Umbaues 1995 wurde
er in das 16. Jahrhundert datiert. Die Weinkeller wurden etwa 200 Jahre
nach der Errichtung des Klosters wie Stollen unterirdisch eingebaut.
Die alten Klosterkeller faszinieren durch ihre enormen Ausmaße. Nur ein
Teil davon ist heute dem museumkrems angeschlossen und öffentlich
zugänglich. Auch aus zwei weiteren Klosterräumen um den Kreuzgang gibt
es Abgänge in die Kelleranlagen, die es den Mönchen erleichterten, zu
den Weinfässern zu kommen. Sie mussten den Traubenmost bis zur Reife
des Weines intensiv betreuen und suchten wohl auch den raschen Zugang
vom Speisesaal aus.

Die Hüter des Weines
Der mittlerweile verschwundene Beruf des Weingartenhüters ist für Krems
erstmals um 1340 urkundlich fassbar. Ihre Aufgabe war es, die
Weingärten beim Reifen der Trauben im August zu „schließen" und bis zu
Martini versperrt zu halten. Im Rahmen einer feierlichen Zeremonie
wurde dabei dem Ortsvorsteher der Schlüssel zu den Weingärten
übergeben. Weithin sichtbare „Hutsäulen" mit Disteln, Strohkreuzen oder
kunstvollen Sternen signalisierten das Verbot für Fremde, die
Weingärten zu betreten. Eher symbolisch gemeinte Waffen unterstrichen
die Gewalt der Hüter.
„Der süße Wein" und „der Saure Wein", so nannte Josef Kinzel seine
beiden Porträts, in denen er einen Weinverkoster gekonnt karikierte.
Der Weinliebhaber, der ihm als Vorbild diente, ist unbekannt. Wilhelm
Gause dagegen hat einen Steiner Bürger im Kreise seiner Familie
dargestellt, der in einer Art Abendmahlszene den Wein segnet. Dominik
Kottula wiederum zeigt eine Männergruppe bei der hohen Kunst" der
Weinverkostung, sozusagen als Hüter des guten Geschmackes.


Hüterstern, 1913/Holz, Glasperlen, Dm. 99 cm
2 Weingartenschlüssel, 1935, 1937/Holz, 101 cm, 96 cm

Heurigenanzeiger, 17. Jh./Stroh und Eisenblech, Dm.79 cm

Die Wachau wurde durch den Fund der Venus von Willendorf als Zentrum
der österreichischen Altstein-zeitforschung bekannt. Auch im engeren
Raum von Krems belegen eine Vielzahl von Funden Siedlungen aus der Zeit
der Urgeschichte. Nur ausgewählte Einzelstücke werden in den beiden
Vitrinen gezeigt, sie weisen auf Umfang und Bedeutung der Sammlungen
des WEINSTADTmuseums hin. Die Bodenvitrine zeigt die bekannten
Fundplätze.

Ende des ersten Jahrhunderts nach Christus errichteten die römischen
Soldaten aus Erde und Holz ein Kastell am Ausgang der Wachau, das sie
bald zu einem Steinkastell ausbauten. Es war zirka 180 mal 240 Meter
groß und ein wesentlicher Stützpunkt im Rahmen des Limes, der
Nordgrenze entlang der Donau. In der "Vita Severini" wird es als
"FAVIANIS" genannt, es stand auf dem Boden des heutigen Mautern.

Slawische Gräber, 9. Jhdt., Stein / Flur Altenburg




Die Räume westlich des Kreuzganges dienten unter anderem als
Refektorium und Kapitelsaal. Das Refektorium war der Speisesaal für die
Mönche und die Mitbewohner des Klosters. Auch dieser Raum war im
Mittelalter farbenprächtig bemalt. Die Stiegenabgänge in die
historischen Klosterkeller vom Refektorium und vom Kapitelsaal aus
wurden im 17. und 18. Jahrhundert nachträglich eingebaut.
Das Dominikanerkloster mit der Kirche war durch viele Jahrhunderte
einer der größten öffentlichen Bauten in der Stadt Krems. Daher diente
es auch als Versammlungsraum für große Veranstaltungen, darunter sogar
für Sitzungen des Landtages im Spätmittelalter. An einer der Säulen im
Refektorium und an der Mittelsäule im Kapitelsaal können wir eine
Bäckerbrezel entdecken. Sie erinnert daran, dass sich auch die Meister
der Bäckerzeichen des Landes hier regelmäßig trafen.
Der Kreuzgang ist ebenfalls
schon im 13. Jahrhundert entstanden. Bei der Restaurierung in den
1960er Jahren wurden gotische Architekturfragmente freigelegt, die an
der Ostseite des Hofes die Rekonstruktion der mittelalterlichen Bauform
ermöglichten. Bei der Datierung des Kreuzganges halfen die Reste der
Wandmalereien. Sie erinnern an die auf über 300 geschätzten
Grablegungen im Innenbereich des mittelalterlichen Klosters. Rund um
den Kreuzgang waren die Versammlungsräume der Mönche angeordnet. Der
Kapitelsaal war ursprünglich ebenfalls terrakottafarben ausgemalt. Die
weitläufigen Kellergewölbe dürften ab dem 16. Jahrhundert entstanden
sein, drei historische Abgänge aus dem Innenbereich des Klosters wurden
zuletzt freigelegt. Die Keller wurden in der Art von Stollen
vorangetrieben und laufen nur zum Teil unter dem Kloster, ein Teil
liegt unter den Grünflächen im Norden und Osten der Anlage. An den
Kapitelsaal schließt die Fraterie (Aufenthaltsraum der Mönche) an,
ursprünglich der einzige geheizte Raum des Klosters, darüber befanden
sich die Wohn- und Schlafzellen der Mönche. Der letzte ebenerdige Raum
im Osttrakt ist das Refektorium (Speisesaal). Der Westtrakt des
Kreuzganges wurde Mitte des 16. Jahrhunderts durch eine Explosion von
eingelagertem Pulver zerstört.

Joseph II. (1741-1790), ältester Sohn der Regentin Maria Theresia
(1717-1780), war ab 1765 Mitregent seiner Mutter und nach ihrem Tod
Erzherzog von Österreich und Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. Von
den vielen Reformen, die er in seiner Regierungszeit umsetzte, ist eine
für das museumKrems von besonderer Bedeutung: 1782 veranlasste Kaiser
Joseph II. per Hofdekret die Aufhebung der kontemplativen Orden, also
all jener Klöster, die sich nicht der Krankenpflege dem Schulwesen oder
anderen sozialen Aufgaben widmeten. In Krems und Stein betraf das die
Klöster der Minoriten, der Kapuziner und der Dominikaner. 1786
verließen die letzten Mönche das Haus, Kloster und Kirche wurden
geräumt und verkauft Wenig mehr als 100 Jahr später, am 4. Oktober
1891, wurde das Kremser Stadtmuseum in der Dominikanerkirche eröffnet
und damit der Grundstein für das heutige museumkrems gelegt.
Martin Johann Schmidt erhielt für den Auftrag eines Giebelfreskos und
eines Porträts des Kaisers für die Ausstattung des Steiner Rathauses
nach barockem Usus ein Anerkennungshonorar, dessen Höhe durchaus
angemessen war. Während sich das Fresko an der Giebelwand des Steiner
Rathauses nicht erhalten hat, wurde das Porträt Josephs II. mit seinem
prächtigen originalen Rahmen dem städtischen Museum von Krems
übertragen.
Porträt Josephs II. mit der österreichischen Hauskrone
Martin Johann Schmidt, 1781, Öl auf Leinwand
„...für den dasigen bürgerl. Mahler Johann Schmid für das an das
Rath-Haus gemahlte Frontispitium und weiters in den Rathssaal zu mahlen
angebothenen Portrait Sr.Mayst des Kaysers als eine blosse
Erkenntlichkeit 10 Ducc zu verabfolgen bewilliget."
- so lautet der 5. Punkt der Tagesordnung der Ratssitzung der Stadt Stein vom 17. August 1781.
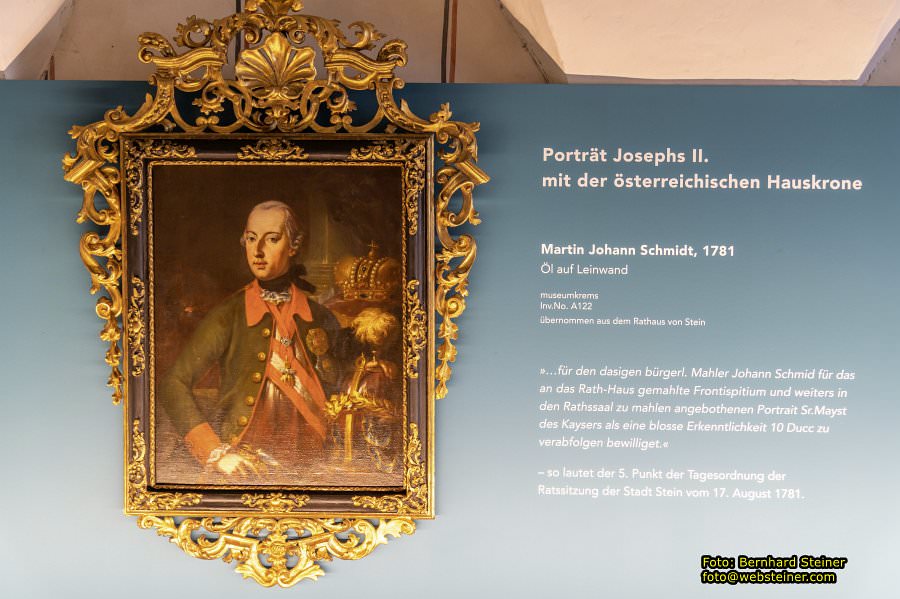
Steinfigur Sommer, 1573
Diese Figur stand ursprünglich an der Hausecke der „Mohrenapotheke",
dort befindet sich heute eine Kopie. Eine weitere
Jahreszeiten-Personifikation, der „Winter", ist ebenfalls an der
Kreuzung Täglicher Markt - Landstraße zu sehen. Wahrscheinlich
schmückten im 16. Jahrhundert Darstellungen aller vier Jahreszeiten
diesen wichtigen innerstädtischen Ort.

Zweigeschossiger Schrank, Augsburg (?), um 1540-1552
Der aufwändig gestaltete, zweigeschossige Schrank stammt aus dem Besitz
des Kremser Apothekers Wolfgang Kappler. Die auffällige
Schrankbekrönung mit Ranken, Füllhörnern, Blüten und Delphinen hält in
der Mitte eine weibliche Portraitdarstellung in einem Medaillon, die
möglicherweise Magdalena Kappler skizziert. Bemerkenswert sind die
aufwändigen Intarsien an den Schranktüren, die perspektivische
Raumeinblicke sowie Pflanzen- und Tierdarstellungen zeigen.





Fast 12.000 Liter Wein füllten einst das große Fass mit dem prächtigen
Fassboden, der das Motiv mit den biblischen Kundschaftern zeigt. Es
wurde vor einigen Jahrzehnten als kleines Kellerstüberl eingerichtet.
Auch die übrigen Fässer und Fassbodenteile sind mit aufwendigen
Schnitzereien verziert. Die „schwarze Katze" wurde auf jenes Fass
gesetzt, das den besten Wein des Jahrganges enthielt. Die Fassböden
zeigen biblische Motive, sehr im Gegensatz zu den Fassspunden in der
großen Vitrine.

Most gärt zum Wein
Die alte, historische Holzpresse beim Kreuzgang des Dominikanerklosters
war zuletzt im Weingut Stadt Krems in Verwendung. Die beiden
Pressstützen „der alte" und „der junge Wein" sind Schnitzarbeiten aus
dem 17. Jahrhundert und zeigen zwei Männer auf Löwen reitend. Ebenso
beeindruckend sind die Brustriegel, die zum Bewegen und Stabilisieren
des schweren Pressbaumes dienten. Sie zeigen teils apodiktische, also
geisterabwehrende Motive wie die „Verschreifaust" mit dem durch die
Faust gestreckten Daumen, teils Fabeltierköpfe, aber auch das Antlitz
eines Gastwirtes, der laut einer Aufschrift die Kriege gegen Napoleon
überstanden hat. Früher wurden Holzröhrensysteme verwendet, um den Most
in den tiefer gelegenen Keller zu leiten, heute dienen
Schlauchleitungen dazu. Die barock anmutende Mostpumpe des museumkrems
wurde 1910 von Lutz Lischka kunstvoll gestaltet, dessen Gesichtszüge
angeblich die Pressbaumverzierung der großen Baumpresse des Museums
zieren.
Reinheit ist oberstes Gebot
Die Umwandlung des trüben Mostes zu Wein erfolgt durch die Gärung, bei
der Hefen den natürlichen Zucker in Alkohol und Kohlendioxid umwandeln.
Nach etwa zehn Tagen setzt sich die Hefe am Fassboden als Geläger ab,
der grüne „Staubige" wird erstmals verkostet und analysiert. Der
Jungwein wird nun weg vom „Geläger" in andere Fässer oder Tanks
umgefüllt, die Klärung der Weine in den Fässern geschieht durch
Umpumpen über Kieselgurfilter. Zu Martini, am 11. November, wird der
Wein getauft und dabei erstmals öffentlich vorgestellt. Tatsächlich
werden die Weine aber noch einige Monate in der Fässern und Tanks
gelagert. Der Winzer entscheidet darüber, ob und wie lange seine Weine
nun reifen sollen und wann sie in Flaschen abgefüllt werden. Flaschen
und Korken müssen absolut steril sein, heute werden moderne
Füllmaschinen eingesetzt, die gewährleisten, dass möglichst wenig
Sauerstoff an den Wein kommt. Die Fässer werden gereinigt, die
„Fasstürln" der Holzfässer mit ihrem schweren Riegeln aus Eisen
geöffnet, und warten auf die nächste Lese.

Weinfaß "Die Kundschafter"
Holz, mit geschnitztem Vorderboden Fassungsvermögen 11.890 Liter

Sonderausstellung Kremser Senf
Seine Geschichte führt über 500 Jahre zurück in das mittelalterliche
Krems. Schon damals wurde in der Weinstadt an der Donau auch Senf
erzeugt. Der „Echte Kremser Senf" eroberte die Donaumonarchie und wurde
bis 1967 in Krems produziert. Der „Original Kremser Senf" trägt heute
neben dem Kremser Wein den Namen von Krems als Stadt des Genusses fast
in die ganze Welt.
Wir kennen ihn aus den Regalen der Supermärkte, aus der Werbung und in vielen Varianten, den „Kremser Senf".
Er trägt auch heute den Namen der Wachaustadt weit über die Region
hinaus und steht für besonderen Geschmack und Genuss. Zunächst wurde er
ausschließlich in Krems produziert. Schon vor 150 Jahren war der süße
Kremser Senf aus dem Hause Hietzgern ein begehrter Artikel. So begehrt,
dass er unter anderem auf einer Weltausstellung in London 1862 mit
einer Medaille prämiiert wurde. Sie zierte von da an neben vielen
anderen Auszeichnungen die Geschäftspapiere der „Kremser Senf-, Obst-
und Gemüsekonservenfabrik, gegr. 1851". Das Rezept für den „Echten
Kremser Senf" ist bis heute ein gut gehütetes Geheimnis der Familie
Hietzgern.
Bis zum Jahr 1967 wurde der „Echte Kremser Senf" hergestellt, er wurde
im Gebiet der ganzen Donaumonarchie geschätzt, wobei die Beliebtheit
des süßen „Kremser" den Namen der Donaustadt noch immer in die
ehemaligen Kronländer trägt. Auch wenn er heute nicht mehr aus dem
Hause Hietzgern und direkt aus Krems kommt. Die Geschichte der
erfolgreichen Fabrik Hietzgern war jedenfalls auch für lange Zeit die
Erfolgsgeschichte des süßen Senfs aus Krems an der Donau.
Die Geschichte der Kremser Fabrik Hietzgern reicht zurück bis ins Jahr
1851. Von Anfang an war die Produktion des „Kremser Senf" auf Basis von
Most neben anderen Senfsorten auf Essigbasis ein Hauptzweig des rasch
expandierenden Familienunternehmens. Grundlage war zunächst der
landwirtschaftliche Betrieb rund um das Weingut. Dazu kam nun unter
anderem die Produktion von Gewürzmitteln.

Die Tradition der Herstellung von Senf in der Donaustadt Krems reicht
zurück bis ins Mittelalter. Schon vor mehr als 500 Jahren berichten die
Ratsprotokolle der Stadt über Senffässer, die von Krems aus exportiert
wurden. Sogar Kaiser Maximilian I. soll den Senf aus Krems geschätzt
haben. Bereits vor mehr als 3000 Jahren wurde in China Senf verwendet,
in unseren Raum brachten ihn - wie den Weinbau - die Römer.
Ursprünglich wurde nicht nur der süße Kremser Senf aus unvergorenem
Weinmost an Stelle von Essig hergestellt. Auch andere Senfarten hatten
Most als Basis, daher auch die alternative Bezeichnung „Mostrich" für
Senf. Wasser, Zucker, Weinessig oder Most, Salz und Gewürze waren und
sind die traditionellen und unverfälschten Zutaten der Senfproduktion.
Mautner Markhof prägt seit 180 Jahren wie kaum ein anderer Betrieb den
österreichischen Geschmack. Feinkost-Klassiker wie der süße Kremser
oder der scharfe Estragon Senf, würziger Tafelkren, Hesperiden Essig
oder die beliebten Fruchtsirupe finden sich seit Generationen in nahezu
jeder heimischen Küche

Weinbauern aus der Region Krems, so berichtet die Firmenchronik des
Wiener Traditionsunternehmens Mautner Markhof, haben dem
Feinkosthersteller ihren Most angeboten, um daraus süßen Senf
herzustellen. Im Laufe der Entwicklung des neuen Feinkostproduktes
stellten die Fachleute des Unternehmens fest, dass der
süßlich-fruchtige Geschmack des Kremser Senf auch durch einen wohl
abgelagerten Weinessig erreicht werden kann. Auch wenn im 20.
Jahrhundert ein scharfer Wettbewerb um den süßen Senf mit der
Bezeichnung „Kremser Senf" lief, so setzte sich die Mautner Markhof
Feinkost GmbH mit dem „Original Kremser Senf" an die Spitze der
Konkurrenten. Für den „Original Kremser Senf" werden die Senfkörner
gröber gemahlen, ausgesuchte Gewürze machen seinen besonderen und
unverwechselbaren Geschmack aus.
Neben dem würzig-scharfen Estragon Senf zählt der „süße" Kremser Senf
heute mit Abstand zu den Lieblingssorten der Österreicher. Beide
Senf-Klassiker von Mautner Markhof sind weder aus den privaten
Haushalten noch aus der Gastronomie wegzudenken und fester Bestandteil
der Österreichischen Genusskultur. Mautner Markhof betont weiterhin die
regionalen Zutaten. Seit 2010 kommt die Gelbsenfsaat für den „Original
Kremser Senf" zu 100 Prozent aus österreichischem Anbau. Anbaupartner
für die Senfsaat finden wir unter anderem im niederösterreichischen
Wald- und Weinviertel sowie im Burgenland.
Die Senfpflanze zählt zu der Familie der Kreuzblütler (Brassicaceae)
und ist somit mit Raps, Rettich, Kresse und Kohl verwandt. Die
einjährigen, krautartigen und schnell wachsenden Pflanzen werden bis zu
80 cm hoch. Die gelbe Senfblüte dauert meist nur zwei Tage, dann bilden
sich an den Dolden Schoten, in denen bis zu zehn Samenkörner
heranreifen. Der intensive Geruch der Senfpflanze schützt sie übrigens
vor vielen Schädlingen - Bienen und manche Schmetterlingsarten schätzen
den Nektar der Senfpflanze. Geerntet wird die Senfsaat im Herbst.
Neben Senfkörnern, Wasser und Gewürzen war lange Zeit süßer Traubenmost
das Geheimnis des süßen Kremser Senf. Ob am Anfang der Entwicklung
überreiche Weinernten und eine Überproduktion an Most standen oder ein
findiger Senfsieder aus Krems, der eine neue Geschmacksvariante
entwickelte, ist nicht belegt. Senfkörner und Senfpulver (gemahlene
Körner) waren schon in China vor über 3000 Jahren als Gewürzmittel
bekannt. Die Griechen nutzten die Eigenschaften der Senfpflanze als
Heilmittel. Senfpaste wird aus Kräutern, Getreidemehl und Gewürzen
erzeugt. Im Mittelalter eroberten die Senfkörner von Spanien aus die
europäischen Tische.

Früher wurde Senf in Ton-, Glas- oder Emailgefäßen abgefüllt und
verkauft. Diese Art der Verpackung und Aufbewahrung ist heute - neben
Kunststoff - international noch am meisten verbreitet. Die Bedienung
großer Märkte erfordert auch entsprechende Verpackungen und Logistik.
Seit 1921 produziert Mautner Markhof in Wien-Simmering auch Tafelsenf
und wurde zum österreichischen Marktführer in der Branche. Die
hauseigene Abpackungs-Anlage ermöglichte die Großproduktion. Die
technische Herausforderung, Senf in Tuben abzufüllen, war groß.
Mautner Markhof meisterte sie und schuf damit eine Besonderheit für
Österreich: hier wird Senf in Tuben bei Weitem bevorzugt. Sie verbindet
Licht- und Wärmeschutz mit optimaler Dosierbarkeit.
Neben dem „Echten Kremser Senf" wurden auch eingelegte Früchte - süß
und sauer, Marmeladen, Wein, Essig und viele weitere Feinkostprodukte
aus dem Hause Hietzgern viel gefragte Spezialitäten aus Krems. Das
erfolgreiche Familienunternehmen aus Krems produzierte vor allem für
den Export, stellte seine beliebten Produkte jedoch auch auf der
niederösterreichischen Landesausstellung in Krems vor. Jährlich werden
weltweit 660.000 kg Kremser Senf von Mautner Markhof verkauft. Die
wichtigsten ausländischen Märkte, neben Mittel- und Osteuropa sind
dabei Südafrika, Australien, Kanada und die USA. Würde man diese Menge
in 200g-Tuben füllen, dann ergeben diese Tuben aneinander gereiht eine
Länge von ca. 700 km - das entspricht der Distanz von Krems nach Verona.

MARTIN JOHANN SCHMIDT - Sein Leben
25. September 1718 Taufe in der Pfarrkirche Grafenwörth
1753 Erste Wohnung in Stein
1756 Erwerb des Hauses Steiner Landstraße 202
30. August 1756 Schmidt emält das Bürgerrecht.
17. April 1757 Schmidt wird zum Himmelsführer ernannt
1758 Vermählung mit Elisabeth Müller
1759 Geburt der Tochter Thekla
4. Februar 1760 Geburt des Sohnes Vincentius Ferrerius Thomas
10. Dezember 1760 Mitglied des Äußeren Rates der Stadt Stein
25. November 1761 Geburt der Tochter Maria Anna Katharina
7. Februar 1761 Emennung zum Schul-Commisarius
10. Dezember 1761 Ernennung zum Allmosen-Commisarius
18. April 1763 Ernennung zum Mitglied einer Quartiers-Commission
26. Oktober 1763 Geburt des Sohnes Franz de Paula Thomas
1764/1765 Die Kinder sterben bei der Pockebnepidemie.
20. Dezember 1765 Geburt des Sohnes Joseph Johann Nepomuk
1767 Mitglied des Inneren Rates oer Stadt Stein
23. Dezember 1767 Geburt der Tochter Viktoria Elisabeth
22. August 1769 Geburt des Sohnes Johann Martin Karl
14. März 1771 Mitglied des Bürgerausschusses
13. Januar 1780 Mitcommissär zur Revidierung des Kirchensilbers
1. September 1785 Seine Tätigkeit als Rat der Stadt Stein endet durch Zusammenlegung der Verwaltungen von Krems und Stein.
28. Juni 1801 Eintrag in den Sterbematriken Stein Herrn Martin Johann
Schmid, Kunstmaler alhier, 83 Jahre, Sand und Steinschmerzen. Mit hl.
Sakrament versehen worden.
Martin Johann Schmidt, Selbstbildnis, 1754, Öl auf Leinwand, 56 x 43,5 cm

Hl. Benediktus, 18. Jh. / Schmidt- Schule, Öl auf Leinen

Martin Joa. Schmidt Pinxit. 1765.
P Haubenstricker. Scj 778.
S. Hieronymus.

Martin Joh. Schmidt pinxit 1774.
iry. Paul Haubenstricker foulp.
Ein Blat in Ungarn zu Warzen in Dom, hoch 24 Schuch
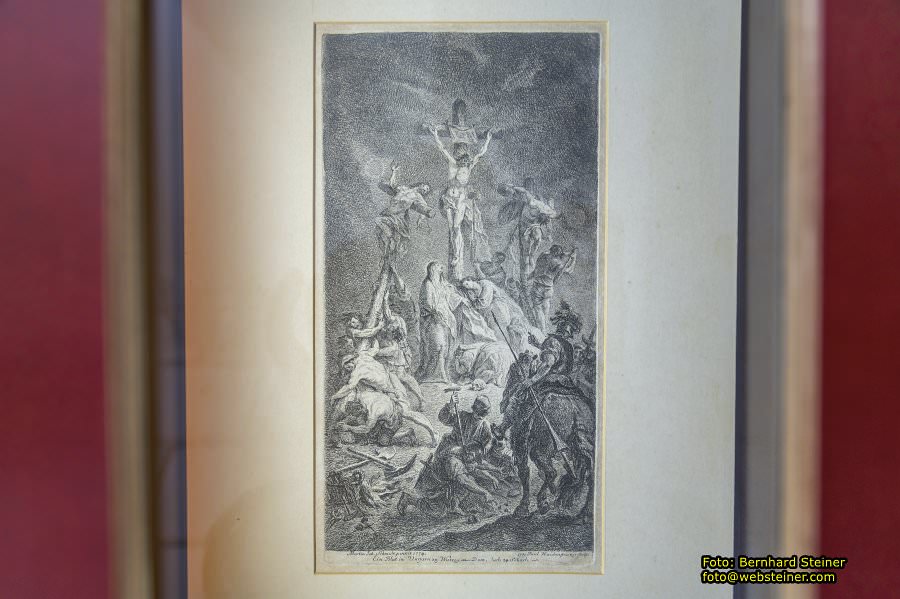
Meisterwerke der Bildhauerkunst
Das museumkrems beherbergt an die 100 Skulpturen, die aus zwei großen
Sammlungen und als Spenden in seinen Besitz kamen. 17 Objekte aus
diesem Bestand sind im Kreuzgang zu sehen und spannen einen Bogen von
der Romanik bis zum Barock. Aus dem 13. Jahrhundert stammt die mächtige
Figur eines unbekannten Bischofs aus Lindenholz, die den Besucher im
Kreuzgang des Dominikanerklosters empfängt. Die Mitra als Kopfbedeckung
und das Pallium zeichnen sie als Gestalt eines Erzbischofs oder gar
Papstes aus. Die übernächste Figur, eine Darstellung der Hl.
Muttergottes mit dem Jesuskind, wurde von einem Bildhauer geschaffen,
dessen Handschrift bereits auf das späte 13. Jahrhundert verweist, vor
allem die Faltengebung des Gewandes führte zu einer Neudatierung der
wunderschönen romanischen Arbeit.
Gotik und Donauschule
Darstellungen der Hl. Maria mit dem Jesuskind aus dem 15. Jahrhundert
aus Südtirol und aus Wien ermöglichen Stilvergleiche, die beiden
Christusfiguren beeindrucken durch den realistischen Ausdruck der
Schmerzen und des Leidens am Ende des Jahrhunderts. Die folgenden
sieben Figuren wurden alle um 1500 bis 1530 geschaffen, die Hl. Anna
Selbdritt lässt die enge Verbindung zum bäuerlichen Leben der Region
spüren, anstelle eines Apfels wird hier eine Weintraube gereicht. Die
Hl. Margarethe dagegen ist modisch gekleidet und triumphiert stolz über
den Drachen ein ausdrucksstarkes gotisches Werk. Der asketische Hl.
Johannes trägt eine üppige Haar- und Barttracht Stilmittel der
Spätgotik in hervorragender Ausprägung. Um 1520 schnitzte ein
unbekannter Meister den Patron der Stadtpfarrkirche, den Hl.
Vitus/Veit, eine Skulptur ganz im Einfluss der Donauschule. Auch der
Hl. Leopold, die letzte Skulptur dieser Gruppe, ist eine ausdruckstarke
Arbeit mit typischen Merkmalen der Donauschule im Übergang von der
Gotik zur Renaissance.
Barocke Kunstwerke
Ebenso wie der prächtige Kreuzgang des Klosters gotische und barocke
Bauelemente vereint, zeigen die drei letzten ausgestellten Skulpturen
die Ausdruckskraft barocker Meister. Der Hl. Paulus soll von Joseph
Mattias Goetz stammen, die Hl. Katharina wird nach der
Hausüberlieferung des Museums dem Barockbildhauer Matthias Schwanthaler
zugeschrieben.

Hl. Vitus im Kessel, um 1520/Holz, H 104,5 cm

Eine kurze Geschichte der Druckgrafik
Mit der im späten 14. Jahrhundert einsetzenden maschinellen
Papierproduktion und der Erfindung des Buchdruckes Mitte des 15.
Jahrhunderts wird der Grundstein für den Siegeszug der Druckgrafik
gelegt. Bilder und Texte können von jetzt an in großer Zahl und guter
Qualität vervielfältigt werden. Entstanden zunächst einfache
Einblattholzschnitte - wie Andachtsbilder - in Hochdrucktechnik, so
wurden schon bald mehrfärbige, räumlich wirkende Blätter gedruckt. Die
Möglichkeiten des Holzschnitts waren begrenzt, die Bildwirkung war
eingeschränkt und die Anzahl der Abzüge, die von einem Druckstock
angefertigt werden konnten, limitiert. Die Erfindung von
Tiefdruckverfahren wie dem Kupferstich oder der weniger aufwändigen
Radierung im Laufe des 15. Jahrhunderts führten zu technischen und
künstlerischen Innovationen.
Künstler wie Albrecht Dürer (1471-1528), Martin Schongauer (um
1440/45-1491) oder Andrea Mantegna (1431-1506) machten die Druckgrafik
zur eigenständigen Kunstgattung und erreichten ein großes Publikum. Am
Übergang zum 19. Jahrhundert perfektionierte der spanische Künstler
Francisco de Goya das Aquatintaverfahren, eine Technik, durch die
flächige Farbabstufungen und Schattierungen im Tiefdruck möglich
wurden. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhundert wurden Drucksorten
durch neue Techniken wie Holzstich, Stahlstich oder Lithografie
illustriert. Infolge gelang es, die Fotografie mit industrialisierten
Druckverfahren zu kombinieren. Mit der Idee der Originalgrafik
entwickelte sich am Ende des 19. Jahrhunderts eine Gegenbewegung zur
industriellen Massen-Druckgrafik. Künstler wie Paul Gauguin (1848-1903)
oder Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901) limitierten ihre Drucke
durch persönliche Signaturen und das Durchnummerieren der Blätter.
Holzschnitt, Radierung, Kupferstich oder Lithografie konnten so als
künstlerische Techniken „überleben". Unter ökonomischen Gesichtspunkten
waren sie gegenüber dem Offsetdruck, der sich am Beginn des 20.
Jahrhunderts durchgesetzt hatte, unrentabel geworden.
In den 1960er Jahren wurden fotomechanische Methoden eingesetzt.
Vertreter der Pop Art, wie Andy Warhol oder Roy Lichtenstein und
Künstler der Op Art, wie Victor Vasarely, nutzten den Siebdruck als
neue ästhetische Ausdrucksform. Heute führen die schier unendlichen und
sich rasant weiterentwickelnden Möglichkeiten der Digitalisierung zu
einer völligen Neudefinition der Begriffe Originalgrafik oder
Reproduktion. Die künstlerische Urheberschaft ist im digitalen Raum
oftmals unklar und die Materialität analoger Druckgrafiken wird
zusehends durch neue Formen digitaler „Bildträger" konterkariert.

Der Hl. Simon aus der Serie der zwölf Apostel, Kupferstich und Radierung
Ausführung: Marco Alvise Pitteri, um 1742, Entwurf: Giovanni Battista Piazzetta
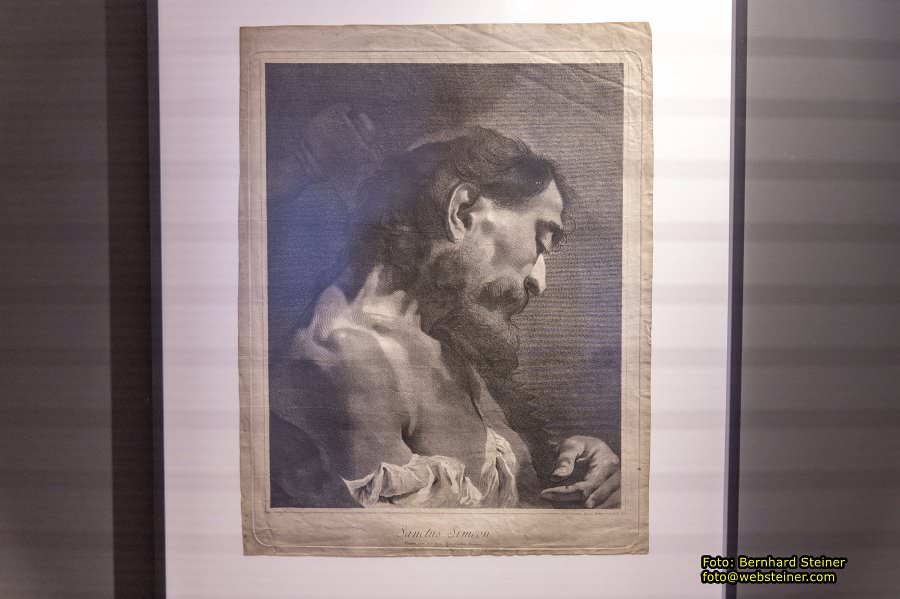
Ausblick vom museumkrems auf Piaristenkirche Unsere liebe Frauund und
Stadtpfarrkirche St. Veit, Dom der Wachau. In der Mitte die
Ursulakapelle.

offline_online - Arbeiten mit und ohne Papier
Die Ausstellung bietet einen Einblick in die umfangreiche
druckgrafische Sammlung des museumkrems und spannt den Bogen von
Arbeiten des „Kremser Schmidt" aus dem 18. Jahrhundert bis zu den
preisgekrönten Blättern der Kremser Grafikwettbewerbe der frühen 1970er
Jahre.
Die Grundlagen der verschiedenen Drucktechniken werden mit Beispielen
aus dem Museumsbestand anschaulich dargestellt. Historische Ansichten
der Stadt Krems treten in Dialog mit dem Blick der Künstler auf die
Stadt, während die Arbeiten der Kremser Grafikwettbewerbe die
druckgrafischen Strömungen der 1960er und 1970er Jahre repräsentieren.
Inmitten von grafischen Werken des Kremser Barockmalers Martin Johann
Schmidt platziert der Medienkünstler Thomas Wagensommerer seine
künstlerische Installation, Digitalisierte Werke des Kremser Schmidt
dienen einer künstlichen Intelligenz als Ausgangspunkt für die
Produktion neuer Bilder. Gleichzeitig wird das Depot des museumkrems
als Ort der Speicherung von kulturellem Gedächtnis in den Mittelpunkt
einer multimedialen Arbeit gestellt.

Abschied Ludwig XVI. von seiner Familie, Radierung in Mischtechnik
Ausführung von P. Koloman Fellner nach einer Skizze Martin Johann Schmidts, 1793
Pater Koloman Fellner, * 1750 in Aichkirchen/OÖ † 1818 in Lambach/OÖ
P. Kolomann Fellner war Benediktinermönch des Stiftes Lambach. Ab 1778
hielt er sich zur Ausbildung in der Werkstatt Martin Johann Schmidts in
Stein auf, später besuchte er auch die Wiener Kupferstecherakademie bei
Jakob Schmutzer. 1796 erlernte er in München beim Erfinder der
Lithografie, Alois Senefelder, diese neue Drucktechnik und gilt als
erster Ausführender der Lithografie in Österreich. Mit seiner
umfangreichen Sammlungstätigkeit legte er den Grundstein für die
heutige grafische Sammlung des Stiftes Lambach.

Die Versuchung Christi in der Wüste, Radierung in Mischtechnik
Entwurf Martin Johann Schmidt, Ausführung Ferdinand Landerer, 1760
Ferdinand Landerer, * 1730 in Stein † 1796 in Wien
Die Landerers waren „bürgerliche Kupferdrucker und Bilderhändler". Die
Familie betrieb bereits seit 1715 das Kupferdruckgewerbe in Stein und
hatte ihren Verkaufsstand beim Kapuzinerkloster in Und. Ferdinand
Landerer lernte sein Handwerk bei Jakob Schmutzer in Wien. Ab 1760
finden sich in seinem Werk rund 30 Radierungen nach Vorlagen Martin
Johann Schmidts.

Innenhof der Dominikanerkirche Krems

Die Pfarrkirche St. Veit in der Stadt Krems an der Donau ist eine
römisch-katholische Kirche und geht auf eine Schenkung Kaiser Heinrichs
II. von 1014 zurück. Erst 1178 wird Sankt Veit (Vitus) als
Titelheiliger der Kirche genannt.

Die Pfarrkirche St. Veit in der Stadt Krems an der Donau ist eine
römisch-katholische Kirche. Sie wird auch „Dom der Wachau“ genannt. Sie
geht auf eine Schenkung Kaiser Heinrichs II. von 1014 zurück und besaß
zunächst als sogenannte „Mutterpfarre“ eine beträchtliche Ausdehnung.
Erst 1178 wurde Sankt Veit (Vitus) als Titelheiliger der Kirche genannt.

BAUGESCHICHTE der STADTPFARRKIRCHE KREMS - ST. VEIT
1111 Kirche St. Veit vermutlich schon vorhanden
Ende 13. Jh. Gotischer Umbau der vermutlich romanischen Basilika
1630 Abschluß eines Neubaues,
der eine der interessantesten frühbarocken Anlagen Niederösterreichs
darstellt (Baumeister Cypriano Biasino).
18. Jh. Angesehene Künstler
arbeiteten an der Ausgestaltung der Kirche, so Matthias Steinl, Martin
Altomonte, Johann Georg Schmidt, Joseph Matthias Götz, Jakob Christoph
Schletterer und Martin Johann Schmidt („Kremser Schmidt").

Kanzel von Joseph Matthias
Götz, auf Schalldeckel Verklärung Jesu auf dem Berg Tabor, an Laibung
und Stiege Gleichnisse aus dem Evangelium

Hochaltar von Joseph Matthias
Götz (1733). Altarblatt (Martyrium des Hl. Veit) von Johann Georg
Schmidt. Vor den Säulen vergoldete Holzstatuen: Johannes der Täufer,
Josef, Petrus und Paulus, Laurentius und Florian. In der Koncha
Himmelfahrt Mariens und Heilige Dreifaltigkeit.
Chorgestühl mit geschnitzten vergoldeten Reliefs (Martyrium der Apostel) von Joseph Matthias Götz (1735)

ANNA-ALTAR
Das Altarbild stammt aus der Schule des M.J.Schmidt und stellt die hl.
Anna dar, wie üblicherweise auf ein Buch zeigend, aus dem die Jungfrau
Maria liest. Lilie und Rose in den Händen des Engels bedeuten
Jungfrauschaft und Vermählung. Neben dem Kruzifix 2 Märtyrerinnen: Hl.
Katharina von Alexandrien (l.) und Hl. Dorothea (r.).

MARIEN-ALTAR
Marmoraltar mit Marienbild und eisernem Speisegitter - auch „Maria
Bründl" Altar genannt - wurde 1796 aus dem aufgelassenen
Kapuzinerkloster UND hierher übersiedelt. Die Tumba, die beiden Säulen
und der Aufsatz sind aus schwarzem Lilienfelder Marmor. Über der hl.
Maria mit dem Jesuskind auf dem Arm (um 1420), ein Ölbild „Pieta" aus
dem 17. Jh. und darüber eine von 2 Engeln getragene Krone, etwas höher
ein Schild mit dem Namen Maria, darüber der hl. Geist in Taubengestalt
und ganz oben Gott Vater, umgeben von Engeln.





JOSEF-ALTAR
Das Altarbild vom Kremser Schmid, zeigt den hl. Josef auf dem
Sterbebett. Daneben stehen Maria und Jesus. Letzterer zeigt mit der
Rechten gegen Himmel. Neben dem Kruzifix auf dem Altar ist die Statue
des hl. Franz von Paula in Mönchsgewand, den Stab mit dem Wort
„Christus" im Strahlenkranz in der Rechten und gegenüber der hl.
Donatus mit Schale, Ähren u. Trauben.


KREUZ-ALTAR
Diesen ließ 1704 der Kremser Magistrat als Einlösung eines Gelübdes
„wegen der sich ereigneten und sehr gefährlichen Conjuncturen und
angedrungenen Feindsgefahren" durch den Kremser Bildhauer Andreas
Krimmer nach Zeichnungen des Wiener Ingenieurs Mathias Steindl
errichten. Die Tischlerarbeiten machte Laurenz Teigl. Hinter dem großen
Kruzifix ein Ölgemälde, die Kreuzerrichtung darstellend. Statue links:
Apostel Simon mit Säge; rechts: der Apostel Judas Thaddäus mit Buch und
Keule.



HOCHALTAR
Das ca. 8 Meter hohe Altarbild von Johann Georg Schmidt aus 1734 stellt
den hl. Vitus dar, wie er in einen Kessel mit siedendem Öl geworfen
wird. Römische Soldaten vollführen die Hinrichtung, während oben der
Engel mit der Siegespalme schwebt.
Das Altarbild flankieren vergoldete Holzfiguren bedeutender Heiliger:
Johannes der Täufer, Petrus, Stephanus sowie Josef, Paulus und Florian.
Der Hl. Vitus ist der Pfarrpatron.

MAGDALENA–ALTAR
Das Altarbild mit der hl. Magdalena ist ein Werk aus 1866, gemalt von
Oswald Horst, Prof. an der Realschule Krems und ein Schüler Führichs.
Die Tischgesellschaft betrachtet die Büßerin, wie sie mit ihren Haaren
die tränenbenetzten Füße des Heilands trocknet. Die beiden Statuen
zeigen die Äbtissin Walpurga und die hl. Maria Magdalena de Pazzi. Die
Fresken geben Darstellungen aus der Lebensgeschichte Maria Magdalenas
wieder.

JOHANNES ΝΕΡΟMUK–ALTAR
Das Altarbild zeigt den hl. Johannes von Nepomuk, wie er bei
Fackelbeleuchtung zur Moldau geführt wird. Bei den Säulen stehen
Plastiken des hl. Karl Borromäus und des hl. Ambrosius, dem eine Frau
ein todkrankes Kind entgegenhält. Der Altar wurde von Wohltätern
gestiftet und vom Bildhauer J.M. Götz geplant. Unter dem Bogen der
Nische der hl. Johannes Nepomuk als Pilger vor einem Muttergottesbild.

Stattlicher Langhausraum mit je vier unverbundenen Seitenkapellen,
Querschiff und langem, im Halbkreis abschließendem Presbyterium

MICHAELIS–ALTAR
Das Altarbild von Anton Maulbertsch zeigt den Kampf des Erzengels
Michael mit dem Satan und dessen Sturz. Die Inschrift: Quis ut Deus?
(Wer ist wie Gott?) ist Ausdruck für die Überheblichkeit des Bösen. Die
Engelstatuen neben dem Bild zeigen die Erzengel Gabriel und Raphael.

ALTAR-JOHANNES ENTHAUPTUNG
Tumba, Antritt und Postamente sind aus Marmor, die Säulen zu beiden
Seiten aus Stuckmarmor. Das Altarbild (von M.J. Schmidt) stellt die
Enthauptung des Verkünders Christi dar. Der hl. Franziskus Seraphikus
mit Kruzifix und Totenkopf in Händen steht links, der hl. Franz Xaver
als Prediger rechts.

ALLERSEELEN–ALTAR
Das Altarbild (M.J. Schmidt) zeigt die armen Seelen im Fegefeuer. Sie
heben flehentlich ihre Hände empor und vom Himmel reichen schwebende
Engel Kreuz und Rosenkränze, um anzudeuten, dass ihnen durch Gebet und
Opfer Hilfe zuteil wird. Statuen: der hl. Dominikus mit der Ordensregel
in der Hand und die hl. Katharina von Siena, eine Lilie haltend.

PETRUS UND PAULUS-ALTAR
Er ist den Apostelfürsten geweiht (Schild über dem Bogen der Nische).
Auf dem Altarbild (M.J. Schmidt) umarmen einander Petrus und Paulus,
ehe sie zur Hinrichtung geführt werden. Der Altar wurde von Dechant
Gregory 1701 in Auftrag gegeben und aus Mitteln einiger Legate und aus
der Petri- und Pauli- Bruderschaftskasse bezahlt.

Barbara-ALTAR
Das Altarbild wird in der neueren Literatur M.J.Schmidt zugeschrieben.
Es stellt die Enthauptung der hl. Barbara dar. Außerhalb der Säulen:
Statuen der Jungfrau Thekla mit Löwen und der hl. Apollonia mit Zange
und Feuer. Die rechts und links angebrachten Schilder weisen auf die
Stifterin des Altares, die Kremser Bürgerin Barbara Sophia Höltzlin,
hin.

SEBASTIAN-ALTAR
Altarbild von Martin Altomonte. Darunter ruht die Statue der hl.
Rosalia. Neben den Säulen Statuen des hl. Leopold (l.) und des hl.
Rochus (r.). Zwei ovale Freskos zeigen, wie der Heilige erschlagen wird
und wie die hl. Irene Sebastian die Pfeile aus der Wunde zieht. Auf dem
Fresko unter dem Bogen geht der Heilige in die Glorie des Himmels ein.

Nach außen stellt sich die Kirche als strenger, frühbarocker Bau dar,
die Inneneinrichtung stammt aber erst aus dem 18. Jahrhundert.
Wesentlich war die Tätigkeit des Passauer Bildhauers und Architekten
Joseph Matthias Götz (Hochaltar, Chorgestühl, Kanzel) ab 1733 und die
Ausgestaltung der Kirche mit Deckenfresken. Sie stammen von Martin
Johann Schmidt („Kremser Schmidt“ ) und wurden im Jahre 1787
geschaffen, das Hochaltarbild dagegen (1734) stammt von Johann Georg
Schmidt („Wiener Schmidt“), einem älteren Zeitgenossen, wobei aber
keine verwandtschaftliche Beziehung besteht. Besonders soll der
Seitenaltar aus schwarzem Marmor im linken Querschiff hervorgehoben
werden. Er befand sich ursprünglich in der „Bründlkapelle“ des
Kapuzinerklosters Und, die 1796 bei der Klosteraufhebung hierher
übertragen wurde. In ihm fand auch die kleine Marienstatuette
(böhmisch, um 1420) ihre Aufstellung, die als Gnadenbild „Maria Bründl“
den Mittelpunkt der Marienverehrung im Kloster Und bildete.

Neue Orgel erbaut 1986 von
Orgelbau Oberbergern - OBM Gerhard Hradetzky. Rein mechanische
Schleifladenorgel, 3 Manuale, 40 Register, Hauptwerk, Rückpositiv,
Continuo- und Pedalwerk, 2932 Pfeifen.

Deckenfresken von Martin Johann Schmidt, 1787
Presbyterium: Anbetung des Altarssakramentes
Langhaus: Tugend der Liebe, Sieg des Glaubens über den Unglauben, die Hoffnung
Über der Orgelempore: Hl. Cäcilia

Marienaltar: im Querschiff links, mit Muttergottesstatue böhmischer Herkunft (um 1420)
Kreuzaltar: im Querschiff rechts, nach einem Entwurf von Matthias Steinl
Annenaltar: am Triumphbogen links, mit Ölbild aus der Schule des Kremser Schmidt
Josefsaltar: am Triumphbogen rechts, mit Ölgemälde von Künstlern der Paul Troger-Nachfolge
Linke Seitenkapellen (von vorne nach hinten)
Sebastiansaltar: Altarblatt von Martin Altomonte
Barbaraaltar: Ölbild von P. Poli
Peter- und Paulaltar: Altarblatt ein Spätwerk des Kremser Schmidt
Allerseelenaltar: Ölbild von Martin Johann Schmidt aus 1768
Rechte Seitenkapellen (von vorne nach hinten)
Magdalenenaltar: Altarblatt von Oswald Horst, 1866
Nepomukaltar: Altarblatt vermutlich von P. Poli
Michaelsaltar: mit Ölbild von Franz Anton Maulpertsch, 1775
Johannesaltar: von Martin Johann Schmidt, 1768

Der Turm an der Westfront der Piaristenkirche, dessen untere Stockwerke
aus der Romanik stammen, wovon noch Doppelfenster auf halber Höhe
zeugen, ist mit seinen vier sechseckigen gotischen Ecktürmchen sowie
seinem barocken Helm charakteristisch für die Silhouette der Stadt.
1514 deckte man den Turm mit Zinn. 1709 wurde eine Turmuhr mit bemaltem
Zifferblatt und vergoldeten Zeigern angeschafft.

Die römisch-katholische Piaristenkirche in Krems an der Donau, auch Kremser Frauenbergkirche, ist die älteste Kirche der Stadt.

Das Kircheninnere, eine weiträumig hohe Halle, wirkt durch die großen
Spitzbogenfenster sehr hell. Das annähernd quadratische Langhaus
verfügt über elegante, hoch gestreckte und tief profilierte
Bündelpfeiler, die mit spätgotischen Maßwerkbaldachinen versehen sind.
Sowohl die Baldachine als auch die bemerkenswerten Rankenkapitelle und
das darüber befindliche herrliche Netzrippengewölbe, welches teilweise
auf figuralen Rippenkonsolen ruht, stellen den Einfluss der Wiener
Dombauhütte von St. Stephan unter Beweis. Der erhöhte feingliedrige
Chor besitzt ein elegantes Sternrippengewölbe (1457). Die Westseite des
Kirchenraumes wird mit einer Empore (1520) abgeschlossen, die durch
eine spitzbogenähnliche, durchbrochene, in der Form jeweils variierte
Brüstung geschmückt ist.

1616 wurde die Kirche den Jesuiten übergeben, die im Anschluss Kloster
und Gymnasium errichteten. Von der Übergabe ausgenommen war der von
vier Ecktürmchen bekrönte Frauenbergturm, da er der Bürgerschaft als
Stadtturm (Brandwache, Glockensignal) diente. Als Hinweis darauf trägt
er – als einziger Kirchturm Österreichs – auf seiner Spitze noch heute
kein Kreuz, sondern das Stadtwappen.

Die barocke Innenausstattung zeigt eine große Anzahl an Werken des
bedeutenden österreichischen Barockmalers Martin Johann Schmidt,
genannt der Kremser Schmidt. Zu den wichtigsten zählen das
Hochaltarbild Himmelfahrt Mariä (1756), der rechte Seitenaltar, das den
Gründer des Piaristenordens, den hl. Josef Calasanz darstellt, und die
Altäre an den nördlichen und südlichen Langhauswänden (hl. Josef, bzw.
hl. Aloysius) sowie das Fresko am Eingang zur Franz-Xaver-Kapelle
gegenüber dem Hauptportal. Diese ließen die Jesuiten 1640 an die Kirche
anbauen.

Der Hochaltar wurde 1756 in
Ausführung eines Planes von Jakob Christoph Schletterer errichtet. Auf
vier Postamenten ruhen Säulen mit gekröpftem Gebälk und gebrochenem
Flachbogengiebel, darüber ein baldachinartiger Aufbau, unter dem die
Dreieinigkeit dargestellt ist. Zwischen den Säulen befinden sich die
qualitätsvollen Skulpturen der vier Evangelisten. Johannes und Lukas
stammen vermutlich von der Hand des Kremser Bildhauers Johann Baptist
Peran. Das eindrucksvolle, künstlerisch hervorragende Altarblatt mit
der Himmelfahrt Mariens schuf Martin Johann Schmidt im Jahr 1756.
Oberhalb des Tabernakels befindet sich das von einem vergoldeten
Prunkrahmen umgebene Gnadenbild des Piaristenordens.

Mit der Tätigkeit der Jesuiten setzte in unserem Raum die barocke
Kirchenmusikpflege ein. Bedingung dafür war eine gute Orgel.
Diese
erhielten sie bereits 1626. 1678 wurde abermals eine Orgel mit zwölf
Registern angekauft, welche mit bemalten Flügeltüren sowie mit
versilberten und vergoldeten Zierraten versehen war. Schon 1749 wurde
neuerlich eine Orgel aufgestellt. Die Jesuiten konnten darauf
hinweisen, diese Orgel erklinge so mächtig, dass sie nicht nur in der
Kirche, sondern auch in der Nachbarschaft zu hören sei. Die Orgel ist
nicht erhalten, wohl aber ihr Gehäuse, in das der Kremser
Orgelbaumeister Franz Capek d. Ä. 1892 ein neues Orgelwerk mit 18
Stimmen auf zwei Manualen mit Pedal einbaute.
Orgel mit Gehäuse aus 1749, darüber hl. Cäcilia von Martin Johann Schmidt

Der Seitenaltar links aus der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts mit
getürmten Aufbauten zeigt die Figuren der hll. Sebastian, Franz Xaver,
Aloysius und Rochus sowie ein Ölgemälde: Hl. Ignatius heilt einen
Besessenen. Der hl. Ignatius von Loyola, 1491-1556, war spanischer
Offizier und gründete 1534 in Paris den Orden der Jesuiten, nachdem er
nach innerer Wandlung das Priesteramt angetreten hatte.

Der rechte Seitenaltar aus derselben Zeit besitzt ein Altarblatt von
Martin Johann Schmidt, 1784, mit dem Thema „Joseph Calasanz erweckt ein
Kind zum Leben". Die Figuren des Erzengels Michael, der hl. Elisabeth
von Thüringen und der hl. Katharina sowie des Erzengels Raphael mit dem
jungen Tobias stammen wahrscheinlich aus der Werkstatt Matthias
Schwanthalers.

Die Franz-Xaver-Kapelle: Der Kapelle vorgelagert ist ein Fresko von Martin Johann Schmidt. Es
beschreibt den Tod des hl. Franz Xaver (1506-1552). Dieser war Jesuit
und gründete eine Christengemeinde in Japan. Er starb auf einer
weiteren Missionsreise auf Sancian. 1616 bestand hier nach Eintragungen
der Jesuiten das Nordtor. Der Vorbau trägt außen unter dem Dachgesimse
einen in Rot und Schwarz gehaltenen Buchstabenfries, der ins Deutsche
übersetzt lautet: Das über dieses Tor gestellte T schrecke die Feinde!
Jesus von Nazareth, König der Juden, König der Glorie, komme mit dem
Frieden! 1483.

1776 trat an die Stelle der Jesuiten der Schulorden der Piaristen.
Diese hatten 1749 in St. Pölten ihre erste Niederlassung gegründet und
wurden nach der Aufhebung des Jesuitenordens von der Kaiserin Maria
Theresia ersucht, das von den Jesuiten geräumte Kollegium und die
Kirche in Krems zu übernehmen.

Der Altar an der Nordseite wurde 1755 errichtet. Das Altarblatt „hl.
Josef mit dem Christuskind" wurde ebenfalls vom Kremser Schmidt
geschaffen. Oberhalb ist die hl. Anna, die ihre Tochter Maria das Lesen
lehrt, dargestellt. Die Figuren zeigen links die hl. Barbara und rechts
die hl. Margarethe.
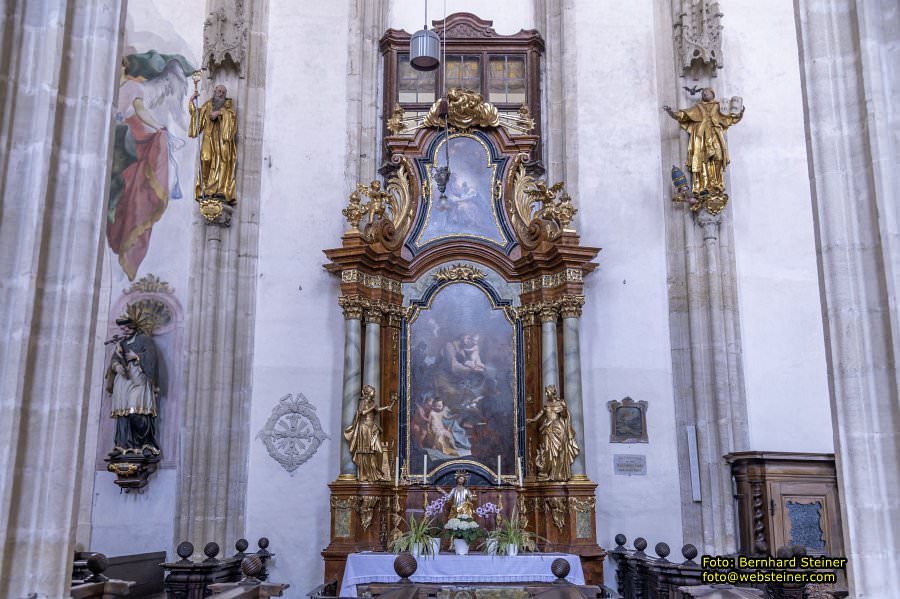
Das Altarblatt des südseitigen Altares
mit dem Thema „hl. Aloysius geleitet einen Knaben zum Altar" stammt von
Martin Johann Schmidt, 1755. Das Oberbild stellt die Hl. Dreifaltigkeit
dar. Die Figuren zeigen den hl. Ignatius und den hl. Stanislaus Kostka
mit dem Jesuskind.

Die unter den Baldachinen stehenden polychromierten Heiligenfiguren
gehören dem Rokoko an (um 1756). Die Wandpfeiler im Chorraum zeigen
Heilige des Alten Testaments. Die abendländischen Kirchenlehrer mit
Gregorius, Ambrosius, Hieronymus und Augustinus finden sich an der
östlichen Strebepfeilerreihe. Die Figuren der Ordensgründer Benedictus,
Bernardus, Dominikus und Franziskus sind an der mittleren
Strebepfeilerreihe aufgestellt. Der Wetterheilige Donatus und die
beiden Landespatrone Leopoldus und Florianus stehen im Hauptschiff. Der
Bildschnitzer stand wohl in Verbindung mit Johann Baptist Peran (+1767
in Krems) - möglicherweise ein Mitarbeiter.
