web steiner
Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen
Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.
+43/2624/54014 - office@websteiner.com
Festung Kufstein
Kufstein, November 2024
Kufstein ist eine Stadtgemeinde in Tirol an der
Grenze zum Freistaat Bayern und Verwaltungssitz des Bezirks Kufstein.
Die Stadt liegt im Tiroler Unterland und Unterinntal und ist mit über
20.000 Einwohnern nach Innsbruck die zweitgrößte Stadt des Bundeslandes
Tirol. Die Festung Kufstein ist das Wahrzeichen der Stadt Kufstein und
zählt zu den imposantesten mittelalterlichen Bauwerken Tirols. Heute
ist sie ein Museum und eine Veranstaltungsstätte.

Als Margarete von Tirol-Görz (1318-1369) sich im Jahre 1342 mit Ludwig
I. von Bayern-Brandenburg vermählte, wurde Kufstein zum ersten Mal in
der Geschichte ein Teil Tirols. Diese Hochzeit erfuhr im ganzen Land
große Zustimmung und dies obwohl Papst Clemens VI. sie nicht anerkennen
wollte und deshalb ein „Interdikt“ über das Land Tirol verhängte.
Margarete und Ludwig wurden vom Papst „bannt". Davon unbeeindruckt
blieben sie sich treu und herrschten gemeinsam noch neunzehn Jahre lang
über Tirol.

Teile der Altstadt (Römerhofgasse, Kirchgasse, Unterer Stadtplatz,
Innpromenade) sind als touristische Ziele beliebt, so das Weinhaus
Batzenhäusl und das ehemalige Wirtshaus und heutige Weinhaus &
Hotel Auracher Löchl, wo Karl Ganzer das Kufsteinlied schrieb. Den
typischen Inn-Salzach-Stil hat Kufstein bei einem großen Brand im
Mittelalter, dem fast die gesamte damalige Stadt zum Opfer fiel, zum
Großteil verloren. Am Unteren Stadtplatz weisen aber dennoch einige
Gebäude Merkmale wie Stirnmauern, Laubengänge (allerdings verbaut) und
große Erker auf.

Das Kufsteinlied (auch das Kufsteiner Lied) ist ein bekanntes
volkstümliches Lied des deutschen Sprachraums. Es wurde 1947 von dem
Tiroler Karl Ganzer komponiert. Durch die Schallplattenaufnahme des
bayerischen Sängers und Jodlers Franzl Lang im Jahr 1968 wurde das Lied
zu einem der größten Hits des volkstümlichen Schlagers. Das
Kufsteinlied begründete den häufig zitierten Beinamen Kufsteins als
Perle Tirols bzw. Stadt am grünen Inn und ist ein Werbeträger für die
Tourismusstadt Kufstein.
Das aus drei Strophen bestehende Kufsteinlied mit gejodeltem Refrain
handelt von einem Urlaub in Kufstein und besingt volkstümlich
verklärend Landschaft, Berge, das „Maderl“ und den Wein. In der dritten
Strophe beschreibt der Text das Ende des Urlaubs und die Heimfahrt. Das
Stück wird häufig fälschlich als ein Tiroler Volkslied oder als
Regionalhymne angesehen.

Kühl, erfrischend und kristallklar strömt das Wasser aus Kufsteins
Brunnen und Wasserhähnen. Was heute selbstverständlich anmutet, mag
noch gegen Ende des 19. Jahrhunderts als Sensation gegolten haben -
schließlich war die Trinkwasserbeschaffung bis dahin unweigerlich mit
dem Gang zu einem der zahlreichen öffentlichen Brunnen verknüpft. Von
den drei Brunnen, die einst die Wasserversorgung der Innenstadt
gewährleisteten, ist nur noch der um das Jahr 1861 erbaute neogotische
Marienbrunnen übrig. Im Jahr 2015 wurde er vom Heimatverein Kufstein
mit einer originalgetreuen Nachbildung der seit etwa hundert Jahren
verschollenen Brunnenspitze versehen.

Das Rathaus Kufstein steht am Unteren Stadtplatz der Stadtgemeinde
Kufstein im Bundesland Tirol. Das Rathaus aus der ersten Hälfte des 16.
Jahrhunderts ist im Kern erhalten. 1923 entstand mit einem Umbau die
Treppengiebelfassade. Das spätgotische Netzgratgewölbe wurde 1965
renoviert.
RATHAUS
Um 1500 als Haus des Baumgartnerischen Benefiziaten hat um 1511 "ein
Rath und gemein Stadt Kuefstein daselbshin ein Rathaus gebauen."
1923/24 erfolgte die Erweiterung und der Aufbau des Stufengiebels
1974 Ausbau des Rathaussaales mit gotischem Gewölbe


Auf dem Weg vom unteren Stadtplatz hinauf zur Kirche sieht man das
Denkmal für den verdienstvollen Stadtpfarrer Dr. Matthias Hörfarter
(1859-1896). Dieses schuf 1899 der Berliner Bildhauer NORBERT
PFRETSCHNER. Wegen ihrer Lage auf dem schmalen Vorsprung des
Festungsberges war die Kirche nie auf Fernwirkung angelegt und besitzt
deshalb auch keine betonte Schaufassade. Das einfache Hauptportal mit
der Jahreszahl 1666 wurde bei der Erweiterung 1840 hierher versetzt.
Der Turm trug bis 1703 einen Spitzhelm, der nach dem Brand aus
militärischen Gründen nur mehr als Zwiebelhaube erneuert werden durfte.

Das Rathaus zeigt seit 1925 die Wappen der Tiroler Städte Innsbruck,
Sterzing, Imst, Vils, Lienz, Rattenberg, Brixen, Bruneck, Schwaz,
Klausen, Kitzbühel, Glurns, Bozen, Landeck, Meran, Hall und unter der
Giebelspitze Kufstein.
In seinen Grundzügen stammt das Rathaus aus der ersten Hälfte des 16.
Jahrhunderts. Damals wie heute bildet es den Sitz der Stadtregierung
und -verwaltung. In der Zwischenkriegszeit erfolgte der Umbau des einst
gotischen Gebäudes, im Zuge dessen die charakteristische
Treppengiebel-Fassade entstand. Die 2011 durchgeführte Sanierung wurde
im Folgejahr unter anderem mit dem Österreichischen Bauherrenpreis
ausgezeichnet. Denen, die genau hinhören, weiß die Fassade des
Rathauses jedoch nicht nur Erfolgsgeschichten zu erzählen...
Bis ins 19. Jahrhundert befand sich an einem Balkon im ersten Stock an
der Ecke des Rathauses der Kufsteiner Pranger. Hier wurden Verurteilte
angekettet und zur Schau gestellt. Mitfühlende Menschen hatten die
Möglichkeit, den Gepeinigten Münzen in einen bereitgestellten Hut zu
legen. Im Anschluss an das Prangerstehen wurden die Verurteilten mit
Rutenhieben unter dem Spott der Schaulustigen über den Marktplatz
getrieben. Zuletzt beförderte man sie mit einem Fußtritt aus dem Oberen
Stadttor. Der Hut mit den Münzen wurde ihnen hinterhergeworfen. Die
Zeit, in der Menschen an Häuserfassaden an den Pranger gestellt wurden,
ist glücklicherweise vorbei; heute aber dienen nicht selten virtuelle
Räume als Schauplätze dieser niederträchtigen Praxis.

Das Matthäus-Hörfarter-Denkmal
Wohl kaum ein Mensch hat sich in Kufstein so beherzt und erfolgreich
für Belange wie Frühförderung, Bildung und Chancengleichheit
eingesetzt, wie Matthäus Hörfarter. Dabei lagen zahlreiche Hindernisse
auf dem bewegten Lebensweg des Geistlichen. Matthäus Hörfarter wurde
1817 als Sohn eines Bauern in Kössen geboren. Der als kränklich
beschriebene Junge eignete sich wohl nicht für die harte körperliche
Arbeit am Hof und wurde von der Kirche in Bildungsobhut genommen. Mit
nur 25 Jahren wurde Hörfarter zum Priester geweiht. Nach seinem
Doktoratsstudium in Rom trat er eine Professur in Salzburg an. Als
Anhänger des liberalen Reformkatholizismus wurde der junge Geistliche
dort jedoch angefeindet. So verschlug es ihn als Pfarrer und Dekan nach
Kufstein. Hier gründete er 1870 den ersten Kindergarten Tirols und
finanzierte später die erste Ausbildungsstätte für Kindergärtnerinnen
in ganz Österreich. Zudem reformierte er die Volksschule und gründete
eine Fortbildungsschule für Mädchen. Neben der Bildung hatte sich der
umtriebige Pfarrer auch der Natur verschrieben; im Jahr 1877 rief er
die Alpenvereinssektion Kufstein ins Leben. Hörfarter förderte unter
anderem die Erschließung des Kaisergebirges und war somit ein Pionier
des Fremdenverkehrs in Kufstein.

Die Stadtpfarrkirche St. Vitus wurde Anfang des 15. Jahrhunderts im
Stil der Gotik errichtet und um 1660 im Stil des frühen Barocks
renoviert. Mitte des 19. Jahrhunderts erfolgte eine Ausstattung mit
klassizistischem Mobiliar, um dem Geschmack der damaligen Zeit gerecht
zu werden. In der gegenüberliegenden Dreifaltigkeitskirche hatten von
1681 bis 1810 Mitglieder des Augustinerordens eine Niederlassung. Auch
diese Kirche wurde einst in gotischem Stil erbaut und verfügt heute
über eine Rokoko-Ausstattung. Darunter befindet sich die ehemalige
Grabkirche.

Die Pfarrkirche ist dem Heiligen St. Vitus geweiht. Dieser Märtyrer
wurde der Legende nach an der Südwestküste Siziliens geboren und um das
Jahr 300 als erst Siebenjähriger in siedendes Öl geworfen. Er gilt
unter anderem als Patron der Bierbrauer, Apotheker, Schauspieler, der
Lahmen, Tauben und Blinden sowie der Haustiere.

Auf den ersten Blick bietet sich der Innenraum als dreischiffige
gotische Hallenkirche mit einem Chor im 3/8-Schluss dar. Aus den
schlanken, in den ersten drei Jochen sechseckigen Tuffsteinsäulen
wachsen schön profilierte Gurtbogen ohne den Übergang eines Kapitells
heraus: Kennzeichen der späten Gotik. Die lichten Maße: 34,3 m lang,
15,5 m breit, 9,8 m hoch.

Die Altaraufbauten in Stucco lustro schuf der heimische Bildhauers
Josef Stumpf. Das Hochaltarblatt thematisiert die Glorie des
Kirchenpatrons St. Vitus, am linken Seitenaltar thront die Gottesmutter
mit Jesuskind zwischen den hll. Barbara und Katharina, während das
rechte Altarblatt die Losbindung des toten Märtyrers Sebastian vom Baum
zeigt. Die der besten Schaffensperiode Josef Arnolds zugehörigen Bilder
zeigen den führenden Tiroler Maler des Spätklassizismus. Josef Arnold
der Ältere (1788-1879) aus Stans bei. Schwaz, in Innsbruck ansässig,
war sowohl Fresken- als auch Tafelbildmaler.
Die erneuerten liturgischen Orte Volksaltar (gespendet von der Baufirma
Anton Rieder) und Ambo schuf Steinmetz J. GUGGENBERGER, Kramsach, nach
Entwürfen von Architekt PETER SCHUH, Salzburg.
Der Tabernakel wurde 1911 bei Bildhauer FRANZ EGG, Innsbruck, und Goldschmied JAKOB PHILIPP RAPPEL, Schwaz, bestellt.

1976 wurde durch die Tiroler Orgelbauanstalt REINISCH-PIRCHNER,
Steinach, eine neue Orgel errichtet. Das Werk hat 21 Register, verteilt
auf Hauptwerk, Rückpositiv und Pedal.

Das älteste Mobiliarstück, welches heute in der Kirche zu finden ist, stellt der klassizistische Hochaltar
des Tiroler Bildhauers Josef Stumpf dar. Dar Altaraufbau besteht im
Wesentlichen aus zwei auf Postamenten stehenden Säulen mit ionischen
Kapitellen, welchen einen Dreiecksgiebel tragen. Direkt unterhalb des
Giebels findet sich ein ornamentaler Zierfries mit floralen Motiven und
Engelsköpfen. Der Giebel selbst trägt in seinem Zentrum das aus dem
Barock stammende Symbol für Gott: ein Dreieck mit einem Auge in der
Mitte, umgeben von einem Strahlenkranz. Flankiert wird der Altar von
zwei Apostelstatuen, welche vermutlich vom Kufsteiner Bildhauer Kaspar
Bichler (19. Jahrhundert) stammen. Vom Altar aus gesehen rechts findet
sich Petrus, erkennbar an den Schlüsseln in seiner Hand, und links
Paulus, zu identifizieren anhand des Schwertes und des Evangeliums in
seinen Händen.
Das Altargemälde stammt vom Tiroler Künstler Josef Arnold dem Älteren
(1788–1879) und zeigt den Titelheiligen der Kirche (Hl. Vitus) als
Märtyrer vor Maria und Christus. Als Märtyrer weist ihn neben dem
Lorbeerkranz über seinem Haupt auch eines seiner Attribute aus – der
Kessel mit siedend heißem Öl. Arnolds Stil ist eine Mischung aus
klassizistischen und romantischen Elementen: Kleidung, Haltung, Mimik
und Gestik der Figuren erinnern an Heinrich Friedrich Füger, das
Kolorit hingegen an die Nazarener.

Deckenbilder - Den Schmuck der
Decke erhielt die Kirche 1929 durch den akad. Maler RUDOLF STOLZ
(1874-1960) aus Bozen, Vertreter einer neusachlich-expressiven
Stilrichtung, der sich bei einem Wettbewerb gegen die neobarock
geprägten Entwürfe des Innsbrucker Malers Raffael Thaler durchsetzte.
Die Bilder mit einem umfangreichen ikonographischen Programm des
führenden Tiroler Meisters der monumentalen Wandmalerei hatten sich
ursprünglich über die gesamte Gewölbefläche erstreckt, wurden aber bei
der Innenrestaurierung 1959/60 teilweise übermalt. 2009 konnte der
Großteil der mit sensibler Einfühlung geschaffenen Secco-Begleitmalerei
wieder freigelegt werden, ebenso die Deckenmalerei im Chor. Die
eindrucksvollen Gestalten versinnbildlichen im ersten Gewölbe des
Hauptschiffs die vier großen Propheten des Alten Bundes (Isaias,
Jeremias, Daniel und David), im zweiten Gewölbe die vier Evangelisten
(Matthäus, Markus, Lukas und Johannes) und im dritten Gewölbe die vier
letzten Dinge des Menschen (Tod, Gericht, Himmel und Hölle). Ebenso
stammt das Bild des „Göttlichen Kinderfreundes" unter der Orgelempore
von Stolz.
Das zweite Joch zeigt die vier Evangelisten anhand der ihnen
zugeordneten Symbolen und namentlichen Inschriften. Zudem finden sich
darüber verschiedene Darstellungen. Im Zentrum dieses Joches,
eingelassen in ein Loch, findet sich eine Heiliggeist-Taube, umgeben
von einem goldenen Strahlenkranz. Über dem Evangelisten Markus (Löwe)
findet sich der Heilige Johannes der Täufer, ihm gegenüber – oberhalb
des Evangelisten Lukas (Stier) – sein Vater, Zacharias. Über dem
Evangelisten Matthäus (geflügelter Mensch) erkennt man Maria an der
Wiege Christi, hinterfangen vom bethlehemitischen Stern und als
Letztes, ihr gegenüber, oberhalb des Evangelisten Johannes (Adler)
Christus mit einem offenen Buch in der Hand, auf welchem die
griechischen Buchstaben Alpha und Omega zu lesen sind. Diese beziehen
sich auf einen biblischen Vers nach Off. 22,13: „Ich bin das Alpha und
das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende“.
2. Gewölbejoch: Die Evangelisten

Der gotische Bau der St. Vitus-Kirche wurde spätestens 1420 vollendet
und bildete den Nachfolgebau einer bereits bestehenden Kirche. Es
handelt sich dabei um eine dreischiffige Hallenkirche mit polygonalem
Chorabschluss.
In den Jahren 1660 bis 1661 wurde sie barockisiert, um sie dem
Geschmack der Zeit anzupassen. Diese Änderungen sind noch heute
sichtbar: Fassade, Turmabschluss, Zwiebelhelm und Außengestaltung sowie
Farbgebung entstammen haben mit der gotischen Erscheinung der Kirche
nichts mehr gemein. Auch die Betonung der Fassadenmitte durch einen
Risalit und die Unterteilung mittels farblich abgesetzter Pilaster und
Lisenen ist charakteristisch für den frühen, noch relativ streng
wirkenden Barock.

Kreuzweg

DREIFALTIGKEITSKIRCHE UND TOTENGRUFT

Diese schmucke Kapelle verdankt ihr Entstehen dem frommen Sinn des
Kufsteiner Bürgers Christian Weinränntl, der 1502 „in der Gruft seiner
Neuen Capellen neben St. Veits Kirchen eine ewige und tägliche Meß"
stiften ließ. Dort befindet sich noch sein Grabstein. Wappengrabsteine
aus dem 16. Jahrhundert sind auch an der Nordfassade erhalten. In ihrem
heutigen Aussehen stammt die Kapelle aus dem Jahr 1705, als nach dem
verheerenden Brand das Netzgratgewölbe samt dem Chorschluss neu
aufgeführt werden musste. Den Umbau leitete damals Stadtbaumeister
MARTIN BOCK. Die Augustiner benützten während ihrer Wirksamkeit in
Kufstein die Dreifaltigkeitskirche als Hauskapelle.
Der herrliche Rokoko-Baldachinaltar stellt die Krönung der Gottesmutter
durch die Hl. Dreifaltigkeit dar. Der grazile Aufbau und der plastische
Schmuck rechtfertigen eine Zuschreibung der Arbeit an den Bildhauer
FRANZ STITZ (Zell bei Kufstein, um 1765). Das Bild Mariens findet sich
in der Mitte in einem reich getriebenen Rocaillerahmen. Es ist ein
Maria-Trost-Bild der Madonna vom schwarz-ledernen Gürtel, vom Orden der
Augustiner (sowohl Eremiten als auch Chorherren) in
Maria-vom-Trost-Bruderschaften und „Gürtelbruderschaften Maria vom
Trost" besonders verehrt. Vermutlich schuf dieses vorzügliche Ölbild
der aus Tarrenz bei Imst gebürtige Maler JOHANN MICHAEL GREITER
(1736-1786), der vornehmlich für Augustinerklöster arbeitete (vgl.
Seefeld, Rattenberg und Salzburg-Mülln).
Unter dem Marienbild gruppieren sich um den Tabernakel die Heiligen des
Augustinerordens, in der oberen Reihe (v. I. n. r.): hl. Augustinus,
Ordenspatron (+ 431); hl. Nikolaus von Tolentino, Bekenner (+ 1306);
hl. Johannes a. S. Facundo, Bekenner (+ 1479); hl. Clara von
Montefalco, Äbtissin und Mystikerin (+ 1308); in der unteren Reihe: hl.
Thomas von Villanova, Bischof und großer Wohltäter (+ 1555); hl.
Gelasius, Papst (+ 496); sel. Johannes Bonus, Ordensstifter (+ 1249);
hl. Wilhelm von Maleval, Ordensstifter († 1157).
Innenraum der Dreifaltigkeitskirche, links vom Altar die barocke Kreuzgruppe, rechts ein Herz-Jesu-Bild aus dem 19. Jahrhundert

Das wichtigste Wahrzeichen ist ohne Zweifel die Festung Kufstein auf
dem 90 m hohen Festungsberg im Zentrum der Stadt, die erstmals im 13.
Jahrhundert erwähnt wurde. Weithin sichtbar ist der repräsentative
Kaiserturm, der 1518–1522 errichtet wurde. Im 18. Jahrhundert und
während der Besatzungszeit nach dem Zweiten Weltkrieg diente die
Festung als Gefängnis.

Orgel der Festung Kufstein: Auf der Festung Kufstein befinden sich mit
der stadtweit hörbaren Heldenorgel die größte Freiluftorgel der Welt
und ein Heimatmuseum.

Urkundlich erwähnt wurde die Festung erstmals im Jahre 1205. Vermutlich
wurde jedoch spätestens im 12. Jahrhundert eine einfache romanische
Burganlage am höchsten Punkt des Felsens erbaut. Seit jeher bestand
eine der Hauptaufgaben der Anlage darin, Angriffe abzuwehren; lange
Zeit aber befand sich auf der Burg auch der Verwaltungssitz des
Gerichtes Kufstein. Zahlreiche Belagerungen und Kriege musste die
Festung zwischen dem 14. und 19. Jahrhundert über sich ergehen lassen.
Immer wieder mussten Teile von ihr als Gefängnis herhalten. Von den
Nationalsozialisten wurde sie darüber hinaus für NS-Propagandazwecke
vereinnahmt. Seit der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts scheint
nun aber endlich der Frieden Einzug in die mitgenommenen Gemäuer
gehalten zu haben.

Die Festung Kufstein hat wahrlich viele Gesichter. Heutzutage aber muss
sie sich nicht mehr so grimmig und wehrhaft zeigen wie früher. Die
Menschen, die nun zwischen ihren geschichtsträchtigen Mauern wandeln,
wollen sie nicht mehr bezwingen oder zerstören. Sie wollen von ihrer
bewegenden Geschichte lernen, auf ihren breiten Schultern dramatische
Ausblicke ins Umland genießen, sich beim Ritterfest oder
Operettensommer vergnügen oder am Weihnachtsmarkt verzaubern lassen.
Dabei zeigt sich die Festung heute wohl so vielseitig, charmant und
eindrucksvoll, wie noch nie in ihrer über 800 Jahre langen Geschichte.

800 Jahre Geschichte auf 24.000 m²
In einer Urkunde aus dem Jahr 1205 findet sich die Burg Kufstein zum
ersten Mal erwähnt. Aus diesem „chastrum choufstain" ging im Lauf der
Jahrhunderte jene Festung hevor, die sich heute auf einem Dolomitfelsen
in drei Terrassen von Norden nach Süden erstreckt. Ihre Ausmaße sind
gewaltig: Die Festung nimmt eine Länge von 400 Metern und eine Fläche
von mehr als 24.000 Quadratmetern ein. Als Werk von mehreren
Generationen trägt sie die Stempel unterschiedlicher Epochen,
Zeitumstände und Einflüsse ... und macht so 800 Jahre Geschichte
anschaulich.

Auf Ihrem Rundgang durch das imposante Festungsgelände erleben Sie das
Geschehen von Jahrhunderten wie im Zeitraffer. Lassen Sie sich dabei
ganz von Ihren Interessen leiten! In vier Abschnitten gibt der
Festungsparcours Einblicke in unterschiedliche Kapitel der
Festungsgeschichte. Ausstellungen und Multimedia-Installationen laden
Sie dazu ein, sich Ihr eigenes Bild zu machen: vom Kräftemessen der
Herrscherhäuser, von bahnbrechenden Entwicklungen im Festungsbau, vom
Leben auf einer Festung... und von einer Region, in der es über
politische Grenzen hinweg regen wirtschaftlichen und kulturellen
Austausch gab.

Aufstieg zur Grenzfestung -Kufstein kommt zu Tirol
Waren zu Beginn des 13. Jahrhunderts noch der Herzog von Bayern und das
Bistum Regensburg Besitzer der Burg Kufstein, konnten sich bis 1213 die
bayerischen Herzöge als alleinige Herrscher durchsetzen. Auch die
Grafschaft Tirol lag damals in ihrem Herrschaftsbereich, begann sich
aber unter den Grafen von Tirol zunehmend von Bayern zu lösen. Im Lauf
des 13. Jahrhunderts etablierte sich Tirol als selbstständiges Land.
Mitte des 14. Jahrhunderts vermachte dann die damalige Landesherrin
Tirols, Margarete „Maultasch", ihren Besitz mangels Erben noch zu
Lebzeiten ihren nächsten Verwandten, den Habsburgern.
Doch auch die bayerischen Wittelsbacher erhoben Erbansprüche an dem
wirtschaftlich und strategisch bedeutenden Land - schließlich war
Margarete in zweiter Ehe mit einem der Ihren verheiratet gewesen. Die
bayerischen Angriffe blieben indes erfolglos, und 1369 fiel Tirol im
Frieden von Schärding endgültig an die Habsburger. Nicht jedoch
Kufstein, Kitzbühel und Rattenberg - diese standen weiterhin im
Einflussbereich Bayerns. Im bayerischen Erbfolgekrieg witterte der
Habsburger Maximilian I. dann aber die Chance, die drei Herrschaften
für Tirol zu gewinnen. Die Eroberung Kufsteins 1504 machte ihn zum
Herrn des Unterinntales und Kufstein zur Grenzfestung.

Kaiserturm - Nach Vorstellungen
Kaiser Maximilians I. von 1518 bis 1522 unter Baumeister Michael Zeller
errichteter und den neuesten militärischen Anforderungen laufend
angepasster Kanonenturm. An der Basis sind die Mauern 7,5 Meter stark.
Seit Kaiser Maximilian I. die Festung Kufstein umbauen ließ, prägt der
Kaiserturm die Wehranlage hoch über der Stadt. Ursprünglich als
Geschützturm erbaut, war er im 18./19. Jahrhundert Teil des
Staatsgefängnisses auf der Festung Kufstein. Der Kaiserturm erhielt
damit eine andere Funktion: Nach dem Einbau von 13 Zellen waren hier
vor allem politische Häftlinge inhaftiert. 1865 wurde das
Staatsgefängnis aufgelassen.

Erbauung: 1518-1522
Baumeister: Michael Zeller
Grundrissform: kreisrund
Mauerdicke: rd. 4 bis 7,5 m
Innerer Durchmesser: ca. 21 m
1734-1745: Sein heutiges Aussehen verdankt der
Kaiserturm einem barocken Umbau. Johann Martin Gumpp d. J. gestaltete
das oberste Geschoss neu und veränderte dabei auch den Dachstuhl.
1745-1760: In den Turm wurden im dritten Stock 13 Gefängniszellen eingebaut.

Die Festung Kufstein – ein Staatsgefängnis in revolutionären Zeiten
Gleich drei große Revolutionen erfassten Europa im ausgehenden 18. und
der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts: 1789 stellte die Französische
Revolution die Welt auf den Kopf auch 1830 und 1848 nahmen große
Revolutionswellen ihren Ausgang in Frankreich. Bürgerinnen und Bürger
verlangten Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, forderten
Mitbestimmung und Reformen. In der Habsburgermonarchie, dem
„Vielvölkerstaat", drängten Volksgruppen wie Ungarn, Tschechen oder
Italiener auf „nationale" Unabhängigkeit. Auch die deutschsprachigen
Österreicher strebten einen deutschen Nationalstaat an.
In allen diesen Zeiten ging die Obrigkeit hart gegen Andersdenkende
vor, schlug Aufstände nieder und brachte jene, die sich regimekritisch
äußerten, hinter Gitter. Auch im Kufsteiner Staatsgefängnis büßten
Menschen für ihre Überzeugungen mit langjährigen Haftstrafen.
Ausgewählte Biografien dieser Häftlinge geben Einblick in den
Gefängnisalltag und die Haftbedingungen zu verschiedenen Zeiten in der
etwa hundertjährigen Gefängnisgeschichte.
Die Festungshaft galt als eine besondere Form der Freiheitsstrafe, die
vor allem über Angehörige höherer Stände und bei politischen Vergehen
wie Landes- und Hochverrat verhängt wurde. Im 18. Jahrhundert waren
wichtige Festungen der Habsburgermonarchie in Gefängnisse umgewandelt
worden, wie Spielberg bei Brünn, Munkács im heutigen Ungarn und eben
auch Kufstein. Die Verurteilten waren ohne Beschäftigung sich selbst
überlassen. Sie saßen ihre Strafe möglichst weit von ihren Heimatorten
entfernt ab, was eine Flucht verhindern oder zumindest erschweren
sollte. Art und Umfang der Strafen waren im Strafgesetzbuch geregelt.
Verurteilungen waren jedoch sehr langwierig. Oft saßen die Angeklagten
jahrelang in Untersuchungshaft bis das Urteil von mehreren Instanzen
geprüft und vom Kaiser bestätigt wurde.

Im Laufe der etwa hundertjährigen Geschichte des Staatsgefängnisses
Kufstein erlebte das Strafgesetz mehrere Reformen. Dabei stand das
Bemühen um humanere Bestimmungen (Abschaffung der Folter) gegen den
Wunsch, möglichst abschreckende Strafen androhen zu können. 1787
unterschied man unter Josef II. zwischen kriminellen und politischen
Straftaten und beschrieb diese in 82 Paragraphen. Er schaffte die
Todesstrafe ab und setzte stattdessen auf harte, lange Haftstrafen.
Franz II. führte nur acht Jahre später die Todesstrafe wieder ein und
unterteilte die Haft nach der Schwere der Haftbedingungen in drei
Grade. Aus diesem Strafgesetzbuch von 1803 wurde 50 Jahre später die in
Teilen aktualisierte Fassung von 1852. Dieses blieb faktisch über das
Ende der Monarchie bis in die 1970er-Jahre in Kraft.
Nach dem damals geltenden Strafgesetz mussten auch politische Gefangene
Fußfesseln tragen. Ferenc Kazinczy wurde 1799 sogar angedroht, dass man
ihm eine große Kugel anschmieden werde, wenn er sich nicht ordentlich
verhalte. Als Haftkleidung dienten eine Wolljacke mit Zinnknöpfen und
eine Wollhose mit Lederknöpfen an den Seiten. Ihre Privatkleidung
konnten in Kufstein jene Häftlinge tragen, die mehr als ein Gewand
besaßen. Alle anderen mussten ihre Kleidung bei Haftantritt abgeben und
erhielten sie erst bei der Entlassung zurück.
Sándor Rózsa in Ketten auf der Festung Kufstein. Darauf ist zu erkennen, wie das Kettenband am Hüftgurt befestigt wurde.
Diese Fußfessel wurde von einem Häftling in der Festung Kufstein
getragen. Das lange Kettenband wurde dabei um den Hüftgurt geschlungen,
um leichter gehen zu können.

In Kufstein kontrollierte und bewachte das Militär die Gefangenen. Das
Festungs-kommando - abwechselnd von verschiedenen Regimentern gestellt
- musste in regelmäßigen Abständen dem Hofkriegsrat bzw. dem
Ministerium mit Sitz in Wien berichten: Es wurde über die Gefangenen
detailliert Protokoll geführt und ihr Verhalten in sogenannten
Standesausweisen festgehalten. Zeitweise wurden die Gefangenen -
möglichweise zur Geheimhaltung - ohne Angabe der Namen nur unter einer
Nummer geführt.
Im Staatsgefängnis auf der Festung Kufstein waren sowohl politische als
auch kriminelle Gefangene inhaftiert. Sie waren entweder im dritten
Stock des Kaiserturms, im Stabsstockhaus (1938/39 abgerissen) oder auch
in Räumen der Oberen Schlosskaserne untergebracht. Doch wer waren die
Gefangenen, die in Kufstein einsaßen? Ihre Namen und die Strafen, die
sie verbüßten, lassen sich heute nur mehr schwer herausfinden.
Originaldokumente wie „Standesausweise", in denen Personaldaten
vermerkt waren, sind nur aus wenigen Jahren erhalten. So führt die
Spurensuche über die Originalquellen hinaus zu Abschriften aus jüngerer
Zeit.
In der Festung Kufstein waren Männer und Frauen aus vielen Regionen des
Habsburgerreichs inhaftiert, darunter viele Gefangene nicht deutscher
Muttersprache. Bis ins 19. Jahrhundert war es üblich, ihre Namen nach
Gehör zu notieren. Erst später gab es Versuche, beim Abschreiben der
„eingedeutschten" Namen zur Herkunftssprache zurückzukehren. Aus diesem
Grund liegen verschiedene Schreibweisen vor. Hinzukommt, dass nicht zu
jedem Gefangenen die Haftursache vorliegt.

Sándor Rózsa
*13.7.1813 in Szegedin/Ungarn; † 22.11.1878 in Szamosújvár/Siebenbürgen
Haftdauer: um 1858-1868
In Kufstein inhaftiert: 7.1859-8.1865
Ein Räuberhauptmann in Kufstein
Der gefürchtete Bandenchef Sándor Rózsa unterstützte 1848 mit einer
Reiterschar die ungarische Revolution. Nach deren Niederschlagung nahm
er sein Räuberleben wieder auf. Ab 1856 wurde er auch wegen unzähliger
Mord- und Raubzuge gesucht und geriet um 1858 in Haft. Rósza wurde zum
Tod durch den Strang verurteilt und später zu lebenslänglicher
Festungshaft mit schwerem Eisen begnadigt Die Haft musste er in
Kufstein absitzen möglichst weit weg von seinen bisherigen
Wirkungsorten und damit mit geringer Aussicht auf Flucht. Nach acht
Jahren Haft, in denen er sich vorbildlich verhalten haben soll, wurde
er 1868 begnadigt. Kurz darauf betätigte er sich jedoch wieder als
Räuberhauptmann, wurde 1869 verhaftet und starb 1878 in einem
ungarischen Gefängnis.
Sándor Rózsa - Held oder Verbrecher?
Rózsa übte auch über seinen Tod hinaus eine große Anziehungskraft auf
Menschen aus. Diese Berühmtheit ließ wohl auch den 1880 auf der Festung
stationierten Soldaten Baier zum Pinsel greifen und Rózsa malen. Das
Gemälde, das Rózsa im Gewand eines Pferdehirten zeigt, wurde später
zerstört. Die Kopie, die sich heute an der Zellenwand befindet, konnte
nach einer Fotografie angefertigt werden. Bereits zu Lebzeiten rankten
sich um Sándor Rozsa etliche Mythen. So trug auch literarische
Verklärung dazu bei, dass aus dem Rauberhauptmann eine romantische
Figur à la Robin Hood wurde. Das führte zu mancher Diskussion darüber,
ob Rózsa als Held oder Verbrecher wahrzunehmen ist.
Eine gelungene Flucht aus dem Kaiserturm ist nicht bekannt. Den
spektakulärsten Versuch wagten die Polen Stanisław Marynowski und
Kaspar Cięglewicz 1842 von dieser Zelle aus. Mit einem Stück Blech des
Ofens gruben sie unter dem Fenster ein Loch, um dann mit einem Band aus
Leintuchstreifen die knapp darunter liegende Mauer zu erreichen.
Marynowski schaffte es, Cięglewicz passte nicht durch das Loch. Weit
kam aber auch Marynowski nicht, weil ein Geräusch die Wachen
alarmierte. Auch bei Rózsa befürchtete man einen Ausbruch. Als die Wachen hinter
einem nachts aufblitzenden Licht im Wald den Versuch vermuteten,
Kontakt mit ihm aufzunehmen, ließ man sein Zellenfenster mit Holz
verschlagen. So verblieb er in der Festung bis zu seiner Verlegung.

Die Ideen der Französischen Revolution verbreiten sich
Österreich blieb nicht unberührt von den Entwicklungen in Frankreich.
Forderungen nach Menschen- und Bürgerrechten, einer konstitutionellen
Monarchie oder gar der Ausrufung einer Republik waren auch in der
Habsburgermonarchie zu hören. Doch die Obrigkeit ging rücksichtslos
gegen die Anhänger einer neuen Ordnung vor. Der Kaiser, der sich einer
möglichen Gefahr durch französische Agenten bewusst war, ließ
verdächtige Ausländer, insbesondere Franzosen und Italiener,
überwachen. Einige von ihnen wurden verhaftet, aus Sorge, das
Gedankengut könnte „überspringen“.
Unter Verdacht -„Jakobiner" in Österreich
Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, die Schlagworte der Französischen
Revolution, fanden auch in Österreich vielfach Anklang. Und wie die
Jakobiner in Frankreich machten sich auch in Wien und Ungarn Menschen
für die Einführung der Demokratie stark. Für sie hatte es
schwerwiegende Folgen, dass sich die französischen Jakobiner 1793
radikalisierten und ein Terrorregime errichteten. Als „habsburgische
Jakobiner" eingestuft, wurden sie den revolutionären Kräften in
Frankreich gleichgesetzt und des „Landesverrats" verdächtigt. Damit
drohte ihnen die Todesstrafe oder jahrelange Festungshaft.
Aufruf zu einem antiaristokratischen Gleichheitsbund
Mitte 1792 formulierte Andreas Riedel einen „Aufruf an alle Deutsche zu
einem antiaristokratischen Gleichheitsbund", schrieb ihn 22 Mal ab und
versandte den Text anonym an bekannte Persönlichkeiten in deutschen
Städten. Damit wollte er sie dafür gewinnen, gemeinsam mit ihm die
Situation der unteren Schichten zu verbessern. Ursprünglich überzeugt,
den Übergang zur Demokratie ohne Gewalt verwirklichen zu können, begann
er unter den besonders restriktiven Bedingungen in der Ära Franz II.
sogar über einen gewaltsamen Umsturz nachzudenken.
Dem Tod nur knapp entronnen
Als die „Jakobiner-Gruppe" um den Demokratieanhänger Riedel gefasst
wurde, verlangte Kaiser Franz II. für ihre Mitglieder die Todesstrafe,
obwohl diese im Strafgesetzbuch für Zivilisten nicht mehr vorgesehen
war. Die übermäßige Härte hat vermutlich einen persönlichen Grund.
Riedel hatte ab 1779 den damals elfjährigen späteren Kaiser und dessen
Bruder Ferdinand in Mathematik unterrichtet - sehr zum Missfallen des
kleinen Franz. Zwar konnte der Kaiser für Riedel die Todesstrafe nicht
durchsetzen, er erreichte aber seine Verurteilung zu 60 Jahren im
schwersten Gefängnis zweiten Grades auf einer Festung.

Obere Schlosskaserne
Bereich der "Ur"-Burganlage mit Wohn- und Verwaltungsräumen, entstanden
vermutlich im 12. Jahrhundert. Die heutigen Bauten stammen aus der
Barockzeit (17./18. Jh.). In diesem Teil der Oberen Schlosskaserne
befand sich das 1939 abgerissene Stabsstockhaus, das um 1800 als
Gefängnis diente. Zuvor stand hier ein Holzbau aus dem Mittelalter mit
Bäckerstube, Küche und einer Zisterne.
Maximilian I. – ein Meister der Militärtechnik
Mittelalterliche Ritterturniere waren Maximilians Leidenschaft. Auf dem
Schlachtfeld ging die Zeit der Ritter freilich zu Ende. Im Wissen darum
nutzte Maximilian I. neue Erkenntnisse des Kriegswesens. Er setzte
verstärkt auf bewegliche Fußtruppen aus Söldnern, sogenannte
Landsknechte. Bewaffnet mit Spießen und Hellebarden, revolutionierten
diese die Kriegsführung und brachten Maximilian den Beinamen „Vater der
Landsknechte" ein. Besonders angetan hatten es ihm aber die modernen
Feuerwaffen, deren Entwicklung und Einsatzmöglichkeiten. Im Raum
Innsbruck fand Maximilian ideale Voraussetzungen für den Aufbau eigener
Produktionsstätten vor: Neben einem bereits bestehenden Geschützpark
und dem hier vorhandenen Know-how waren in Tirol jene Rohstoffe im
Überfluss vorhanden, die es für die Herstellung der Kanonen brauchte.
So schuf Maximilian I. hier das modernste Artilleriewesen Europas.
Maximilian – der erste Kanonier des Reiches
Von Jugendtagen an beschäftigte sich Maximilian mit der Artillerie. In
Burgund bekam er Einblick in den damaligen Stand der Technik in Sachen
Kanonenherstellung. Fortan erwies er sich als innovativer Vordenker auf
diesem Gebiet. Der Herstellung von Geschützen in seinen Tiroler
Werkstätten wohnte Maximilian häufig persönlich bei. Er tauschte sich
mit den Meistern aus und legte in der Gusshütte selbst Hand an. Auch
brachte er eigene Ideen ein: So war der im Hintergrund der Gusshütte
abgebildete Flaschenzug für Kanonenrohre eine Erfindung Maximilians.
Auch im Feld kannte er keine Berührungsängste: Maximilian inspizierte
die Geschütze aus nächster Nähe und soll sie bisweilen sogar selbst
bedient haben mit großer Treffsicherheit. Zu Maximilians Zeiten waren
die Geschütze oftmals reich dekoriert. Sie sollten nicht nur durch ihre
Feuerkraft Wirkung zeigen, sondern auch durch ihr Aussehen: Die
Verzierungen der Kanonen setzten Maximilian als Herrscher kunstvoll in
Szene. Auch auf der hier abgebildeten Kartaune lassen sich interessante
Details erkennen.

Maximilian I. und die Plattnerkunst
„Was gibt es für einen König Größeres als einen Harnisch?", meinte
Maximilian I. Entsprechend große Bedeutung maß er der Kunst der
Rüstungsschmiede zu: In sogenannten Plattnereien wurden die
Körperpanzer aus Eisen oder Stahl gefertigt. In seiner Hofwerkstatt in
Innsbruck, die europaweit für ihre Qualität bekannt war, entstanden
nach Maximilians Wünschen und Anregungen prunkvolle Rüstungen aller
Art. Auch die Ausstattung für seine Landsknechtheere wurde hier im
Akkord hergestellt.
Die Rüstungsmode zur Zeit Maximilians I.
Die hier ausgestellten Rüstungen und Kostüme wurden nach historischen
Vorlagen angefertigt. Einmal jährlich sind sie „in Aktion" zu erleben:
Beim traditionellen Ritterfest auf der Festung Kufstein werden sie von
Mitgliedern des Heimatkundevereins Kufstein getragen, in dessen Besitz
sie stehen. Diese Beispiele zeigen, welche Elemente eine Rüstung um
1500 auszeichneten. Außerdem führen sie vor Augen, dass ihr Aussehen
immer auch Ausdruck des Zeitgeistes war: Veränderungen in der
Kriegsführung beeinflussten Machart und Stil der Rüstungen ebenso wie
die Kleidermode. In Maximilians Regierungszeit fällt die Entwicklung
des Riefelharnischs, auch „Maximiliansharnisch" genannt. Die
Riffelungen ahmen die faltenreiche Mode von damals nach, erwiesen sich
letztlich aber auch als wirkungsvoller Schutz: Sie machten das Metall
wider-standsfähiger.

Maximilian I. und Tirol
Maximilian I. gilt bis heute als eine der großen Herrschergestalten
Europas. Als römisch-deutscher König und später Kaiser trug er
Verantwortung für ein riesiges Reich. Als Oberhaupt des Hauses Habsburg
wiederum hatte er die Machtansprüche seiner Familie fest im Blick.
Zeitlebens führte Maximilian I. Krieg. Dass die Habsburger zur
Weltmacht aufstiegen, war jedoch vor allem seiner klugen Heirats- und
Erbvertragspolitik zu verdanken. 1490 wurde Maximilian I. Landesherr
von Tirol und erkor Innsbruck zu seiner Residenz. Unter den vielen
Ländern, die er regierte, kam der Grafschaft besondere Bedeutung zu und
das nicht nur, weil sich der begeisterte Jäger und Bergsteiger gern
hier aufhielt: Tirol lag strategisch günstig im Zentrum seines Reiches.
Über die Alpen eröffnete es zudem den Weg nach Süden. Mit den Gewinnen
aus dem Tiroler Bergbau finanzierte Maximilian I. seine Kriege um die
Vormachtstellung in Europa. Auch Waffen und Ausrüstung seiner Armee
stammten zum Großteil aus hiesigen Werkstätten. Die ursprünglich
bayerischen Gerichte Rattenberg und Kitzbühel wurden unter Maximilians
Herrschaft ebenso ein Teil von Tirol wie Kufstein. Die hoch über der
Stadt thronende Burg ließ er zur Grenzfestung ausbauen.
Das Herrschaftsgebiet der Habsburger wuchs stetig und erstreckte sich
bald über den gesamten Kontinent: Die von seinem Vater eingefädelte Ehe
zwischen Maximilian und Maria, der Erbin des Herzogtums Burgund, im
Jahr 1477 bescherte den Habsburgern Territorien im Nordwesten Europas.
Mit der Verheiratung seiner Kinder nach Spanien und seiner Enkel nach
Ungarn und Böhmen begründete Maximilian schließlich das habsburgische
Weltreich, in dem die Sonne nie unterging«.

Revolution im geteilten Polen
1815, nach vielen Jahren von Revolution und Krieg, war Napoleon
vernichtend geschlagen. Europa ordnete sich auf dem Wiener Kongress
1814/15 neu. Zensur und Spitzelwesen sollten eine Rückkehr
revolutionärer und nationalistischer Umtriebe verhindern, was aber ohne
nachhaltigen Erfolg blieb: Schon 1830 kam es erneut zu Revolutionen.
Polen-Litauen war bereits zwischen 1772 bis 1795 von der Landkarte
verschwunden, nachdem Russland, Preußen und Österreich das Gebiet unter
sich aufgeteilt hatten. Unter Napoleon hatte es für kurze Zeit wieder
ein polnisches Königreich gegeben, doch war auch dieses der Neuordnung
von 1815 zum Opfer gefallen. 1830/31 kam es im russischen Teil Polens
zum „Novemberaufstand". Nach dessen Niederschlagung flohen viele
Aufständische über die Grenze nach Galizien, in den österreichisch
regierten Teil Polens. Als sie zwischen 1833 und 1846 von dort aus
versuchten, neue Aufstände im russischen Teil zu organisieren,
verfolgte sie Österreich aus Solidarität mit dem Zarenreich. Einige der
polnischen Aufständischen waren in der Folge in der Festung Kufstein
inhaftiert.
Der lange Arm Russlands
Ab 1795 war Polen zwischen Russland, Preußen und Österreich aufgeteilt.
Im russischen Teil kam es 1830/31 zum Novemberaufstand, den die Russen
niederschlugen. Viele Aufständische gingen ins Exil nach Frankreich,
Deutschland und Österreich, einige versuchten von dort aus, neue
Aufstände zu organisieren. 1833 rief etwa Oberst Józef Zaliwski in
Galizien, dem österreichischen Teil Polens, andere polnische Offiziere
zum Partisanenkrieg gegen Russland auf. Doch die habsburgischen
Behörden arbeiteten in Galizien eng mit Russland zusammen. Zwischen
1833 und 1846 verhafteten sie Tausende, verurteilten sie zu fünf bis
zwanzig Jahren Kerker und verteilten sie auf verschiedene Gefängnisse.
Die Gruppe um Zaliwski kam so nach Kufstein. Aus den Erinnerungen des
ebenfalls in Kufstein inhaftierten Adolf Roliński wird deutlich, dass
die österreichischen Behörden einige Anstrengungen unternahmen, um
Informationen über Aufständische in Galizien zu erhalten. Sie spielten
Gefangene gegeneinander aus, setzten sie unter Druck und verleiteten
sie mit falschen Versprechungen zu Denunziationen und Falschaussagen.
„6-jähriger Festungsarrest in Eisen" für ein Gedicht
Höchst angespannt war die politische Situation in der
Habsburgermonarchie 1848/49, als der ungarische Benediktinerpater und
Schriftsteller Gergely Czúczór das Gedicht „Riadó" (auf Deutsch: Alarm)
veröffentlichte. Die Ungarn rebellierten gegen die österreichische
Herrschaft, diese reagierte mit besonderer Härte und wertete das
Gedicht als Aufruf zum bewaffneten Aufstand. Czúczór wurde zu
„6-jährigem Festungsarrest in Eisen" verurteilt.
In Kufstein kam der Dichter in Einzelhaft, die er zur Arbeit an
Übersetzungen und einem Wörterbuch nutzte. Freunde konnten ihm -
zensierte - Bücher und Schreibzeug zukommen lassen. Den Druck der Haft
konnte dies aber nur zum Teil mildern.
„Was das Dichten anbelangt", schrieb Czúczór, „habe ich nicht das Gemüt
des Vogels, der im Käfig ebenso singt und schlägt, wie unter dem freien
schattigen Himmel. (...) Ein einziges Gedicht hatte ich ja mit
befangenem Gemüt, aus unruhiger Seele geschrieben und ... das hab' ich
gebüsst."

1848/49 - Revolutionen im „Vielvölkerstaat"
1848 erfasste wieder eine Revolutionswelle von Frankreich aus fast ganz
Europa: Überall forderten die Bürger soziale, wirtschaftliche und
politische Reformen. Im „Vielvölkerstaat" Österreich brannte es an
allen Ecken und Enden: In der Hauptstadt Wien stritt man um eine
liberale Verfassung und parlamentarische Einrichtungen. Die
deutschsprachigen Österreicher wollten einen deutschen Nationalstaat.
Ungarn machte sich selbstständig und setzte die Habsburger ab. Die
Tschechen kämpften für die Gleichberechtigung der Slawen in der
Monarchie. Volksaufstände in Mailand und Venedig eröffneten den Ersten
Italienischen Unabhängigkeitskrieg. Am Ende standen einmal mehr die
Niederschlagung der Aufstände und in der Folge ein deutlicher Zuwachs
an Gefangenen auf der Festung Kufstein.

Beim Anblick der imposanten Festung, der sich während der Überquerung
der Innbrücke bietet, lässt sich leicht übersehen, welch
geschichtsträchtigen Weg man gerade beschreitet. Für die Menschen im
Mittelalter war diese Brücke von enormer Bedeutung; immerhin bildete
sie zwischen den je über 30 km entfernten Orten Rattenberg und
Rosenheim den einzigen festen Verbindungsweg über den Inn. Die erste
urkundliche Erwähnung einer hölzernen überdachten Brücke an dieser
Stelle geht auf das Jahr 1339 zurück. Aufgrund von Hochwasserschäden
und anderen Widrigkeiten musste die Holzbrücke im Laufe der
Jahrhunderte von den Kufsteiner Bürger:innen mehrmals ausgebessert und
erneuert werden. Im ausgehenden 19. Jahrhundert wurde statt der
hölzernen Brücke eine Stahlbogenbrücke errichtet, die jedoch „wegen
ihrer allzu schmalen Fahrbahn und wegen ihrer hässlichen, Stadtbild und
Landschaft verschadelnden Form" wenig Zuspruch in der Bevölkerung fand,
wie eine Lokalzeitung berichtete. 1969 wurde sie von der immer noch
bestehenden Brücke ersetzt. Heutzutage ist die Überquerung des Inns
gleich an mehreren Stellen gewährleistet.

Maximilian I. - „letzter Ritter" und Herrscher an einer Zeitenwende
Maximilian I. lebte in einer Zeit großer Umbrüche: Bahnbrechende
Neuerungen brachten jahrhundertealte Überzeugungen ins Wanken.
Mittelalterliche Denkweisen waren im Begriff, von einem neuen Blick auf
die Welt abgelöst zu werden. Diese Phase des Übergangs verkörperte
Maximilian wie kaum ein anderer: Als „letzter Ritter", wie man ihn oft
bezeichnet, hielt er die Tugenden des mittelalterlichen Rittertums
hoch. Zugleich war er reformfreudig und konsequent dem Fortschritt
verschrieben.
Ebenso umfassend gebildet wie praktisch veranlagt, verstand sich
Maximilian I. als Visionär. Er dachte und handelte stets in großen
Dimensionen. Das brachte ihn freilich in Geldnot. Durch die Ausgaben
für seine Kriege und politischen Schachzüge geriet selbst seine
Schatzkammer Tirol in Bedrängnis. Maximilian war aber auch ein Meister
der Selbstinszenierung. Durch autobiografische Werke, Porträts und
kostspielige Bauwerke schuf er ein Idealbild von sich, das er mithilfe
der „modernen Medien" seiner Zeit - allen voran des Buchdrucks -
verbreiten ließ.

Maximilian I.
Die Lebenszeit Maximilians L. fällt in die Übergangsphase zwischen
Mittelalter und Neuzeit. Diese ist von bedeutsamen Erfindungen,
Entdeckungen und historischen Ereignissen geprägt, die das Leben der
Menschen stark veränderten.
Um 1450 - Johannes Gutenberg erfindet den modernen Buchdruck.
Maximilian wird am 22. März 1459 in Wiener Neustadt geboren.
Durch seine Heirat 1477 wird Maximilian Herzog von Burgund
Maximilian wird 1486 zum römisch-deutschen König gewählt
Maximilian ist 1490 nun Landesherr in Tirol und den Vorlanden.
Christoph Kolumbus entdeckt 1492 Amerika.
Maximilian wird 1493 Herr der Habsburgischen Erblande.
Unter Maximilian I, werden die 1504 vormals bayerischen Gerichte Kufstein, Kitzbühel und Rattenk Rattenberg zu einem Teil Tirols.
Maximilian wird 1508 römisch-deutscher Kaiser.
Um 1510 - Nikolaus Kopernikus erkennt als Erster: Die Erde dreht sich um die Sonne.
Martin Luthers 95 Thesen erschüttern 1517 die Einheit der Kirche, Die Reformation beginnt.
Kaiser Maximilian I. stirbt am 12. Jänner 1519 in Wels.

Als Inquisition (lateinisch inquisitio: gerichtliche Untersuchung) bezeichnet man seit dem Mittelalter kirchliche
Institutionen zur Verfolgung, Anklage und Verurteilung von so genannten
Ketzern oder Häretikern. Die Inquisition wurde meist mit staatlicher
Hilfe betrieben. Die Strafen und Urteile für diejenigen, die ihre
Schuld bekannten (diese wurde nicht selten unter Folter erpresst) oder
die man der Ketzerei überführte, wurden am Ende aller Prozesse in einer
öffentlichen Zeremonie verkündet. Diese wurde Sermo generalis oder
Autodafé genannt. Die Strafe konnte in einer Wallfahrt bestehen, in
einer öffentlichen Auspeitschung, einem Bußgeld oder darin, dass der
Verurteilte ein Kreuz durch die Straßen seines Orts tragen musste. Wer
falsche Anklage erhob, musste ein Gewand tragen, auf
das zwei rote Stoffzungen aufgenäht waren. In schwereren Fällen konnten
die Angeklagten auch mit der Konfiszierung ihres Eigentums oder mit
Gefängnis bestraft werden. Da die Inquisitoren selbst keine Todesstrafe
verhängen konnten, überstellten sie in besonders schweren Fällen den
Schuldigen den weltlichen Behörden, die dann das Todesurteil
aussprachen und vollstreckten.
* * *
STORCH - Metall, 16. Jahrhundert (Replik)
Als Storch wird ein Gerät zur Fesselung bezeichnet. Die Fessel
umschließt. Kopf, Arme und Beine und verursacht nach kurzer Zeit
schwere Krämpfe.

SCHÄDELPRESSE, KOPFSCHRAUBEN - Metall, 16. Jahrhundert (Replik)
Der Kopf des Delingquenten wurde in einem Schraubstock fixiert. Die
Schraube wurde anschließend meißt so lange gedreht, bis die
Schädelknochen brachen. Andere Kopfschrauben waren wie ein Stirnband
mit Metallspitzen gefertigt. Die Kopfschrauben wurden um den Kopf
gelegt und so lange festgeschraubt, bis sich die Zacken in den Schädel
bohrten.

SPANISCHES PFERD Holz, 15. Jahrhundert (Replik)
Die Fantasie der Folterknechte war grenzenlos. Zu den grausamsten und
auch wirkungsvollsten Methoden der „Wahrheitsfindung" zählte das
Spanische Pferd, das aus zwei im Winkel von 30 - 45 °
zusammengezimmerten Brettern bestand. Der Angeklagte musste sich -
meist nackt - auf den Grat setzen. Langes Sitzen verursachte
unerträgliche Schmerzen, die oft noch durch an die Füße gehängte
Gewichte verschärft wurden. Diese Folter konnte mehrere Tage dauern,
sodass der Gefolterte oft schon nach kurzer Zeit aufgrund der
Unerträglichkeit der Schmerzen um den Tod bat.

Die Geschichte der Folter ist so alt wie die Menschheit selbst. Von
jeher war der Mensch bestrebt, Macht über andere Menschen auszuüben und
diese Macht mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln auszuüben und
durchzusetzen. Obwohl die Zeiten sich verändert haben, sind Folterungen
heute noch aktuell und in vielen Ländern der Erde durchaus gängige
Instrumente, um Macht zu demonstrieren und den Willen Andersdenkender
zu brechen.
Der historische Hintergrund von Folterungen war häufig politischer oder
religiöser Natur. Heute geht es dabei meistens darum, Informationen
über Gleichgesinnte (Mittäter, Sympathisanten), Verbindungsstrukturen
etc. in Erfahrung zu bringen, seltener um die Erpressung eines
(objektiv ohnehin wertlosen) Geständnisses. Der Tod des Gefolterten (an
den körperlichen Verletzungen, Entkräftung oder durch Selbstmord) wird
häufig in Kauf genommen oder ist sogar Bestandteil des Verfahrens. Die
Opfer verschwinden oft spurlos (so z. B. Zehntausende von Menschen zur
Zeit der Militärdiktatur in Argentinien).
* * *
AUFZIEHEN - Holz, Metall, Seil 15. Jahrhundert (Replik)
An Armen und Beinen gefesselt, wurden die Delinquenten so mittels
Flaschenzug nach oben gezogen. Durch den Druck, der so auf den Körper
ausgeübt wurde, dass die Schultern dabei, ohne sichtbare Anzeichen der
Folterung, ausgerenkt wurden. Die Folter wurde so oft wiederholt, bis
der so Maltretierte seine Schuld gestand.

ZANGEN - Holz, Metall, 14./15. Jahrhundert (Replik)
Vielfältige Formen von Zangen wurden im Bereich der Folter verwendet,
um den Verurteilten Schmerzen zuzufügen. Mittels der Zangen wurde der
Körper so bearbeitet, um aus dem so Misshandelten entsprechende
Geständnisse zu erzwingen.

Die Folterungen dienten dazu, aus ihnen Geständnisse entweder gegen
sich selbst oder gegen andere herauszupressen. Werkzeuge hierbei waren
Daumenschrauben und spanische Stiefel, mit denen Finger und Waden
gequetscht werden konnten, der mit spitzen Nägeln bestückte Folterstuhl
sowie Winde und Rad. Der perversen Phantasie der Folterknechte
entsprangen darüber hinaus sexuelle Misshandlungen aller Art. Während
des Mittelalters trug der Einfluss der römisch-katholischen Kirche dazu
bei, dass Folterungen auch zum Instrument staatlicher Gerichte wurden.
Die italienischen Stadtverwaltungen übernahmen die Folter früh, andere
europäische Länder zogen nach, als Frankreich im 13. Jahrhundert ihren
Gebrauch legalisierte. Schließlich gehörte die Folter zum Rechtssystem
jedes europäischen Landes mit Ausnahme von Schweden.
* * *
BRENNEN - Holz, Metall, 15. Jahrhundert (Replik)
Das Brennen war eine der grausamsten Arten, Geständnisse zu erpressen.
Dabei wurde der Angeklagte entweder auf einen Rost fixiert und darunter
ein Feuer entzündet, oder wie hier dargestellt, auf ein bettartiges
Gestell gebunden und nur die Füße über einer Feuerstelle gelagert.
Nicht selten dauerte die Folter so lange, bis die Fußknochen zum
Vorschein kamen.

SCHANDFLÖTE - Holz, Metall, 15. Jahrhundert (Replik)
Der Name des Foltergerätes leitet sich von seinem Aussehen her, das
Ähnlichkeit mit einer Flöte hat. Der Strafgefangene wird dabei so in
das Gerät eingespannt, dass seine Finger durch auf dem „Flötenkorpus“
befindliche Zwingen eingespannt werden. Der dadurch verursachte Schmerz
führte zu Verkrümmungen des Körpers, die an einen Musiker erinnerten.
Der Spott der Umstehenden war dem Verurteilten garantiert.

Als Mittel der Gerichtsbarkeit kam der Folter vor allem seit dem
Mittelalter bis ins 17. Jahrhundert erhöhte Bedeutung zu, da zur
Verurteilung eines Verdächtigen dessen Geständnis nötig war (im
Mittelalter galt die Fofter als Instrument des Gottesurteils).
Grausamste Verfahren wurden angewandt: Brennen, Daumenschraube,
Spanische Stiefel ... uvm. Am Ende stand, nach dem schmerzhaft
erpressten Geständnis, meist der Tod. Auch hier gab es die
unterschiedlichsten Methoden: Scheiterhaufen, Enthauptung, Häutung,
Pfählung oder Kreuzigung, um nur einige zu nennen. Bis zum 13.
Jahrhundert war die Folter nicht ausdrücklich durch das Kirchenrecht
verboten. Dann jedoch begann man das Gesetz über den Hochverrat auf die
Häresie als „crimen laesae maiestatis Divinae" (Verbrechen der
Verletzung der göttlichen Hoheit) anzuwenden. Im Zuge der Inquisition
erließ Papst Innozenz IV., durch das Römische Recht beeinflusst, ein
Dekret (1252), das den Gerichtsbeamten gestattete, der Häresie
Angeklagte zu foltern.
* * *
WASSERFOLTER - Holz, Metall, 16. Jahrhundert (Replik)
Dabei wurde der Verurteilte mit dem Bauch nach oben auf ein Brett oder
ein Gestell fixiert und musste Unmengen an Flüssigkeit trinken. Bei der
kleinen Wasserfolter waren es sechs Liter, bei der großen zwölf. Die
Unterlage wurde nun so gedreht, dass der Kopf des Verurteilten nach
unten zeigte. Die Flüssigkeit drückte dabei auf Magen und Herz sowie
Lunge, dass Erstickungssymptome auftraten. Es konnte durchaus
passieren, dass die Opfer wirklich erstickten.

ZANKGEIGE - Holz, Metall, 15. Jahrhundert (Replik)
Zu den „harmlosen" Foltergeräten zählt die sogenannte Zank- oder
Schandgeige. Hände und Kopf werden dabei im einen Holzblock gespannt
und der Angeklagte so am Pranger vorgeführt. Gesellschaftliche
Demütigungen wurden damals wie heute als massive seelische Qual
empfunden.

MUNDBIRNE - Holz, Metall, 15. Jahrhundert (Replik)
Die Mundbirne war ein äußerst schmerzhaftes Folterinstrument, das dem
Angeklagten durch Dehnung schließlich die Zähne und den Kiefer brach.
Der Fantasie der Folterknechte war beim Einsatz des Instrumentes keine
Grenze gesetzt, sodass die Mund- oder Dehnbirne schließlich zu einem
der gefürchtetsten Utensilien der Folterkammer wurde.

EISERNE MASKE - Metall, 15, Jahrhundert (Replik)
Im Strafvollzug wurde die Eiserne Maske vorrangig dafür verwendet, um
Delinquenten zum Pranger zu führen und sie dort zu fixieren. Die
Eiserne Maske war daher mehr ein Instrumentarium, das der Beschneidung
der Ehre diente.

Im 15. Jahrhundert kam der Folter vor allem in Hexenprozessen große
Bedeutung zu. Die von den unter fadenscheinigen Vorwürfen denunzierten
Frauen (seltener Männern, so genannten Zauberern oder Hexern) im Rahmen
der „peinlichen Befragung" erpressten Geständnisse waren natürlich bar
jeglicher Wahrheitsfindung, da die Gefolterten unter diesen
Grausamkeiten alles gestanden hätten, um damit ein Ende der Schmerzen
herbeizuführen. Sie trugen dazu bei, dass der Hexenwahn immer weiter um
sich griff. Massenhaft fanden Hinrichtungen durch Verbrennen,
Vierteilen, Kreuzigen, Erhängen und Köpfen statt.
Die Gräuel der Inquisition führten in Europa letztlich zur Abschaffung
der Folter. Bereits im 14. und 15. Jahrhundert waren in Italien Gesetze
zu ihrer Einschränkung erlassen worden. Hinzu kam, dass durch das im
Zuge der Aufklärung geänderte Rechtssystem, das das Geständnis nicht
mehr zum zentralen Entscheidungsmoment erklärte und den Zeugen- bzw.
Indizienprozess etablierte, die Folter an Bedeutung verlor. Ein
päpstlicher Erlass von 1816 verbot den Einsatz von Folter in den
römisch-katholischen Ländern. In Österreich wurden Folter und
Todesstrafe 1787 unter Kaiser Josef II. abgeschafft.
* * *
GARROTTE - Holz, Metall, 18. Jahrhundert (Replik)
Eine Garrotte ist ein Hinrichtungsinstrument, bei dem der Verurteilte
an einen Holzpfahl gefesselt und ein Seil (später ein Metallband) um
den Hals gelegt wurde. Der Delinquent wurde durch langsames Ziehen an
beiden Enden des Seiles erdrosselt. Die Garrotte wurde in Spanien im
18. Jahrhundert eingeführt und bis zum Jahr 1974 angewandt.

KOCHEN - Kessel aus Metall, 16. Jahrhundert (Replik)
Die Vita des Mārtyrers Vitus schildert sehr anschaulich diese Form des
Folterns. Der Verurteilte wurde bei lebendigem Leib gesotten. Meist
wurde diese Foltermethode soweit angewandt, bis der Angeklagte seine
Schuld gestand, oft führte sie allerdings auch zum Tod durch
Kreislaufversagen.

JUDASWIEGE - Holz, Metall, 15. Jahrhundert (Replik)
Die Judaswiege ist ein Folterinstrument, das mit besonderer Grausamkeit
Geständnisse erpressen sollte. Das Holzegestellt, das auf drei oder
vier Beinen steht, läuft nach oben hin spitz zusammen. Mittels einer
Seilwinde wurde der Gefangene auf die Spitze niedergelassen.

KÄFIG - Holz, Metall, 16. Jahrhundert (Replik)
Als besonders grausam galt der Käfig, der verschiedene Anwendungen
fand. Zunächst diente er dem Mürbemachen des Angeklagten. Er wurde aber
auch als Mittel zur Vollstreckung der Todesstrafe eingesetzt, indem der
Delinquent eingesperrt wurde und buchstäblich verhungerte und
verdurstete.

Die Anfänge der Burg Kufstein reichen in die Mitte des 11. Jahrhunderts
zurück. Auf dem höchsten, nördlichsten Teil des Berges lag eine
Höhenburg, die vermutlich nur aus einem Wohngebäude, dem „Palas", sowie
einem Wehrturm, dem „Bergfried", bestand. Ihr Ausbau zur Festung
erfolgte in vier großen Etappen. Schon vor 1500 verstärkte man die
Anlage zum Schutz vor den neu aufkommenden Feuerwaffen mit Rondellen
(rund ummauerten Geschützstellungen) und Vorwerken. Der endgültige
Übergang von der Burg zur Festung vollzog sich nach der Übernahme durch
Maximilian I. 1504. In den folgenden Jahrzehnten erhielt die Anlage
weitgehend ihr heutiges Aussehen. Sie wurde erweitert und mit
Einführung des Bastionärsystems zu einer starken und modernen
Grenzfestung ausgebaut. Damals entstand auch der Kaiserturm, ein
Geschützturm neuesten Typs. Die großzügige Erweiterung nach Südwesten
in Richtung Josefsburg geht hingegen auf das 18. Jahrhundert zurück. Um
eine annähernd ebene Fläche zu gewinnen, wurde damals die natürliche
Felskuppe nahezu vollständig abgetragen.

Die Handhabung der frühen Kanonen war eine extrem gefährliche
Angelegenheit. Immer wieder kam es vor, dass ein Rohr explodierte. Nur
erfahrene Büchsenmeister wussten, wie das Pulver dosiert werden musste
und in welchem Winkel die Kanonen zu positionieren waren, um die
bestmögliche Wirkung zu erzielen. Zum Abfeuern einer Kanonenkugel war
Schießpulver notwendig. Dieses wurde im Artillerielaboratorium
hergestellt - aus drei Zutaten: Holzkohle, Schwefel und Salpeter. Das
Mahlen und Mischen der Zutaten war ein komplizierter Prozess und
dauerte viele Stunden.
Elisabethbatterie - Im 17.
Jahrhundert entstandene Geschützstellung. Benannt wurde sie
wahrscheinlich nach der Gattin Kaiser Karls VI. und Mutter Maria
Theresias.

Zeit ihres Bestehens war die Festung Kufstein nie Wohnsitz einer
Adelsfamilie oder Residenz eines Herrschers. Sie diente vielmehr stets
militärischen Zwecken. Auf der Festung lebte vor allem die dort
stationierte Besatzung - in Friedenszeiten kamen Handwerker und
Arbeiter hinzu, die für die Instandhaltung und den Ausbau der Festung
sorgten. Die Befehlsgewalt über die Festung hatte der
Festungskommandant oder „Schlosshauptmann", wie er ab dem 16.
Jahrhundert genannt wurde. Er nahm auch die Aufgaben eines obersten
Richters wahr. Oft stellten bekannte Adelsfamilien den
Festungskommandanten: etwa die Schurff oder die Fuchs von Fuchsberg,
die dem Fuchsturm seinen Namen gaben. Die Zahl der Festungsbesatzung
schwankte über die Jahrhunderte stark - je nach Bedarf. So wurde sie
etwa im Falle kriegerischer Auseinandersetzungen aufgestockt. Knapp 50
Mann zählte man während der Belagerung durch Maximilian I. 1504, im
Tiroler Volksaufstand von 1809 waren es hingegen über 600.

Felsengang - Vermutlich unter
Baumeister Degen Salapart im 16. Jahrhundert entstandene
beschusssichere Verbindung zum südlichen Teil der Festung. Im Zweiten
Weltkrieg diente der Felsengang als Luftschutzkeller.

Fuchsturm - Im 16. Jahrhundert
errichteter Kanonenturm. Benannt ist er nach der Familie Fuchs von
Fuchsberg, die 1506 bis 1549 zwei Festungskommandanten stellte.
Über das große Tretrad wurde Wasser in einem Kübel nach oben
transportiert und hinter dem Brunnen in eine Rinne geschüttet. Von dort
wurde es in das gemauerte Becken am Eingang geleitet und schließlich
mithilfe einer Pumpe über die ganze Festung verteilt.

Wasser auf die Festung zu transportieren, war mit großen Anstrengungen
verbunden. Leichter kam man an Regenwasser. Dieses wurde in großen
Wasserspeichern, sogenannten Zisternen, aufgefangen. Doch was, wenn die
Festung belagert wurde und es mehrere Wochen nicht regnete? Maximilian
I. entschied deshalb, dass die Festung einen eigenen Brunnen bekommen
sollte: den „Tiefen Brunnen".
Tiefer Brunnen - Unter
Baumeister Michael Zeller 1512 bis 1537 geschlagener Brunnen von
ursprünglich 65 und heute 57 Metern Tiefe. Mit zwei Eimern, die
gegenläufig auf- und abliefen, ließen sich in einer Viertelstunde rund
50 Liter Wasser heben.

„Ich breche eine Lanze für dich" - Die Wurzeln dieser Redewendung
liegen im ritterlichen Kampf. Mit ihr drücken wir aus, dass wir uns für
eine Person einsetzen. Oft genug ging die Lanze eines Ritters zu Bruch,
wenn sie auf die Rüstung oder den Schild des Gegners traf. Ein wahrer
Ritter brach seine Lanze aber nie für sich selbst. Er widmete seinen
Kampf einer Dame oder seinem Herrn. Die Lanze gehörte zu den
wichtigsten Waffen eines Ritters. Der richtige Umgang mit der langen
Stange musste aber geübt werden - und zwar auf dem Turnierplatz. Um den
Gegner vom Pferd zu stoßen, brauchte es Kraft, Geschicklichkeit und
jede Menge Mut.
Kaiser Maximilian I. – zwischen Ritter-Ideal und Landsknecht-Realität
Im ausgehenden Mittelalter hatten die Ritter ihre Vormachtstellung auf
dem Schlachtfeld bereits verloren. Die Entwicklung von Feuerwaffen ab
dem 14. Jahrhundert hatte die traditionelle Kriegsführung von Grund auf
revolutioniert: Von den Kämpfern der Zukunft wurde mehr Wendigkeit
verlangt. Maximilian I. war einer der Vorreiter auf diesem Gebiet: Er
setzte für seine Heere verstärkt auf beweglichere Fußtruppen, die
sogenannten Landsknechte. In seinem Herzen aber war Maximilian dem
Ritterideal nach wie vor eng verbunden. Bis heute kennt man ihn unter
dem Namen „Der letzte Ritter" - unter anderem wegen seiner großen
Leidenschaft für Ritterturniere. Während Turniere ursprünglich als
Training für die Schlacht dienten, entwickelten sie sich immer mehr zu
sportlichen Wettkämpfen und prachtvollen Spektakeln. Eingebettet in
mehrtägige höfische Feste dienten sie repräsentativen Zwecken.
* * *
Untere Schlosskaserne - Aus dem 18. Jahrhundert stammende Anlage, die den Soldaten als Unterkunft diente.

Die neue Welt der Landsknechte
Die Landsknechte verkörperten eine neue Art der Kriegsführung. Sie
kämpften zu Fuß mit Stangenwaffen wie Spießen und Hellebarden und
zeichneten sich auch durch die geschickte Handhabung von Kurzschwertern
(genannt „Katzbalger") oder Schusswaffen wie der Hakenbüchse aus.
Anders als die „Mann gegen Mann" kämpfenden Ritter bewegten sich die
Landsknechte Schulter an Schulter in engen Formationen. Dadurch
erreichten sie auf dem Schlachtfeld ein wirkungsvolles Zusammenspiel.
Unter den Landsknechten gab es auch keine sozialen Schranken. Als
Landsknecht konnte jeder Mann anheuern.
Die Landsknechte entwickelten sich nach dem Vorbild
der „Reisläufer" - Schweizer Söldnertruppen, die im späten Mittelalter
in ganz Europa bekannt waren. Söldnerheere hatten einen zweifelhaften
Ruf: Durch ihre fortschrittliche und disziplinierte Kampfkraft errangen
sie für ihren Feldherren bedeutende Siege. Wurden sie jedoch nicht
pünktlich bezahlt oder waren unzufrieden mit den ausgehandelten
Verträgen, verweigerten sie den Gehorsam. Sie liefen zum Feind über
oder verwüsteten und plünderten ganze Landstriche.
Die Kleidung der Landsknechte unterschied sich deutlich von jener der
Ritter. So auffällig und so originell wie möglich lautete ihr Motto.
Die Landsknechte trugen bunte Farben und grelle Muster, ihre Jacken
waren häufig geschlitzt und hatten als modisches Detail gepuffte Ärmel.
Da ihre jeweiligen Herren keine einheitliche Kleidung vorschrieben,
trug jeder das, was ihm gefiel. Wie gut sich ein Landsknecht kleidete,
hing von seinem sozialen Status und der Höhe seines Soldes ab. Die
Landsknechte entwickelten so einen eigenen Stil, der jedem Einzelnen
ein gewisses Maß an Individualität ermöglichte, diese aber auch als
Gruppe erkennbar machte. Für den Kampf ergänzten die Landsknechte ihre
Kleidung durch einzelne Harnischteile wie beispielsweise Helme und
Brustpanzer.

Über Jahrhunderte war die Festung Kufstein Zankapfel zwischen Bayern
und Tirol, zwischen den Herrscherfamilien der Wittelsbacher und der
Habsburger. Kein Wunder, denn wer Macht über die Festung hatte,
kontrollierte den Zugang zum reichen und strategisch wichtigen Passland
Tirol. Auf bayerischer Seite war man wohl auch von schmerzvollen
Verlusten getrieben: Kufstein und Tirol hatten ursprünglich zu Bayern
gehört, ehe zunächst Tirol und 1504 auch Kufstein an die Habsburger
verloren gingen. In den folgenden Jahrhunderten versuchten die Bayern
zwei Mal, die Gebiete zurückzugewinnen. Hintergrund waren in beiden
Fällen Konflikte um die Vormachtstellung in Europa, vorrangig zwischen
Frankreich und dem Haus Habsburg-Österreich. Bayern verbündete sich
jeweils mit Frankreich. Und Kufstein geriet beide Male zwischen die
Fronten. Die Folgen: Zerstörung, Hunger, Seuchen und Tod. Dazwischen
lagen allerdings Zeiten guter nachbarschaftlicher Beziehungen, in denen
man regen wirtschaftlichen, kulturel-len und religiösen Austausch pflog.
* * *
Bürgerturm - Aus einem Rondell
des 15. Jahrhunderts hervorgegangen. Im Zuge des Barockumbaus erhielt
er bis 1744 seine heutige Gestalt. Im Turm lagerten die Bürger ihre
Waffen. Seit 1931 birgt der Bürgerturm eine der größten Freiluftorgeln
der Welt.
Im Jahr 1931 wurde der Festung eine Stimme geschenkt. Die Freiorgel
wurde ursprünglich zum Gedenken an die Gefallenen des Ersten Weltkriegs
errichtet. Zu Mittag tönen ihre beinahe 5.000 Pfeifen weit hörbar über
die Dächer Kufsteins und darüber hinaus. Die täglichen Orgelkonzerte,
bei denen klassische Werke ebenso wie zeitgenössische Songs gespielt
werden, erfreuen sich großer Beliebtheit.

Die Heldenorgel Kufstein
Die Idee, auf der Festung Kufstein eine Freiorgel zum Gedenken an die
Gefallenen des Ersten Weltkrieges zu errichten, geht auf den
Volksdichter und Kaiserjägeroffizier Max Depolo zurück. 1924 stellt er
diese Idee der Öffentlichkeit vor. Die neue Orgel soll nicht zuletzt
Kufsteins Attraktivität als Tourismusziel erhöhen. Mit Unterstützung
aus dem gesamten deutschsprachigen Raum kann das ambitionierte
Bauprojekt in reduzierter Form (zweimanualig mit 26 Registern und 1.813
Pfeifen) realisiert werden. Der Auftrag geht an die Firma Walcker in
Ludwigsburg (Deutschland). Die Einweihungsfeierlichkeiten im Mai 1931
geraten zu einer Beschwörung der Einheit und Waffenbruderschaft
Österreichs und Deutschlands.
Von Anfang an ertönt die Heldenorgel täglich um die Mittagszeit, im
Sommer auch um 18 Uhr. Sie ist in der Stadt, aber auch kilometerweit
bis ins benachbarte Bayern zu hören. Nach dem Willen ihrer von
völkischem, deutschnationalem Gedankengut durchdrungenen Initiatoren
soll das Instrument ein „Heldenmal des deutschen Volkes" sein, das
ausschließlich für die „Gefallenen deutscher Zunge" erklingt und tönend
die nahe Grenze überwindet. Mit der Annexion Österreichs 1938 wird die
Heldenorgel von den nationalsozialistischen Machthabern ideologisch
vereinnahmt; das „Heldengedenken" ist ein zentrales Element der
NS-Feiergestaltung. Pläne zur Vergrößerung der Heldenorgel gibt es
schon vor 1945, aber erst 1971 kann das von der Erbauerfirma
substanziell erweiterte Instrument, das nunmehr 46 klingenden Registern
und 4.307 Orgelpfeifen umfasst, eingeweiht werden. 1981 wird die
Zweckbestimmung des Instrumentes modifiziert; sie erklang fortan für
„alle Opfer von Gewalt".
Im Jahr 2009 erfolgt eine Generalsanierung. Die Orgel wird von der Fa.
Eisenbarth auf 65 Register und 4948 Pfeifen erweitert. Seit einigen
Jahrzehnten konkurriert die Heldenorgel Kufstein mit der „Spreckels
Organ" in San Diego/USA um den Titel „größte Freiorgel der Welt";
aktuell hat das amerikanische Instrument mit 80 Registern und 5017
Pfeifen knapp die Nase vorn. Im Zuge der Sanierung der Kufsteiner
Heldenorgel 2009 werden Maßnahmen getroffen, um technische
Schwierigkeiten zu beheben. Von Anfang an ist die enorme Distanz
zwischen dem Spieltisch im Festungsneuhof und dem Pfeifenwerk im
Bürgerturm der Festung ein Problem. Die Tonerzeugung (elektrische
Traktur) erfolgt mit zeitlicher Verzögerung. Inzwischen sind Spieltisch
und Orgelwerk durch ein rund 100 m langes Glasfaserkabel verbunden.
Weiterhin sind die Pfeifen der Witterung ausgesetzt, enorme
Schwankungen von Temperatur und Luftfeuchtigkeit ergeben einen hohen
Stimmbedarf. Als Ergebnis öffentlicher und politischer Debatten erfolgt
2022 auf Beschluss des Kufsteiner Gemeinderates eine Neuwidmung des
Instrumentes; seit 2023 erklingt nicht mehr das soldatische „Lied vom
guten Kameraden" als Abschluss des täglichen Heldenorgelspiels, sondern
ein anderes, jährlich wechselndes Lied.

GESCHICHTE DER TIROLER KAISERJÄGER
Aus den 1511 normierten "Tiroler Landmilizen" war 1730 als erste
stehende Truppe das "Tiroler Landbataillon" und daraus 1745 das
"Tiroler Feld- und Landregiment" hervorgegangen, welches bei Aufnahme
des Ende 18. Jhs. errichteten "Tiroler Scharfschützenkorps" 1801 als
"Tiroler Jäger-Regiment Nr. 64", ab 1813 als "Tiroler
(Fenner-)Jägerkorps" geführt wurde. 1815 erließ Kaiser Franz I. die
Anordnung, in Tirol und Vorarlberg ein Jäger-Regiment zu 4 Bataillonen
á 6 Kompagnien zu errichten, dem als Stamm das Fennersche Jägerkorps
dienen sollte und in dem nur Tiroler und Voralberger ihren Dienst
erfüllen sollten. Es sollte den Namen "TIROLER KAISERJÄGER" führen und
stellte sich selbst als Oberst-Inhaber an die Spitze dieser neuen
Truppe. Es war dies der Dank für zahlreiche Beweise der Liebe und Treue
zu Kaiser und Reich, durch die sich das Land Tirol in der ganzen Welt
bekannt und berühmt gemacht hatte.
Am 16. Jänner 1816 begann die Aufstellung der Regimenter, die, bester
Tiroler Verteidigungstradtitionen entsprechend, ihre Pflicht für das
Vaterland in besonderem Maße erfüllt haben. Dieser Tag wird als
Geburtstag der "Tiroler Kaiserjäger" gefeiert. Als Tiroler
Kaiserjägerregiment wurde es im hechtgrauen Jägerrock und dem stolzen
Jägerhut mit wehendem Federbusch zum weithin bekannten Symbol Tiroler
Treue und österreichischem Heldentum. Die Jahre 1848, 1849, 1859, 1866,
1878 und 1882 sind mit den Kaiserjägern innig verbunden, wie die Namen
Mailand, Goito, Castell Toblino, Pastrengo, Curtatone-Montanara,
Vicenza, Sommacampagna, Olengo, Raab, Komorn, Magenta, Solferino,
Spundalunga, Custoza, Monte Suello, Vezza, Lodrone, Cimègo, Fort
Ampola, Bezzecca, Kremenac, Cernice, Stolac, Klobus und Krivosije. Sie
künden immerwährend, wann und wo Tiroler Kaiserjäger gekämpft und
gesiegt haben. Im Jahre 1895 wurden aus dem großen Regiment, das bis
dahin aus 16 Bataillonen bestand, vier Regimenter gebildet und diese
zogen unter der Fahne des allerhöchsten Kriegsherrn in den Weltkrieg
1914-1918 und kämpften bei wechselvollem Schicksal bis zum
schrecklichen Ende. Mit Ende des I. Weltkrieges (Nov. 1918) wurden die
Tiroler Kaiserjäger-Regimenter aufgelöst.

Hoch über dem Inn und der Stadt thront eines der beeindruckendsten
mittelalterlichen Bauwerke Tirols: die Festung Kufstein. Heute ein
weithin sichtbares Wahrzeichen der Stadt, nahm die Festung über
Jahrhunderte eine Schlüsselrolle ein: Von hier aus ließ sich der Zugang
zum Inntal und damit nach Tirol kontrollieren, das mit seinen reichen
Bodenschätzen ebenso lockte wie mit den niedrigsten Alpenübergän-gen in
Richtung Italien. Kein Wunder also, dass Kufstein oft als „Tor zu den
Alpen" und als „Schlüssel Tirols" bezeichnet wurde.
Untrennbar verbunden ist die Festung mit dem Namen Maximilians I., der
die ursprünglich bayerische Burg 1504 eroberte. Von da an wachte sie
über die Grenzen Tirols. Diese Schutzfunktion hat die Burg von Beginn
an erfüllt: Sie war nie als Residenz eines Fürsten geplant, sondern
diente als Bollwerk, als Garnison und später als berüchtigtes
Staatsgefängnis. Erst im 19. Jahrhundert verlor die Festung ihre
militärische Bedeutung. Heute steht sie als Erlebniswelt, Festsaal,
Konzertarena und Museum für Besucher offen.

DREIFALTIGKEITSKIRCHE
1502 als Weinränntt-Gründung erstmals erwähnt
nach 1681 Hausoratorium der Augustiner-Eremiten
1703 Zerstörung durch Stadtbrand
1705-1730 Erneuerung als einschiffiger Bau mit Netzgradgewölbe über Stichkappen und mit 3/8 Chorschluß
1765 Rokoko-Baldachinaltar Gruftkapelle mit neugotischem Altar um 1860
1988/89 vollständige Erneuerung der Kirche und Grabdenkmäler
Blick über Kufstein aus der Festung Richtung Norden (Bayern)

Gedeckter Aufgang - Im 16.
Jahrhundert unter Baumeister Balthasar Lavianello als »Ganngsteig«
anstelle eines früheren steilen Felsenpfads errichtet.
Barrikadennischen und eine Zugbrücke am Ende erschwerten den Zugang.
Wann genau der gedeckte Stiegenaufgang entstand, ist nicht überliefert. Erwähnung fand er erstmals 1836.

Panoramabahn „Kaiser Maximilian"
Die heutige Panoramabahn ist nicht die erste Verbindung zwischen
Festungsneuhof und dem Schlossrondell. Ein historischer Vorgänger, in
Form eines mechanischen Aufzugs, existierte vermutlich schon im 17.
Jahrhundert, anderen Quellen zufolge seit dem 18. Jahrhundert. Dieser
ursprüngliche Aufzug, der den Namen „Bayerisch Maschin" getragen haben
soll, wurde u. a. verwendet, um Proviant, Geschütze und Munition auf
die Festung zu befördern. Zeitgleich waren zwei Transportwägen im
Einsatz. Während einer von ihnen den Berg hinaufgezogen wurde, fuhr ein
anderer hinab in den Festungsneuhof. Angetrieben wurde der Aufzug durch
reine Muskelkraft: Mehrere Männer mussten gut einen Kilometer in einem
großen Laufrad zurücklegen, bis die hunderte Kilogramm schwere Ladung
den Festungsberg erreichte. 1965 wurde dieser Aufzug abgerissen.
Geblieben sind die alten Mauern, auf denen auch die Schienen des
heutigen Schrägaufzugs aufliegen, sowie das Laufrad. Dieses befindet
sich noch immer in der Bergstation.
Aufzugtyp Schrägaufzug
Erbaut 1999
Schienenlänge 73 m
Steigung über 46°
Fahrtdauer von Tal- zu Bergstation, ca. 1,5 Min.

Einst befand sich etwa an dieser Stelle das Obere Stadttor. Zusammen
mit dem Unteren Stadttor, der Stadtmauer samt Basteien und dem
Stadtgraben bildete es eine umfassende Verteidigungsanlage. Im Laufe
der Geschichte gestaltete sich die einst starre Grenze zwischen
Stadtkern und Vorstadt immer durchlässiger. In der zweiten Hälfte des
19. Jahrhunderts wurde das Tor abgetragen, 1865 schließlich der Graben
zugeschüttet. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts entstand hier das
prunkvolle Sparkassengebäude, das mannigfache sehenswerte Details
bietet; beispielsweise die Reliefs des in Kufstein geborenen Bildhauers
Norbert Pfretzschner.
Heute ist es kaum vorstellbar, dass man einst nicht einfach ungehindert
von hier bis zur Innbrücke flanieren konnte, ohne gleich zwei Stadttore
passieren zu müssen. Wo früher ein tiefer Graben klaffte, lässt sich
nun die großzügige Weite des Oberen Stadtplatzes genießen. Der
erfrischende Stilmix der angrenzenden Gebäude vermittelt in Kombination
mit der spürbaren Offenheit des Platzes ein ureigentümliches Kufsteiner
Lebensgefühl; das Bewusstsein für die Schätze aus vergangenen Tagen
trifft unvermittelt auf den Mut, neue Wege zu beschreiten.

Sparkasse Kufstein Tiroler - Sparkasse von 1877, Oberer Stadtplatz
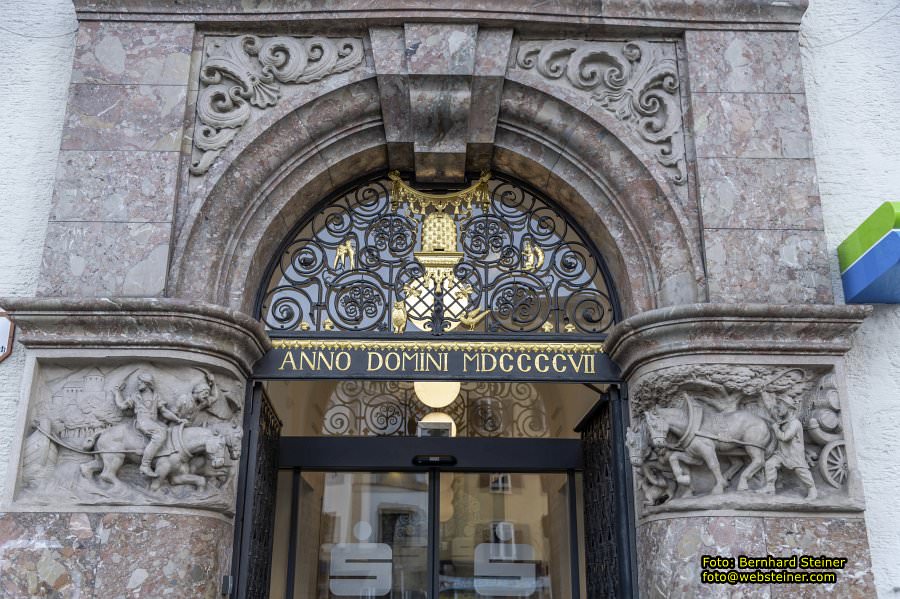
Junge Davidstein am Franz-Josef-Platz

Sparkasse Kufstein Tiroler - Sparkasse von 1877, Oberer Stadtplatz

Unterer Stadtplatz: Rathaus Kufstein, Stadtpfarrkirche St. Vitus, Festung Kufstein

Volksschule Kufstein Stadt
Die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert ging mit einem fulminanten
kunstgeschichtlichen Umbruch einher; in der Epoche des Jugendstils
strebten junge Kunstschaffende in großen Teilen Europas eine radikale
Symbiose von Kunst und Alltag an. Florale Ornamente wurden um Fenster
und Türen gewunden, wilde Kreaturen von fließenden Formen in Schach
gehalten, vollendetes Handwerk verschmolz in allen Lebensbereichen mit
betörender Ästhetik. Auch in Kufstein finden sich eindrucksvolle
Zeugnisse dieser Ära. Kurz nach 1900 entstand östlich des
Festungsberges ein apartes Viertel mit herausragenden Jugendstilbauten.
Hervorzuheben sind neben der Volksschule Kufstein auch das ehemalige
Hotel Egger am Oberen Stadtplatz, die Oberstvilla und das schlossartige
Gymnasium. Letzteres begeistert vor allem durch seine großartigen
Details, wie dem mit Gold-Eulen geschmückten und von symbolischen
Reliefs umrahmten Hauptportal oder den Relief-Rosen unter dem Gesims.
Aber auch zahlreiche Privatvillen am östlich gelegenen Kienbichl sind
wahre Jugendstil-Juwele und laden zu einer kunstgeschichtlichen
Entdeckungsreise ein.

Freier Eintritt ins Nähmaschinenmuseum Madersperger in der Kinkstraße 16, 6330 Kufstein
Die Nähmaschine - Ihr Ursprung Ihre Entwicklung
1790 - Thomas Saint
1790 erhielt der Engländer Thomas Saint Patent auf ein seine
Kettenstich-Maschine mit Hakennadel (Schlingen llegen auf der
Stoffoberseite), aber die Konstruktion ließ sich praktisch nicht
verwerten.
1810 - Balthasar Krems
Um das Jahr 1800 konstruierte der Deutsche Balthasar Krems aus Mayen in
der Eifel elne Kettenstich-Nahmaschine. Das Nadelöhr befand sich in der
Spitze. Das Bemerkenswerte an dieser Maschine ist der
Stachelradtransport für das Nahgut, welcher durch Anwendung eines
Pausengetriebes fortlaufend schrittweise arbeitet.
1814 - Joseph Madersperger
Von 1807 bis 1839 arbeitete der Kufsteiner Joseph Madersperger an der
Herstellung und Verbesserung seiner Nähmaschine. Seine hervorzuhebende
Erfindung war eine schiffchenähnliche Einrichtung zur Erzeugung des
Doppelstiches. Leider gelang es ihm nicht, die Öffentlichkeit damals zu
überzeugen.
1830 - Barthélémy Thimonnier
Zu dem Titel "Erster Nähmaschinenfabrikant der Welt" kam der Franzose
Barthélémy Thimonnier im Jahre 1829, als er eine
Kettenstich-Nähmaschine entwickelt hatte und an die französische
Heeresverwaltung 80 seiner Exemplare verkaufte. Die Pariser Schneider
fürchteten um den Verlust ihrer Arbeitsplätze und zerstörten seine
Fabrik. Er konnte nur eine einzige Maschine retten. Diese führte er als
Volksbelustigung auf Jahrmärkten gegen Entgelt vor.
1845 - Elias Howe
1846 baule der Amerikaner Ellas Howe elne nach dem gleichen Prinzip arbeitende Nähmaschine und ließ
diese auch patentieren. Diese Maschine leistete eine Näharbeit von 4-6
Handnäherinnen. Gerechterweisen muss man Ellas Howe als den Erfinder
dor Doppelstich Nahmaschine bezeichnen. Man geht auch bis zur heutigen
Zeit davon aus, dass Howe die eigentliche Entwicklung der Nähmaschine
zu verdanken ist.
1850 - Isaac Merrit Singer
Es ist der Verdienst der von Isaac Merrit Singer 1862 gegründeten
gleichnamigen Firma, daß die erste Nähmaschine nach Howes Idee
fabrikmäßig hergestellt wurde. Der tüchtige Firmeninhaber machte somit
die Nähmaschine populär und sorgte auch für dementsprechenden Ahsatz.
Allertlings wurde die Firma Singer unter anderem verurtelit, an Howe
für 300.000 bereits hergestellter Maschinen eine Lizenzgebühr von $5,
pro Stück zu bezahlen.

Joseph Madersperger, 1768-1850
Joseph Madersperger entstammte einer alten Tiroler Schneider-Dynastie.
21.7.1746 kaufte sein Vater, "...der ehrsame Georgen Mattersperger zu
Wündisch-Matrey, Land Salzburg gebürtig, seiner Profession ein
Schneidergesell..." von den Kindern des verstorbenen Schneidermeisters
Jakob Egger eine Behausung, Gartl und
Schneidermeisterschaftsgerechtigkeit in Kufstein
6.10.1768 wurde Joseph Madersperger um 10 Uhr vormittags in Kufstein, Schmiedgasse (heute Kinkstraße) geboren
1789 Brand des Hauses
17.8.1790 Verkauf der Schneidermeisterschaftsgerechtsame und Übersiedlung nach Wien, Weihburggasse 16
16.8.1799 legte Madersperger in Wien den Bürgereid ab
1808 Madersperger versucht die Bewegungen der menschlichen Hand als mechanische "Nähhand" nachzubauen
20.2.1815 Verleihung eines ausschließlichen Privilegs für eine Nähmaschine auf 6 Jahre
27.6.1818 Einforderung der Taxen auf das Privileg durch die Hofkanzlei
und Pfändungsversuch. Madersperger's Aufenthalt war aber - ".....ganz
unbekannt....."
1817 Gesuch an die Kommerzhofkammer zur Verfertigung einer von ihm
erfundenen Maschine zum Zusammennähen von Strohhüten - "Abgelehnt!"
1817-26 Fabrikant feiner Strohhüte auf der Laimgrube 99
1833 Ansuchen um ein Privilegium auf eine Maschine zur Bereitung der Schafwolle - "Abgelehnt!"
1835 Anläßlich der in Wien abgehaltenen "Gewerbsproduktenausstellung "
übergab Joseph Madersperger, in Wien, Laimgrube, and der Wien Nr. 37,
zur Ausstellung 6 Stück des von ihm erfundenen sogenannten
Doppelstoffes, welchen er aus bereits fertigen Geweben und Baum- oder
Schafwolle, Flanell u. dgl. auf einer ebenfalls von ihm erfundenen
Maschine durch eigenthümliches Verbinden erzeugt, und welcher zu warmen
Bekleidungen, Decken u. dgl. sehr empfehlenswert ist..."
5.11.1838 Übergibt er seine fünfte Maschine dem Polytechnikum (Technische Universität Wien) als Geschenk
3.5.1842 Zuerkennung der bronzenen Verdienstmedaille des 'Niederösterreichischen Gewerbevereins'
2.10.1850 stirbt Joseph Madersperger im bürgerlichen Versorgungshaus
St. Marx zu Wien. Er liegt auf dem Biedermeierfriedhof St. Marx
begraben.

Lange schon haben sich die Menschen die mitreißende Kraft des Gewässers
zunutze gemacht. Da die Straßen zu Lande einst denkbar schlecht waren,
wurden schwere Waren durch das Inntal hauptsächlich auf dem Wasserweg
transportiert. Flussaufwärts mussten die Schiffszüge mühevoll
„getreidelt“, also von mehreren Pferden gezogen werden. Importiert
wurden hauptsächlich Lebensmittel, exportiert zunächst vor allem Salz,
Metalle und Wein, später auch Zement. Durch den Bau der Eisenbahn
verlagerte sich der Warenverkehr im 19. Jahrhundert zunehmend auf die
Schiene.
Seit jeher wurden auf dem Inn nicht nur Waren, sondern auch Personen
befördert. Truppen konnten so rasch transportiert werden, aber auch
Kaiser Maximilian reiste auf dem Wasserweg. Zwischen 1998 und 2011
beförderte die „St. Nikolaus" Menschen aus Nah und Fern zwischen
Kufstein und Niederndorf. Aufgrund rückläufiger Fahrgastzahlen wurde
die Innschifffahrt jedoch eingestellt. Seither kommt die „St. Nikolaus"
in Hamburg für Hafenrundfahrten zum Einsatz. Ob sie den Inn und den
Pendling wohl manchmal vermisst?

28.000 Jahre alte Relikte - Vor
etwa 28.000 Jahren hinterlassen Cro-Magnon-Menschen in der Tischofer
Höhle im Kaisertal acht Speerspitzen. Diese Relikte sind die ersten
Spuren menschlicher Besiedlung im Raum Kufstein - und die ältesten von
Menschenhand bearbeiteten Funde Tirols.
Besiedlung des Festungsbergs vor 3.800 Jahren -
In der Bronzezeit vor rund 3.800 Jahren wird der Festungsberg
besiedelt. Dieser liegt schon damals an einem wichtigen Verkehrsweg,
welcher es den Bewohner:innen ermöglicht, florierenden Handel zu
treiben.
Bajuwarische Besiedlung im 6. Jahrhundert - Nach über 500-jähriger römischer Herrschaft besiedeln im 6. Jahrhundert Bajuwaren das Gebiet.
Erste urkundliche Erwähnung 788 -
In einem Güterverzeichnis des Bistums Salzburg aus der Zeit um 788 wird
„Caofstein" erstmals als Örtlichkeit mit eigener Kirche ausgewiesen.
Verleihung des Stadtrechts 1393 -
1393 verleiht Herzog Stefan III. von Oberbayern Kufstein das Stadtrecht
und damit auch wirtschaftliche Sonderrechte. Das Niederlagsrecht
beispielsweise verpflichtet durchziehende Händler:innen dazu, ihre
Waren in der Stadt feilzubieten.
Morgengabe 1342 - Am Morgen
nach ihrer Vermählung mit Ludwig dem Brandenburger im Jahr 1342 erhält
Herzogin Margarete von Tirol-Görz den Ort Kufstein als Geschenk.
Kufstein gehört somit erstmals zu Tirol, wird aber wenig später von den
Bayern zurückgefordert.
Eroberung durch Kaiser Maximilian 1504 - Im Jahr 1504 nimmt Kaiser Maximilian I. Stadt und Festung ein. Kufstein gelangt somit wieder zu Tirol.
"Boarischer Rummel" 1703 - Bei
den verharmlosend als „Boarischer Rummel“ bezeichneten Kriegshandlungen
im Jahr 1703 wird die Stadt von bayerischen Truppen belagert und in
Brand gesteckt. Nach der verheerenden Explosion des Pulverturms auf der
Festung fällt diese in die Hände der Bayern. Bereits im darauffolgenden
Jahr wird die Stadt im Ilbesheimer Vertrag den Habsburgern zuerkannt.
Unter Napoleons Einfluss 1805 - Während des 3. Koalitionskrieges gegen Napoleon gerät die Ortschaft 1805 abermals unter bayerische Herrschaft.
Tiroler Volksaufstand 1809 -
Beim Tiroler Volksaufstand im Jahre 1809 wird Kufstein von Tiroler
Schützen belagert, aber nicht eingenommen. Erst fünf Jahre später kommt
die Stadt infolge der Niederwersfung Napoleons schließlich endgültig zu
Österreich.
Einzug der Industrie im 19. Jahrhundert -
Ab Mitte des 19. Jahrhunderts halten in Kufstein Industrie, Tourismus
und grundlegende Infrastruktur Einzug. Das Zementwerk, die Bahnlinie
und das städtische Elektrizitätswerk werden eröffnet, Wasserleitungen
errichtet, Schulen, Spitäler und der erste Kindergarten Tirols
gegründet.
Weltkriege 1914-18 und 1939-45 -
Der Erste Weltkrieg (1914-1918) bringt nach rasch verflüchtigter
Euphorie hauptsächlich Tod und Entbehrung mit sich. Im Zweiten
Weltkrieg (1939-1945) wird Kufstein zur Bühne nationalsozialistischer
Propaganda, zum Schauplatz menschlichen Leides und zum Ziel eines
vernichtenden Bombenangriffes.
UN-Lager 1945-55 - In den
Jahren zwischen 1945 und 1955 werden tausende heimatlose Menschen im
UN-Lager für Displaced Persons untergebracht. Einige von ihnen finden
in Kufstein eine neue Heimat.
Aufschwung ab den 1950er Jahren -
In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts etabliert sich Kufstein als
beliebtes Urlaubsziel, blühender Industriestandort und attraktiver
Lebensraum für die wachsende multikulturelle Bevölkerung. Die Gründung
der Fachhochschule Ende der 90er legt den Grundstein für die
Entwicklung der Stadt als internationaler Bildungsstandort.
Entwicklung im neuen Jahrtausend -
Im 21. Jahrhundert erfolgen Eröffnungen und Ausbauten zahlreicher
Kultur- und Sportstätten, die Schaffung von Begegnungszonen und eine
Erweiterung des Bildungsangebotes. Das öffentliche Bewusstsein für
umfassende Nachhaltigkeit wächst - 2019 ruft Kufstein als erste
Gemeinde Tirols den Klimanotstand aus.

Das hier erhaltene Stück der alten Stadtmauer samt Rundturm half einst,
Kufstein gegen Süden hin abzuschließen. Während des Tiroler
Volksaufstandes im Jahr 1809 wurde der Turm so schwer beschädigt, dass
er nur mehr als Fragment erhalten blieb. Der davor liegende Auracher
Garten wurde als Festungsgarten wie auch als Aufstellungsort für
Zielscheiben genutzt. Geschossen wurde dabei vom anderen Innufer aus.
Dort, wo die Mauer heute einen breiten Durchgang bietet, befand sich
früher nur eine kleine Pforte, die zum Garten führte. Diese wurde 1964
versetzt und vergrößert, um die Durchfahrt von Fahrzeugen zu
ermöglichen. Ein Teil des Gartens musste dem bis heute bestehenden
Parkplatz weichen. Im selben Jahr entstand hier der Eingang zum alten
Festungslift. Mittlerweile wird dieser Aufzug im Inneren des Berges
vorwiegend für den Materialtransport verwendet.

Gedanken beim Wein
Mit Verstand ein Weinlein schlürfen
froh sein, daß wir leben dürfen
eine hübsche Jungfer küssen
nie sich sklavisch ducken müssen
Freundschaft mit den Freunden pflegen
möglichst sich normal bewegen
keinem die Erfolge neiden
dankbar werden und bescheiden
Gegen die Vergreisung kämpfen
seine Temperamente dämpfen
auch die Gegner gelten lassen
weder sich, noch andere hassen
Niemals wegen Nichtigkeiten
blau sich ärgern oder streiten
oder hypochondrisch werden
und sein Glück dadurch gefährden
Sondern still sein Weinlein schlürfen
und solange wir's noch dürfen
die erwähnte Jungfer küssen
Das ist alles was wir wollen
respektive können sollen
respektive können müssen

Der Marienbrunnen prägt den Charakter des Unteren Stadtplatzes
entscheidend. Als er im Jahr 1966 durch einen modernen Marmorbrunnen
ersetzt wurde, formierte sich erheblicher Widerstand in der
Bevölkerung. Elf Jahre später wurde der alte Brunnen an seinem
ursprünglichen Standort wiederaufgebaut. Aus dem Marienbrunnen fließt
reines Quellwasser aus dem Naturschutzgebiet Kaisergebirge.

Die Festung Kufstein ist das Wahrzeichen der Stadt Kufstein und zählt
zu den imposantesten mittelalterlichen Bauwerken Tirols. Heute ist sie
ein Museum und eine Veranstaltungsstätte. Das Bauwerk steht unter
Kulturgüterschutz gemäß der Haager Konvention. Sie liegt auf dem
Festungsberg, einem 90 m hohen Felsen direkt am Inn, oberhalb der Stadt
Kufstein, ist zu Fuß oder mit der Panoramabahn Kaiser Maximilian
erreichbar und umfasst eine Fläche von 24.000 m². Im Bürgerturm der
Festung wurde 1931 eine Freiluftorgel installiert.

Wem der viele Text zu lange war und lieber Bewegtbilder mit Musik mag,
kann sich gerne dieses Video antun:
Kufstein, November 2024
Festung Kufstein, November 2024