web steiner
Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen
Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.
+43/2624/54014 - office@websteiner.com
Lübeck
die Hansestadt an der Trave, September 2024
Die Hansestadt Lübeck ist eine kreisfreie Großstadt
im Norden Deutschlands. Sie liegt im Südosten Schleswig-Holsteins an
der Lübecker Bucht, einer Meeresbucht der Ostsee. Zugang zur Altstadtinsel und Wahrzeichen ist das Holstentor.
Bismarckdenkmal - Dem
Reiterstandbild des Kaisers gegenüber steht unweit vom Lübecker Bahnhof
in der Parkanlage des Lindenplatzes das Denkmal des ehemaligen
Reichskanzlers Otto von Bismarck. Die von Hans Hundrieser nach seinem
zweitplatzierten Entwurf für das Hamburger Bismarck-Denkmal geschaffene
Statue wurde am Sedantag des Jahres 1903 auf dem heutigen
Holstentorplatz vom Bürgermeister Heinrich Klug enthüllt und im Namen
des Senates und der Bürgerschaft entgegengenommen. Es wurde von der
Kunst- und Glockengießerei Lauchhammer gegossen.

Der Holstentorplatz, etwa 170 Meter lang und 70 Meter breit, erstreckt
sich in Ost-West-Richtung. Er beginnt in Verlängerung der Holstenstraße
an der Kreuzung mit Obertrave und Untertrave und reicht bis zur
Puppenbrücke. Das Innere des länglichen Platzes ist als Grünanlage
gestaltet, deren zentraler Weg direkt auf das am östlichen Ende
befindliche Holstentor zuläuft.

Das Holstentor („Holstein-Tor“) ist ein Stadttor, das die Altstadt der
Hansestadt Lübeck nach Westen begrenzt. Es ist das Wahrzeichen der
Stadt und wurde 1478 fertiggestellt. Das spätgotische Gebäude gehört zu
den Überresten der Lübecker Stadtbefestigung. Das Holstentor ist neben
dem Burgtor das einzige erhaltene Stadttor Lübecks. Mehr als 300 Jahre
lang stand es als „Mittleres Holstentor“ in einer Reihe mit drei
weiteren Holstentoren, die im 19. Jahrhundert abgerissen wurden. Das
Mittlere Holstentor, das heute als „Holstentor“ bekannt ist, wurde
hingegen mehrmals restauriert, zuletzt in den Jahren 2005/2006. Seit
1950 befindet sich in den Räumen des Holstentores das
Stadtgeschichtliche Museum von Lübeck.

Das Holstentor besteht aus Südturm, Nordturm und Mittelbau. Es hat vier
Stockwerke, wobei das Erdgeschoss im Mittelbau entfällt, da sich hier
der Durchgang (das Tor) befindet. Die nach Westen (stadtauswärts)
zeigende Seite wird als die Feldseite bezeichnet; die stadteinwärts
weisende Seite ist die Stadtseite.
Die beiden Türme und der Mittelbau bilden von der Stadtseite gesehen
eine Einheit mit einer durchgängigen, geraden Front. Zur Feldseite sind
die Gebäudeteile deutlich voneinander abgesetzt. Die beiden Türme
stehen hier halbkreisförmig vor und liegen am weitesten Punkt ihres
Radius 3,5 Meter vor dem Mittelbau. Auf den Türmen sitzt je ein
kegelförmiges Dach; der Mittelbau ist von einem Giebel besetzt.

SALZSPEICHERGRUPPE
Erbaut 16.- 18. Jahrhundert an der Stelle älterer Heringshäuser.
Ursprünglich verwendet zur Lagerung des aus Lüneburg angefahrenen
Salzes, später Kornspeicher und Holzlager.
Salzspeicher Lübeck ist eine am Fluss gelegene Gruppe von
Salzlagerhallen aus Backstein, die 1579–1745 im Renaissancestil erbaut
wurden.

Promenade an der Obertrave mit St. Petri zu Lübeck und Ev.-Luth. Kirchengemeinde St. Marien zu Lübeck

Katholische Pfarrei Zu den Lübecker Märtyrern - Katholische Propsteikirche "Herz Jesu" Eingeweiht 1891
Die Krypta ist Gedenkstätte für die vier Lübecker Geistlichen, die am 10. November 1943 hingerichtet wurden.
Die Herz-Jesu-Kirche ist eine vollständig in Backstein ausgeführte
querschifflose Stutzbasilika mit Kreuzgewölben und einen apsidialen
Chor mit Fünfachtelschluss. Aufgrund der Grundstückssituation ist die
Kirche nicht geostet, sondern der Altar befindet sich im Westen.
Östlich dem Kirchenschiff vorgelagert ist ein Turm, der zur Wahrung des
von den sieben Türmen der mittelalterlichen Kirchen Lübecks geprägten
Stadtbildes nur einen verkürzten, Dachreiter-artigen Turmhelm hat.

Als erste römisch-katholische Kirche Lübecks wurde die Herz-Jesu-Kirche
nach der Reformation neu errichtet und 1891 eingeweiht. Zur gleichen
Zeit wurden in Deutschland und in Europa sehr viele Herz-Jesu-Kirchen
gebaut, zum Beispiel Sacre Coeur in Paris und Jesu Hjerte Kirke in
Kopenhagen. Der Name Herz-Jesu soll die religiöse Situation der
Entstehungszeit widerspiegeln und ist Ausdruck für die Mitte der Person
Jesu.
Am 10. November 1943 wurden im Hamburger Gefängnis am Holstenglacis
vier Lübecker Geistliche durch das Fallbeil hingerichtet. Im Abstand
von jeweils nur drei Minuten sterben die katholischen Kapläne Eduard
Müller, Johannes Prassek und Hermann Lange sowie der evangelische
Pastor Karl Friedrich Stellbrink. Sie hatten öffentlich und bei den
ihnen anvertrauten Gläubigen gegen die Verbrechen des Nazi-Regimes
Stellung bezogen. In einem Anbau an die Propsteikirche Herz Jesu
befindet sich seit 2013 die Gedenkstätte Lübecker Märtyrer.

Die Kirche hat eine Gesamtlänge von 46,5 m, wovon auf das Schiff 32 m,
auf den Chorraum 6,7 m und auf den Turm 7,8 m entfallen. Die Breite des
Kirchenschiffes beträgt 18,7 m, während der Turm eine Breite von 7,2 m
und der Chor von 9 m aufweist. Die Schlusssteine des Mittelgewölbes
sind 14 m über dem Kirchenfußboden, während die Seitenschiffe ca. 1,5 m
niedriger bleiben. Die Firstlinie des Daches erreicht eine Höhe von
etwa 23 m. Die Höhe des Turmes beträgt bis zum Fußboden der Galerie 27
m, bis zu den Spitzen der Schildgiebel 40 m und bis zum Turmkreuz ca.
60 m.
Neben einer Truhenorgel der niederländischen Orgelbaufirma Henk Kloop
befindet sich in der Propsteikirche eine Orgel der Firma Orgelbau Kuhn
(Männedorf, Schweiz) aus dem Jahre 1998.

Über dem Altar hängt das 1930 von Ernst Barlach geschaffene Kreuz
(Gips, bronziert), das viele Jahre seinen Platz unter der Orgelempore
in der Lübecker Kirche St. Vicelin hatte. Dort befindet sich nun eine
Ikone der Lübecker Märtyrer. Das Barlach-Kreuz
wurde von dem Lübecker Architekten Emil Steffann vor dem Hitlerregime
gerettet, das Barlachs Werke als "entartet" verboten hatte. Nach dem 2.
Weltkrieg wurde es restauriert und kam nach St. Vicelin. Im Zuge der
Renovierung der Propsteikirche fand es in Herz Jesu einen neuen Platz
und hier entfaltet es seither als Altarkreuz - wie von Barlach
intendiert - eine große Wirkung.

In der Krypta der Kirche befindet sich seit 1955 eine Gedenkstätte für
die Lübecker Märtyrer, die drei an der Herz-Jesu-Kirche tätigen Kapläne
Hermann Lange, Eduard Müller und Johannes Prassek sowie den
evangelischen Pastor Karl Friedrich Stellbrink, die 1943 gemeinsam
hingerichtet wurden.
Die Lübecker Märtyrer
Am 10. November 1943 werden in einem Hamburger Gefängnis vier
Geistliche mit dem Fallbeil hingerichtet. Die drei katholischen Kapläne
Hermann Lange, Eduard Müller und Johannes Prassek haben in Lübeck in
der Pfarrei Herz Jesu und der evangelische Pastor Karl Friedrich
Stellbrink in der Lutherkirche gewirkt, bevor sie 1942 verhaftet und
1943 vom Volksgerichtshof in einem Prozess in Lübeck zum Tode
verurteilt werden. Wer sind diese vier Männer, die 1934 bzw. 1939/40 nach Lübeck gekommen
sind? Warum geraten sie in Konflikt mit der national-sozialistischen
Diktatur und werden schließlich ermordet? Und warum werden sie als
Gruppe der vier Lübecker Märtyrer seit 1943 verehrt und die drei
katholischen Kapläne 2011 selig gesprochen?
Vorgeschichte: Vom Kaiserreich zum Nationalsozialismus
Geboren werden die vier Männer im Deutschen Kaiserreich, in einer Zeit,
die wesentlich von Nationalismus, Militarismus und Antisemitismus
geprägt ist. In Deutschland kommt es 1918 nach der Niederlage im
Ersten Weltkrieg zu einer Revolution, in deren Verlauf eine Demokratie
entsteht: Die Weimarer Republik. Sie steht jedoch von Anfang an unter
starkem Druck und wird von so gegensätzlichen Kräften wie Kommunisten
oder Anhängern des Kaiserreichs bekämpft. Die deutsche Bevölkerung
leidet große Not in Folge der dramatischen Geldentwertung von 1923.
Dieses und andere Probleme werden der jungen Demokratie angelastet,
obwohl sie vom Kaiserreich zu verantworten sind. Das Vertrauen in die
neue Staatsform schwindet. Viele Menschen bleiben von Unterordnung und
Autoritätsglauben bestimmt. Eine demokratische Mentalität in der
Mehrheit der Bevölkerung bildet sich deshalb nicht heran. Ab 1930
gelingt es der rechtsextremistischen Partei der Nationalsozialisten,
nicht zuletzt wegen der 1929 einsetzenden Weltwirtschaftskrise, die
Unzufriedenheit der Menschen zu nutzen und immer mehr Wähler auf ihre
Seite zu ziehen. Am 30. Januar 1933 wird Adolf Hitler zum Reichskanzler
ernannt, die Diktatur der Nationalsozialisten bahnt sich an.

Nach der Hinrichtung der Lübecker Märtyrer am 10. November 1943
beginnen zunächst Menschen aus dem unmittelbaren Umfeld, vor allem die
mitverhafte-ten Laien, mit dem dankbaren Gedenken. Daraus entwickelt
sich in den Folgejahren bis heute - weit über Lübeck hinaus - eine
vielgestaltige Kultur der Erinnerung und Verehrung. Besonders
ausgeprägt ist diese Kultur an Orten, die einen direkten Bezug zu einem
der Geistlichen haben.

Kostenrechnung Karl Friedrich Stellbrink in der Strafsache wegen
Wehrkraftzersetzung in der die Gerichts-, Transport- und
Vollstreckungskosten den Erben in Rechnung gestellt werden.
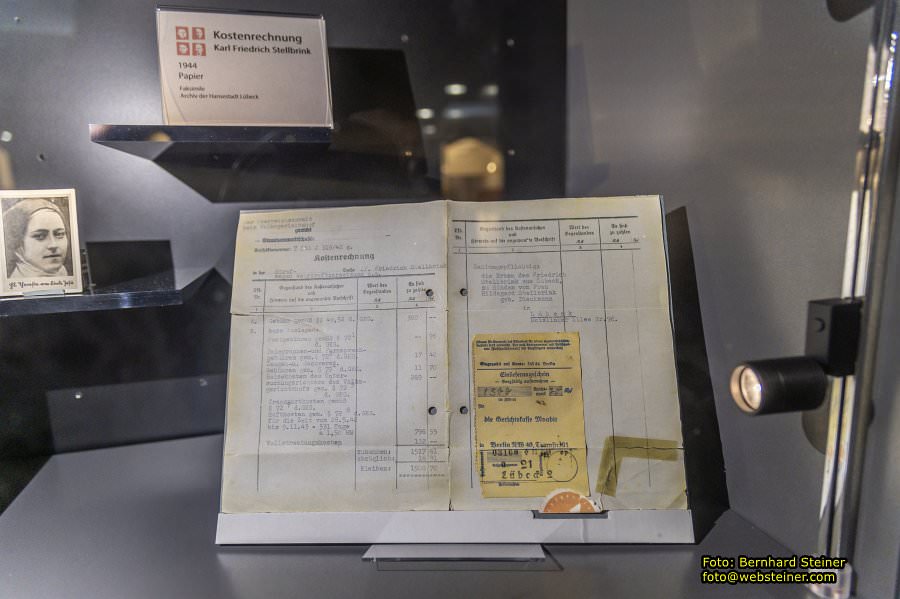
Palais Rantzau - ein Haus der Deutschen Stiftung Denkmalschutz
Das Palais ist die einzige von ursprünglich 13 Domherrenkurien in
Lübeck, die nicht der Säkularisation von 1803 zum Opfer fiel, die
übrigen wurden abgerissen. Sie ging in den Besitz der Stadt über, wurde
später verkauft. Der letzte Erwerber der Immobilie war ein Graf zu
Rantzau-Breitenburg, der das Haus nach 1858 in romantisierendem Stil
umbauen ließ. Deshalb wird das Gebäude auch oft Schloß Rantzau genannt
. Es gehört heute der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, die hat es an
die Verwaltung des Schleswig-Holstein Musik Festivals vermietet.

Lübecker Dom - Schlichter Dom von 1173 mit Zwillingstürmen, die nach dem Bombenangriff von 1942 wieder aufgebaut wurden.
Der Lübecker Dom (auch Dom zu Lübeck) ist der erste große
Backsteinkirchbau an der Ostsee und mit fast 132 Metern Länge eine der
längsten Backsteinkirchen. 1173 wurde der Lübecker Dom von Heinrich dem
Löwen begründet und 1247 geweiht. Patrone der evangelischen Kirche sind
die Heiligen Johannes der Täufer und Blasius (wie im Braunschweiger
Dom), Maria und Nikolaus.

Im Dom befindet sich das auffallende, das Hauptschiff beherrschende, 17 Meter hohe Triumphkreuz
des Lübecker Künstlers Bernt Notke. Es wurde von dem Lübecker Bischof
Albert II. Krummendiek gestiftet und 1477 im Kirchenschiff aufgerichtet.
Die Renaissance-Kanzel wurde
1586 vom damaligen Pastor Dionysius Schünemann gestiftet und von dem
flämischen Steinmetz Hans Fleming errichtet. Sie erhebt sich über einem
Untersatz, der von einer Mose-Statue getragen wird. Der Kanzelkorb ist
mit sieben Alabaster-Reliefs geschmückt, die Szenen aus dem Leben Jesu
zeigen, die alle von dem flämischen Bildhauer Willem van den Broeck
gearbeitet wurden. Der Schalldeckel mit einer Statue des Auferstandenen
stammt von 1570, der Aufgang wurde 1731 im spätbarocken Stil erneuert.
Ein besonderes Kunstwerk ist das schmiedeeiserne Gitter in
verschlungenen Formen, das 1572 von der Bruderschaft der
Stecknitzfahrer gestiftet wurde.

Die heutige Domorgel wurde 1970 von der dänischen Orgelbaufirma
Marcussen & Søn aus Apenrade erbaut. Das Instrument wurde nicht im
Westwerk aufgestellt, wo sich bis 1942 die große Schnitger-Orgel
befand, sondern an der Wand des nördlichen Seitenschiffes erbaut, weil
man das Westwerk freihalten wollte. Der schlichte, symmetrische
Prospekt mit klassischer Werkanordnung wurde von dem Hamburger
Architekten Friedhelm Grundmann entworfen. Das Schleifladen-Instrument
hat 47 Register und zwei Nebenregister auf drei Manualen und Pedal. Die
Spieltrakturen sind mechanisch, die Registertrakturen sind elektrisch.

Grabkapellen im südlichen Seitenschiff

Bernt Notke (1435-1509) war der wohl bedeutendste Kunstmaler und
Bildschnitzer des ausgehenden Mittelalters im Ostseeraum und schuf das
17 Meter hohe, den Kirchenraum des Lübecker Doms prägende Triumphkreuz.
Bischof Albert Krummediek stiftete die aufwändige Kreuzanlage und ließ
sich prominent und selbstbewußt auf dem Trabesbalken zu Füßen des
gekreuzigten Jesus Christus knieend neben den Heiligen Maria, Maria
Magdalena und Johannes abbilden.

Altar der kanonischen Tageszeiten, 1. Drittel des 15. Jahrh., unbekannter Lübecker Meister
Flügelaltar (144 × 133 cm), die Bilderfolge veranschaulicht das
Aegidius Romanus zugeschriebene Tageszeitengedicht Patris Sapientia und
gibt es unter den einzelnen Passionsszenen wider.
Die Tageszeiten, auch Hore genannt, sind selbständige Teile des
Stundengebetes und Bestandteil der christlich-katholischen Liturgie.
Ziel des Stundengebetes ist die Heiligung des Tages. Die Besonderheit
der einzelnen Tageszeiten wird hervorgehoben und geehrt. Durch sieben
Gebete wird der Tag ungefähr in einen 3-Stunden-Rhythmus strukturiert.
Das Stundengebet ist am Zyklus des Tageslaufs, dem Wechsel von Wachen
und Schlafen, Licht und Dunkelheit, Arbeit und Ruhe orientiert. Die
zyklische Zeiterfahrung des Menschen wird, genauso wie die lineare
Erfahrung von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, in die
Glaubenspraxis einbezogen. Herausgehoben sind Sonnenaufgang und
Sonnenuntergang. (canonicus, lat. „regelgerecht"; kanonisch: den Regeln
entsprechend)
Das Kreuzigungsretabel zeigt 11 Szenen der Passion Christi. Das
Bildprogramm zwischen der Außen- und Innenseite weist chronologische
Sprünge auf. Dies lässt sich dadurch erklären, dass sich die sieben
dargestellten Leiden Christi auf der geöffneten Festtagsseite an den
Gebetszeiten des Tages orientieren.

Auch die Bildschnitzereien der Außenverkleidung des Lettners wurden von
Bernt Notke geschaffen. Es handelt sich dabei um eine Stiftung des
Lübecker Bürgermeisters Andreas Geverdes, die 1477 zusammen mit dem
Triumphkreuz fertiggestellt wurde. Vorbild war der Lettner im
Magdeburger Dom, Geverdes ursprünglicher Heimatstadt. Die vier Statuen
zeigen die Patrone des Doms; von Nord nach Süd sind es die Heiligen
Nikolaus, Maria, Johannes der Täufer und Blasius. Die Kirchenuhr am
Südende des Lettners stammt aus dem Jahr 1628.

Marienaltar mit der Einhornjagd, 1506
Flügelaltar (201 × 101 cm), in dessen Mittelschrein ein Relief eine
Einhornjagd darstellt, bei der die Jungfrau Maria das von Hunden und
dem als Jäger mit Horn dargestellten Erzengel Gabriel verfolgte Einhorn
in ihrem Schoß schützt. Die Einhornjagd symbolisiert dabei die
Verkündigung. Darüber befindet sich Gottvater in einer Wolke und ein in
eine Stadtmauer integrierter Gnadenstuhl. Ursprünglich mit
Doppelflügeln; die Innenseiten der Flügel zeigen mit Geburt Christi,
Heimsuchung, Anbetung der Könige und Darstellung Jesu im Tempel vier
Szenen aus der Geburtsgeschichte; die äußeren Altarflügel dieser
Stiftung des Domvikars Johannes Parchem sind verloren.
Das zentrale Schnitzrelief im Mittelschrein des Marienretabels zeigt
die in Lübeck einzigartige Darstellung der unbefleckten Empfängnis
Mariens, die „Immaculata conceptio". Das Einhorn symbolisiert den
Heiland, Christus. Er wird von dem Erzengel Gabriel, dargestellt als
Jäger mit Horn und Spieß, in den Schoß Mariens getrieben. Nach einer
Episode aus einer Schrift des 2. Jahrhunderts n. Chr., ließ sich das
wilde Tier nur von einer reinen Jungfrau fangen, indem es sich ihr
vertraulich angenähert und seinen Kopf in ihren Schoß gelegt habe.
Diese Episode wurde allegorisch als Hinweis auf Christus ausgelegt:
Auch er war im Schoß Mariens empfangen worden und dann später verraten
und getötet worden. Die Hunde symbolisieren die vier christlichen
Tugenden Wahrheit, Friede, Barmherzigkeit und Gerechtigkeit. Die Szene
befindet sich im „hortus con-clusus", dem verschlossenen Garten, ein
mit der Mariensymbolik fest verbundenes Bildmotiv. Es geht auf eine
Bibelstelle des Alten Testamentes zurück: HLD 4, 12: „Meine Schwester,
liebe Braut, du bist ein verschlossener Garten, eine verschlossene
Quelle, ein versiegelter Born".

Die eherne Fünte von Lorenz Grove aus dem Jahr 1455 ersetzte die heute
in der Kirche von Klein Wesenberg befindliche alte steinerne Fünte aus
Kalkstein von der schwedischen Insel Gotland. Die Taufe stand bis 1942
vor der Orgel im Westen der Kirche nahe dem Eingang, dem früher
traditionellen Standort von Taufbecken in Kirchen. Beim Wiederaufbau
nach dem Zweiten Weltkrieg wurde sie in eine von Sandtmann und
Grundmann neu gestaltete Taufkapelle zwischen Lettner und Ostchor
versetzt und erhielt einen von Rolf Koolman gefertigten Einsatz.

St. Petri Kirche - Lübecks Kulturkirche mit Aussichtsturm und Café.
Gotische Backsteinhallenkirche. Erbaut unter abschnittsweiser Abtragung
der um 1220-40 errichteten spätromanischen Kirche vom Ende 13. Jh. bis
gegen Mitte 14. Jh., erweitert im 15. und 16. Jh. zu der heutigen
fünfschiffigen Anlage. 1942 durch Brand zerstört. Wiederaufbau des
Äußeren mit der Wiederherstellung des Daches 1966 abgeschlossen.

Ausblick von der St. Petri Kirche auf den Lübecker Dom

Ausblick von der St. Petri Kirche auf St. Marien zu Lübeck und den Markt

Ausblick von der St. Petri Kirche auf das Holstentor

Stadtverwaltung Hansestadt Lübeck - Dieses Rathaus aus dem 13.
Jahrhundert mit mehreren prunkvollen Arkaden bietet Geschäfte und
Führungen. Das Rathaus der Hansestadt Lübeck zählt zu den bekanntesten
Bauwerken der Backsteingotik. Es ist eines der größten
mittelalterlichen Rathäuser in Deutschland.
Neues Gemach vom Markt, Wappenschilde aus Blech überdecken gotische Originale aus Eichenholz

Das Rathaus der Hansestadt Lübeck - seit fast 800 Jahren werden von
hier aus die Geschicke der Stadt gelenkt. Es ist Sitz der Verwaltung
und Tagungsort des Senats sowie der Bürgerschaft und ihrer Ausschüsse.
Renaissancelaube und gotische Schildwand

Hauptbau. Vorbild für Rathausbauten der hansischen Ostseestädte.
Älteste Teile 1230-40 und nach 1251, Umbau 1340-50, Schaugiebelwand zum
Markt 1435 umgestaltet. 1887-91 durchgreifende Erneuerung des Inneren
und Rekonstruktion der Nordfassade. Hauptportal mit Beischlagwangen von
1452. Hölzerner Erker 1586 gearbeitet.
Gleich hinter der Eingangstür befinden sich das im
19. Jahrhundert geschaffene riesige Foyer und ein Treppenaufgang, in
dem zahlreiche Bilder hängen, die Szenen aus der Stadtgründung zum
Thema haben.

Marzipan-Tisch im Marzipanmuseum Niederegger
Die zwölf Figuren an diesem Tisch sind das bislang größte Kunstwerk aus
Marzipan. Die Skulpturen stammen aus dem Atelier des 1964 geborenen
Bildhauers Johannes Kiefer. Von der Idee bis zur Realisierung benötigte
er 3500 Arbeitsstunden, als Modelliermasse hat der Künstler 500
Kilogramm Niederegger-Marzipan verarbeitet mit eigens dafür
entwickelten Werkzeugen.

Das Lübecker Holstentor aus original NIEDEREGGER Marzipan.
Zwei Konditoren aus dem Hause NIEDEREGGER verwirklichten dieses „süße Holstentor" in 350 Stunden Handarbeit.

Die J. G. Niederegger GmbH & Co. KG ist einer der bekanntesten
Hersteller von Lübecker Marzipan und anderer Konditoreiprodukte. Nach
Firmenangaben werden täglich bis zu 30.000 kg Marzipan hergestellt. Die
Produktpalette umfasst 300 Spezialitäten wie Marzipan und Nougat sowie
Pralinen, Trüffel, Baumkuchen, Stollen und Gebäck. Außerdem werden
Sonderfertigungen nach Wunsch ausgeführt. Die Produkte werden in
weltweit mehr als 40 Länder versandt.

ST.-MARIEN-KIRCHE
Hauptbau der norddeutschen Backsteinarchitektur. Durch erstmalige
Umsetzung des Systems der französischen Kathedralgotik in das
Backsteinmaterial. Vorbild für die großen Kirchen im Ostseeraum. Erbaut
zwischen 1260 und 1350 nach Abbruch der gegen 1200 errichteten, um 1250
zur Halle umgeformten vorhergehenden Anlage. 1942 vollständig
ausgebrannt. Wiederaufbau bis 1959, Dachreiter 1978/80
wiederhergestellt.

Von der mittelalterlichen Kirchenausstattung sind zahlreiche
Inventarstücke erhalten: Das bronzene Taufbecken wurde 1337 von Hans
Apengeter gegossen. Es stand bis 1942 im Westen der Kirche, danach
befand es sich in der Mitte des Chorraums. Im Zusammenhang mit
umfassenden Sanierungsarbeiten 2023, bei denen auch das Altarretabel
zurückversetzt wurde, wurde das Taufbecken wieder im Westen der Kirche
aufgestellt. Sein Inhalt von 406 Litern entspricht dem Hamburger bzw.
Bremer Bierfass (405 Liter).

Das historische Geläut der Marienkirche bestand aus elf Glocken und
hing im Südturm in einer Glockenstube in rund 55 m Höhe. Es wurde
schließlich im Zweiten Weltkrieg zerstört, als die Marienkirche nach
dem Luftangriff auf Lübeck am 29. März 1942 ausbrannte. Bei
Temperaturen von ca. 1000 °C schmolzen die sieben noch im Turm
hängenden Glocken und stürzten herab. Vorher sollen sie in dem durch
das Feuer verursachten Luftzug noch einmal angeschlagen haben. Die
Trümmer der größten Glocke, der Pulsglocke des Lübecker Ratsgießers
Albert Benningk von 1669 (7.134 kg, Durchmesser 2260 mm, Schlagton
fis0), und der drittgrößten Glocke von 1508, der Sonntagsglocke von
Hinrik van Campen (2.875 kg, Durchmesser 1710 mm, Schlagton a0) blieben
als Mahnmal in der ehemaligen Schinkel-Kapelle unter dem Südturm
erhalten.
Beim Brand des Jahres 1942 heruntergestürzte Glocken am Boden des südlichen Turms

Die Lübecker Marienkirche (offiziell St. Marien zu Lübeck) wurde
zwischen 1265 und 1351 errichtet. Die Lübecker Markt- und
Hauptpfarrkirche befindet sich auf dem höchsten Punkt der Lübecker
Altstadtinsel, ist Teil des UNESCO-Welterbes Lübecker Altstadt und eine
der größten Backsteinkirchen. Sie wird als „Mutterkirche der
Backsteingotik“ bezeichnet und gilt als ein Hauptwerk des Kirchenbaus
im Ostseeraum. St. Marien gehört zur Evangelisch-Lutherischen Kirche in
Norddeutschland.

Die Lübecker Marienkirche war Vorbild für rund 70 Kirchen dieses Stils
im Ostseeraum. Daher wird dem Bauwerk eine herausragende
architektonische Bedeutung beigemessen. Mit der Marienkirche wurde in
Lübeck der hochaufstrebende Gotik-Stil aus Frankreich mit norddeutschem
Backstein umgesetzt. Der Gewölbescheitel befindet sich im Mittelschiff
38,5 Meter über dem Boden. Es ist damit das höchste Backsteingewölbe
der Welt.
Blick zum 38,5 m hohen Gewölbe des Hauptschiffes

Marienkirche in Lübeck, Totentanzfenster an der Nordwand des nördlichen Querhauses.

Die neue Astronomische Uhr, die an der Ostseite des nördlichen
Querschiffes in der Totentanzkapelle aufgestellt wurde, ist das Werk
von Paul Behrens, einem Lübecker Uhrmachermeister, der es als
Lebenswerk von 1960 bis 1967 plante, dafür Spenden sammelte, es in den
Uhrteilen selbst herstellte und es bis an sein Lebensende wartete. Die
Fassade ist eine vereinfachte Kopie des Originals. Von komplizierter
Mechanik bewegte Kalender- und Planetenscheiben zeigen Tag und Monat,
Sonnen- und Mondstand, die Tierkreiszeichen, das Osterdatum und die
Goldene Zahl. Um 12 Uhr mittags erklingt das Glockenspiel und der Lauf
der Figuren vor dem segnenden Christus (ursprünglich Kurfürsten, seit
dem Neuaufbau nach dem Krieg acht Vertreter der Völker der Erde) setzt
sich in Gang.

Zum Lübecker Totentanz in St. Marien
(geschaffen 1463, durch Kopie ersetzt 1701, zerstört 1942)
Den berühmten Lübecker Totentanz schuf der junge Bernt Notke 1463 nach
dem Vorbild der Danse Macabre in Paris aus dem Jahr 1424/25 für die
Beichtkapelle im Norden der Marienkirche. Diese lichtabgewandte Seite
legt den Gedanken an den Tod nahe und erinnert den Menschen daran,
durch Reue, Beichte und Buße sein Leben entsprechend der christlichen
Lehre zu ordnen. Damals erwartete man die sich von Süden ausbreitende
Pest, die Lübeck tatsächlich zu Ostern 1464 erreichen sollte.
Der Totentanz war nicht auf Holztafeln, sondern auf eine 26 Meter lange
und fast zwei Meter hohe Wandbespannung aus Leinen gemalt, die sich
oberhalb des Beichtgestühls entlang den Wänden der Kapelle als
fortlaufende Bildsequenz erstreckte. Der Fries zeigte, angeführt von
einem Flöte spielenden und einem Sarg tragenden Tod, 24 nahezu
lebensgroße Paare. Sie bestanden jeweils aus einer Todesfigur und einem
(noch) Lebenden, angefangen mit dem Papst und dem Kaiser, über den
Bürgermeister und Kaufmann bis hin zum Bauern und zum Wiegenkind. Der
Reigen umfasste Vertreter aller Stände und schloss einzelne weibliche
Figuren und verschiedene Altersstufen ein. In den Tanz des Todes fügten
sich die Lebenden nur starr und widerstrebend ein, dagegen sprangen die
Totengerippe wild und ausgelassen. Am Ende aber mähte ein Sense
schwingender Tod alles Leben nieder.
Ein Merkmal des Lübecker Totentanzes, das ihn von allen anderen
überlieferten Totentänzen unterscheidet, ist der Umstand, dass sich der
makabre Reigen unmittelbar vor der heimischen Landschaft mit der
repräsentativen Stadtkulisse Lübecks in ihrer Mitte abspielt. So kann
sich der Betrachter mit den Figuren im Reigen identifizieren und
erkennen, dass ihm hier und jetzt ein Spiegel vor Augen gehalten wird,
in dem er sich selbst im Tarız mit dem Tod erblickt. Danit erweist sich
angesichts des Todes die Vergänglichkeit von Macht, Reichtum und
Schönheit dieser Welt. Ähnlich kunstvoll verknüpft wie die
farbenprächtige Bilderfolge auf dem Gemälde, entfaltete sich unterhalb
der Figuren der niederdeutsche Text mit dem Dialog zwischen den
Todesfiguren und den Lebenden. Der Totentanz gemahnte hier den
einzelnen, sein Leben einerseits auf das Jenseits und die Erlösung
auszurichten und sich andererseits für seine persönliche Aufgabe
innerhalb der sozialen Gemeinschaft im Diesseits einzusetzen.
Der Totentanz von St. Marien hat in der St. Nikolaikirche in Tallinn
ein, Schwesterstück, den Revaler Totentanz, den Bernt Notke um 1500
nach dem Vorbild seines Lübecker Totentanzfrieses anfertigte. Dieses
ebenfalls auf Leinwand gemalte Fragment bildet mit 13 Figuren den
Anfang eines ursprünglich vollständigen Totentanzes. Die Dynamik der
Figuren und die Leuchtkraft seiner Farben lassen noch heute erahnen,
wie ausdrucksstark auch das alte Gemälde in Lübeck gewesen sein muss.
Die empfindliche Wandbespannung des Lübecker Frieses wurde im Laufe der
Jahre häufig repariert und war 1701 schließlich so verschlissen, dass
man das gesamte Gemälde durch eine Kopie des Kirchenmalers Anton
Wortmann ersetzen ließ. Zugleich schuf der verdiente Stadtpoet
Nathanael Schlott eine zeitgemäß stilisierte Neudichtung, die wie beim
alten Totentanz an die Stelle unterhalb der Figuren trat. Die neuen
Verse vermittelten ein gewandeltes Todesverständnis; denn die barocke
Sehnsucht nach dem Tod verdrängte die Lebensfreude und die Angst vor
dem Tod und dem Jüngsten Gericht, wie sie vielen Figuren des
spätmittelalterlichen Werks eigen war.
Der Totentanz von St. Marien wirkt seit seinem Entstehen bis in unsere
jüngste Gegenwart. Hiervon zeugen traditionelle und neue Formen des
Kunsttypus, zumal wenn Kriege, Seuchen und andere Katastrophen ein
Gefühl von Angst und Ohnmacht angesichts übermächtiger Gewalten
hervorrufen. Gerade zu solchen Zeiten suchen und finden Menschen im
Totentanz einen Ausdruck für ihre existenzielle Grundstimmung. Im
Zweiten Weltkrieg wurde der Lübecker Totentanz vollständig zerstört.
Heute halten in der Totentanzkapelle zwei Jüngere künstlerische
Umsetzungen das Thema Tod und Totentanz wach. Zum einen sind es die
zwei hoch aufragenden Totentanzfenster von Alfred Mahlau in der
Nordwand und zum andern ist es das halbrunde Fenster von Markus Lüpertz
über dem Nordportal der Kapelle. Mahlau entwarf sein Werk in den Jahren
1956/57 in Erinnerung an den vernichteten Fries. Dabei ließ er sich von
den alten Figuren anregen. Als Mahnmal des Zweiten Weltkriegs
platzierte er den Todesreigen über den brennenden Häusern und Türmen
der Stadt Lübeck. Dieses katastrophale Szenario deutet der Maler
jedoch, Trost spendend, in eine Vision des Friedens um; denn er
interpretiert das Wiegenkind am Ende des Totenreigens als das
Christuskind in der Krippe, das den Tod überwindet und die Rechte zum
Segensgestus erhebt. Die Aussage gipfelt in den Worten GLORIA IN
EXCELSIS DEO. AMEN" (Ehre sei Gott in der Höhe. Amen). Das von Lüpertz
2002 gestaltete Fenster kombiniert vertraute christliche Zeichen von
Tod und Auferstehung: den Fisch als Symbol für Christus, den
Totenschädel im Gespräch mit der Friedenstaube, die in den Krallen eine
aufblühende rote Rose als Symbol der Liebe und des Lebens hält, den
blauen Krug mit dem Wasser des Lebens, die Schnecke als Symbol für Tod
und Wiedergeburt und die sieben Fackeln der Apokalypse, die das Jüngste
Gericht ankündigen. So gesehen versteht sich das Bildfenster nicht als
Vision des Schreckens, sondern als Hoffnung und Trost spendende Deutung
des Todes.

Totentanzorgel (Chororgel) von 1986

Mit der Beweinung Christi hängt eines der Hauptwerke des Nazareners
Friedrich Overbeck in der Gebetskapelle im nördlichen Chorumgang.

Heinrich Brabender: Passionsrelief aus Baumberger Sandstein von 1500-1520
Abendmahlsrelief im Chorumgang, der dunkle Fleck links unten ist die Maus, ein Lübecker Wahrzeichen

Die Umgestaltung des Innenraums nach Bonivers Entwurf wurde 1958/1959
durchgeführt, der Chorraum wurde durch drei Meter hohe weißgekalkte
Mauern vom Chorumgang abgetrennt. An die Stelle des Fredenhagenaltars
traten ein schlichter Altarblock aus Muschelkalk und ein vom Gurtbogen
herabhängendes Kruzifix von Gerhard Marcks. Am 20. Dezember 1959 fand
die Einweihung des neugestalteten Chorraums statt.

1955 wurde die Totentanzorgel von der Orgelbaufirma Kemper & Sohn
nach den Abmessungen von 1937 wiederhergestellt, allerdings nun im
nördlichen Chorumgang, zum Hochchor hin ausgerichtet. Ihren
ursprünglichen Platz nahm die neue Astronomische Uhr ein. Diese
Nachkriegsorgel, stark reparaturanfällig, wurde 1986 an gleicher Stelle
ersetzt durch die neue Totentanzorgel, erbaut von der Firma Führer in
Wilhelmshaven. Sie verfügt bei mechanischer Spieltraktur auf vier
Manualen und Pedal über insgesamt 56 Register mit ca. 5.000 Pfeifen.

Anstelle dieser 1942 beim Bombenangriff verbrannten Großen Orgel wurde
1968 die nach Registerzahl zu dieser Zeit (nach der Orgel der
Dreifaltigkeitskathedrale Liepāja) zweitgrößte Orgel der Welt mit
mechanischer Spieltraktur von der Orgelbaufirma Kemper & Sohn
geschaffen. Sie besaß auf fünf Manualen und Pedal 100 Register mit
8.512 Pfeifen; die längste mass elf Meter, die kleinste hatte etwa die
Größe eines Bleistiftes, wobei die klingende Länge nur wenige
Millimeter beträgt. Die Registertraktur arbeitete elektrisch und
verfügte über Freikombinationen; das Registertableau war doppelt
angelegt. Nach fachlichen Beurteilungen wurde entschieden, die
Kemper-Orgel im Zuge der bis etwa 2030 andauernden Sanierungsarbeiten
im Innenraum der Kirche abzubauen und zu ersetzen.

Das in der
Marientidenkapelle wurde 1518 geschaffen. 1522 stiftete es der aus
Geldern stammende Kaufmann Johann Bone für die Kapelle. Nach deren
Umbau zur Beichtkapelle 1790 wurde der Altar mehrfach in der Kirche
umgestellt. Während des Zweiten Weltkriegs stand er in der Briefkapelle
und entging so der Zerstörung. Der doppelflügelige Altar zeigt in 26
gemalten und geschnitzten Szenen das Marienleben, im Zentrum der
geschnitzten Festtagsseite den Marientod (die kleine zugehörige Gruppe
der Himmelfahrt Mariens darüber wurde 1945 gestohlen), darunter ihr
Begräbniszug, links die Verkündigung und rechts ihre Grablegung. Die
geschnitzten Flügel dieser Wandlung zeigen links oben die Geburt
Marias, darunter die Darstellung Jesu im Tempel, und rechts oben eine
verkürzte Wurzel Jesse und darunter den zwölfjährigen Jesus im Tempel.
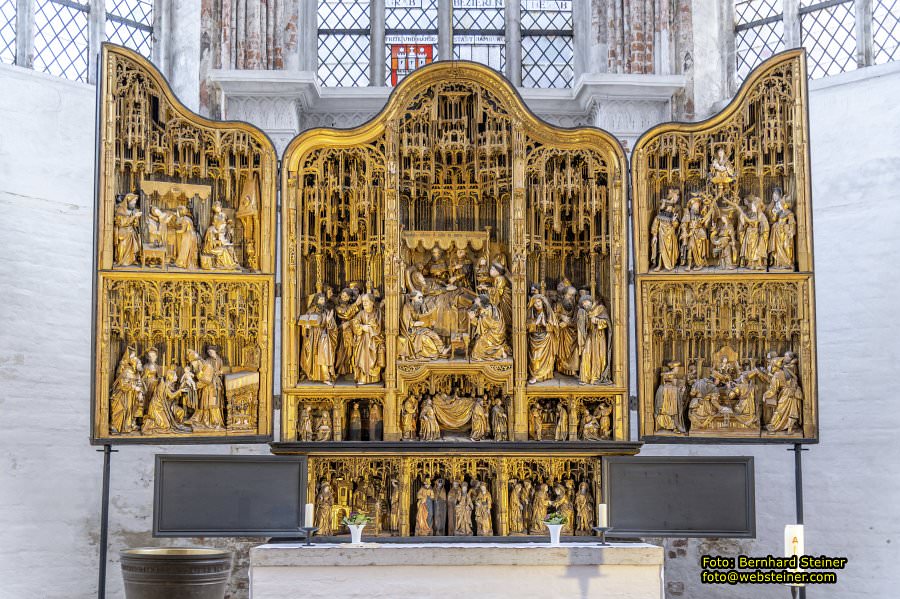
Der Teufel an der Marienkirche in Lübeck, Plastik von Rolf Goerler, 1999
Als man die Grundmauern der Marienkirche legte, glaubte der Teufel, daß
man dabei sei, ein Weinhaus zu errichten. Das gefiel ihm, denn schon
manche Seele hatte über einen solchen Ort den Weg zu ihm genommen. Er
mischte sich deshalb unter die Arbeiter und half. Kein Wunder, daß
der Bau staunenswert schnell in die Höhe wuchs. Doch mußte der Teufel
eines Tages erkennen, worauf es hinauslief mit dem Bau, und voller Wut
schleppte er einen gewaltigen Felsbrocken herbei, die angefangene
Kirche damit zu zertrümmern. Schon brauste er durch die Lüfte heran, da
rief ihm ein kecker Geselle zu: "Haltet ein, Herr Teufel! Laßt stehn,
was steht! Wir bauen Euch dafür neben der Kirche ein Weinhaus!" Das
schien dem Teufel geratener; er ließ den Stein hart vor der Mauer der
Kirche fallen. Dort liegt er noch und zeigt deutlich die Eindrücke der
Teufelskrallen, und gleich neben der Kirche wurde der Ratsweinkeller
erbaut.

Buddenbrookhaus - Heinrich-und-Thomas-Mann-Zentrum
Wohnhaus der Großeltern von Thomas Mann, Literaturnobelpreisträger 1929.
Erbaut 1289. Fassade und Erweiterungsbau von 1758. Im Besitz der
Familie Mann von 1841-91. Schauplatz des „Buddenbrooks"-Romans. Seit
1993 Literaturmuseum, Spezial-bibliothek, Archiv, Forschungsstätte,
Heinrich-und-Thomas-Mann-Zentrum.
BUDDENBROOK-HAUS
Wohn- und Geschäftshaus der Familie Mann 1842-1891. Schauplatz des
Romans "Buddenbrooks" (1901) von Thomas Mann. Kriegszerstört 1942. Als
Geschäftshaus wiedererrichtet 1957. Fassade und Keller Reste eines
spätbarocken Neubaus von 1758. Fragmente eines mittelalterlichen Hauses
im nördlichen und westlichen Bereich des Kellers (vor 1289).

St.-Jakobi-Kirche Lübeck - Ev.-Luth. Kirchengemeinde St. Jakobi Lübeck
Gotische Kirche aus rotem Backstein von 1334 mit hohem Uhrturm und einer Orgel aus dem 16. Jahrhundert.
St. Jakobi ist eine der fünf evangelisch-lutherischen Hauptpfarrkirchen
in der Lübecker Altstadt. Sie wurde im Jahre 1334 als Kirche der
Seefahrer und Fischer geweiht, die ihr „Schütting“ (von norwegisch
Skotting – heute Schøttstuene – für Versammlungshaus) noch heute in der
gegenüberliegenden Schiffergesellschaft haben. Ihr Patron ist der
Heilige Jakobus der Ältere.

ST.-JAKOBI-KIRCHE
1227 erstmals erwähnt. Die jetzige Stufenhallenkirche hervorgegangen
aus der Umgestaltung eines älteren, spätromanischen Hallenbaus des
mittleren 13. Jh; 1334 mit dem Chor vollendet, später durch
Kapellenanbauten erweitert. Dachreiter 1622/23 dem bis dahin
bestehenden gotischen nachgebildet. 1658 Erneuerung des Turmhelms durch
Ratsbaumeister Kaspar Walter. Inneres 1964/65 renoviert.

Der heute zu sehende Hochaltar wurde 1717 von Hieronymus Hassenberg
geschaffen. Er ist eine Stiftung des Bürgermeisters Hermann Rodde,
dessen Büste sich am Altar befindet.

Neben der Großen Orgel befand sich bereits in gotischer Zeit eine
zweite Orgel in der Kirche. 1467/1515 wurde an der Nordwand eine
einmanualige Schwalbennestorgel errichtet. Friederich Stellwagen führte
1636–1637 einen Erweiterungsumbau durch und ergänzte Rückpositiv,
Brustwerk und ein kleines Pedalwerk hinter dem Hauptwerkgehäuse. Er
baute die geteilte gotische Windlade in eine Schleiflade mit zwei
Pedaltransmissionen um.
Rückpositiv der Stellwagen-Orgel

Erste Nachrichten über Orgelmusik in Lübeck datieren aus dem 14.
Jahrhundert. Die ältesten Bestandteile der heutigen Großen Orgel in St.
Jakobi stammen aus der gotischen Blockwerk-Orgel von 1465/66. Erhalten
ist auch der gotische Prospekt von 1504. Er bildet das heutige
Hauptwerk und wird mit Peter Lasur in Verbindung gebracht. Hans Köster
fügte 1573 ein reich verziertes Rückpositiv im Stil der Renaissance
hinzu. Genau 100 Jahre später führte Jochim Richborn einen
Erweiterungsumbau durch und ergänzte die Orgel um ein Brustwerk und
zwei barocke Pedaltürme (1673). Die Orgel verfügte nun über 51 Register
und war Richborns größtes Werk. Im Laufe der Jahrhunderte erfolgten
verschiedene Anpassungen und klangliche Veränderungen. So platzierte
Christoph Julius Bünting in den Jahren 1739 bis 1741 das Brustwerk als
Oberwerk hinter dem Hauptwerkgehäuse und erweiterte es um drei
Register. Im Pedal ergänzte er eine Posaune 32′.
Ins Auge fällt das Gehäuse, das mit reichem Schnitzwerk verziert ist.
Alle Prospektpfeifen sind mit goldfarbenen Gesichtern und Ornamenten um
die Labien herum bemalt. Im Rückpositiv sind einige Pfeifen zudem
ziseliert oder mit goldenen Masken versehen. In den Pedaltürmen füllen
Flammenornamente die Zwischenräume zwischen den Pfeifenfüßen aus.

In der Kirche befindet sich in der nördlichen Turmkapelle, der
inzwischen als „Pamirkapelle“ bezeichneten Nische eine Gedenkstätte für
die auf See gebliebenen Lübecker Seeleute. Hier steht auch das Wrack
eines Rettungsboots der 1957 gesunkenen Viermastbark Pamir, bei deren
Untergang 80 der 86 Besatzungsmitglieder ums Leben kamen. Die
Gedenkstätte wurde am 21. September 2007 nach dem Willen der
Kirchengemeinde, der Landes- und der Bundesregierung zur Nationalen
Gedenkstätte für die zivile Seefahrt erklärt.

Der Brömsenaltar wurde um 1490 bis 1500 von dem Bürgermeister Heinrich
Brömse gestiftet. Das Relief im Mittelteil wird seit einigen Jahren der
Werkstatt des westfälischen Bildhauers Evert van Roden zugeschrieben.
Das Kunstwerk zählt aufgrund seiner virtuosen Bildgestaltung zu den
wichtigsten Lübecks. Die Darstellung der Familie Brömse auf den
Altarflügeln entstand etwas später um 1515.

Das im Jahr 1286 vollendete Heiligen-Geist-Hospital
am Koberg in Lübeck ist eine der ältesten bestehenden
Sozialeinrichtungen der Welt und eines der bedeutendsten Bauwerke der
Stadt. Es steht in der Tradition der Heilig-Geist-Spitäler nach dem
Vorbild von Santo Spirito in Sassia in Rom. Betreut wurden die Spitäler
von den Brüdern vom Orden des Heiligen Geistes.

HL. - GEIST - HOSPITAL
Eine der ältesten bürgerlichen Hospitalanlagen des Mittelalters, mit
Kirche, großer Hospitalhalle und verschiedenen Nebenbauten, bestehend
aus Quer- und Parallelflügel mit Kreuzgang um kleinen Innenhof.
Errichtet seit den 60er Jahren des 13. Jh., später mehrfach erweitert
und verändert.
Querhalle mit Lettner: An der Brüstung des Lettners befindet sich auf
23 Tafeln eine der umfangreichsten Darstellungen der Elisabeth-Legende.
Die Darstellung des unbekannten westfälischen Künstlers aus der ersten
Hälfte des 15. Jahrhunderts orientiert sich an der Überlieferung des
Dominikaners Dietrich von Apolda. Daher fehlt die später hinzugekommene
Legende des Rosenwunders in diesem Zyklus.

Raumbestimmend in der Kirchenhalle sind die beiden großformatigen
mittelalterlichen Wandgemälde an der Nordseite, die auf ca. 1320–1325
datiert werden. Das westliche Bogenfeld zeigt eine komplexe
typologische Szene: den salomonischen Thron. Über dem von zwölf Löwen
umgebenen Thron, auf dem König Salomo mit seiner Frau und seiner Mutter
sitzt, erhebt sich ein weiterer Thron mit Christus und seiner Mutter
Maria, umgeben von Engeln. Christus lässt seine gekrönte Mutter als
Königin des Himmels bzw. der Engel an seiner Herrschaft teilhaben und
übergibt ihr ein Lilienzepter.
Marienaltar an der Nordseite
des Kirchenraumes unterhalb des westlichen Schildbogenfeldes. Der
geschnitzte Flügelaltar stammt aus dem Ende des 15. Jahrhunderts. Im
Mittelteil ist Maria als Schutzmantelmadonna zu sehen, die von einem
Strahlenkranz umgeben ist. Im linken Seitenflügel wird die Wurzel Jesse
dargestellt, im rechten Flügel die Ausgießung des Heiligen Geistes.
Allerheiligenaltar an der
Nordseite des Kirchenraumes unterhalb des östlichen Schildbogenfeldes.
Dieter Altar ist ebenfalls ein geschnitzter Flügelaltar aus dem Ende
des 15. Jahrhunderts. Im Mittelschrein sind szenische Darstellungen zu
sehen. Auf den Seitenflügeln sind je vier Heiligenfiguren dargestellt.

Allerheiligenaltar, Flügelaltar, Lübeck, Ende des 15. Jahrhunderts
Mittelschrein: Der Mittelschrein zeigt vier voneinander unabhängige Szenen.
links oben: die Heilige Familie mit Maria, dem Christuskind und Anna
(der Mutter Marias), dahinter die Ehemänner Joseph und Joachim
rechts oben: die Anbetung des Kindes durch die Heiligen Drei Könige
links unten: elf weibliche Heilige, die als Ursula mit ihren Jungfrauen gedeutet werden
rechts unten: die zehntausend Märtyrer, die durch den Sturz in die Dornen sterben
Seitenflügel: Die geschnitzten Seitenflügel flankieren den Mittelschrein mit Darstellungen von Heiligen.
links oben: Apollonia und Johannes der Täufer
links unten: Margarete und Laurentius
rechts oben: Katharina von Siena und Stillentin (durch Inschrift auf dem Heiligenschein so bezeichnet)
rechts unten: Utlentin (= Valentin) und Cilliacus (= Cyriacus)
Rückseite (nicht zu sehen): Die Malerei auf den geschlossenen Flügeln stellt weitere acht Heiligengestalten dar.
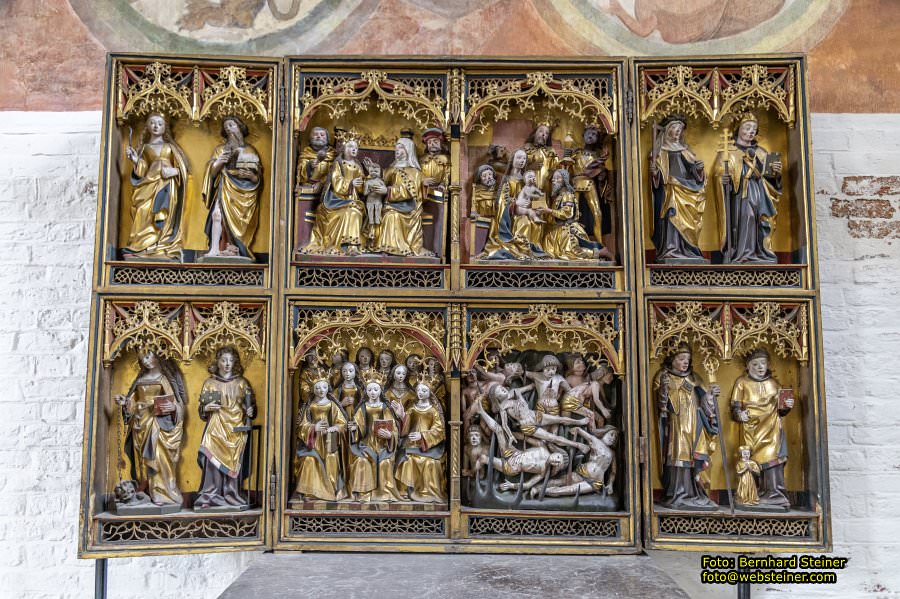
Marienaltar (Altar der Schutzmantelmadonna) Flügelaltar, Lübeck, Ende des 15. Jahrhunderts
Mittelschrein: Der geschnitzte
Mittelschrein ist Maria mit dem Kind und dem Rosen-kranz geweiht: Die
Gottesmutter ist als "Schutzmantelmadonna" dargestellt, unter ihrem
Mantel knien Kleriker und Laien, denen Maria eine Rosenkranzschnur
reicht. Auch das Kind hält einen Rosenkranz in der Hand. Maria ist
umgeben von einem Strahlenkranz, dessen Enden mit Rosenblüten und
Medaillons mit den Kreuzeswunden Christi geschmückt sind ebenfalls ein
Hinweis auf den Rosenkranz. Engel umschwärmen und krönen Maria, die
über dem Halbmond steht; sein großes grimmiges Männergesicht ist an der
Unterseite des Mond-streifens erkennbar. In dem kleinen Streifen
unterhalb der Gottesmutter ist - winzig - die Geburt Christi
dargestellt: Engel wiegen das Kind in Tüchern, Maria und Joseph knien
anbetend daneben, die Hirten nähern sich von links und rechts, am Rand
liegt der Ochse; der Esel hingegen fehlt.
Seitenflügel: Der linke
geschnitzte Seitenflügel stellt die Wurzel Jesse dar. Auf dem Thron
ruht der Stammvater Jesse; aus seiner Brust wächst der Stammbaum Jesu
empor. Er wird durch Maria mit dem Christuskind bekrönt. In der Mitte
des Baumes ist König David mit der Harfe erkennbar. Die seitlich neben
dem Thron stehenden Propheten sagen die Ankunft des Messias voraus. Der
rechte geschnitzte Seitenflügel zeigt das Pfingstwunder mit der
Ausgießung des Hl. Geistes. Gottvater und -sohn senden die Taube des
Hl. Geistes auf die Apostel herab; in ihrer Mitte sitzt Maria.
Rückseite (nicht zu sehen): Über die gemalten Außenflügel erstreckt sich ebenfalls das Pfingstwunder.

Das Heiligen-Geist-Hospital ist noch heute eine Stiftung. Sie wird als
Stiftung des öffentlichen Rechts von der Hansestadt Lübeck verwaltet.
Die laufende Unterhaltung der Gesamtanlage ist wie schon in der
Vergangenheit gesichert durch Einkünfte verschiedenster Art.
Pachteinnahmen aus den Ländereien vor den Toren Lübecks (Stiftsgüter
Behlendorf, Albsfelde und Krumbeck) und Erbbauzinsen aus zahlreichen
stiftungseigenen Grundstücken zählen ebenso dazu wie Einnahmen aus der
Vermietung von Wohnungen und gewerblich genutzten Gebäudeflächen.

Während der Reformationszeit wurde das Hospital in ein „weltliches“
Altenheim umgewandelt, das bis heute erhalten blieb. Ursprünglich
standen die Betten der Hospitalbewohner in der Halle. Im 18.
Jahrhundert dienten der erste und zweite Stock als Hospital. 1820
wurden vier Quadratmeter große, hölzerne Kammern gebaut, getrennt nach
Geschlechtern. Die Abteilungen sind nach oben offen. Es gibt zwei
Längsgänge zwischen den Reihen der aneinander gebauten Kammern. Es gab
zusätzlich eine kleine Bücherei und Apotheke. An den Türen der Kammern
kann man noch heute Namen und Nummern der damaligen Bewohner sehen. Bis
1970 waren die Kammern bewohnt.

Landesamt für soziale Dienste Schleswig-Holstein Dienstsitz Lübeck

ZÖLLNERHAUS
Erbaut 1571. Terrakottafriese mit lübischen und mecklenburgischen
Wappen aus der Werkstatt des Statius van Düren. 1912-1928 Wohnhaus der
Schriftstellerin Ida Boy-Ed.
Burgtor in Lübeck - Zur
Blütezeit Lübecks als Hauptstadt der Hanse erbauter Turm mit Kuppel und
Blick auf die Altstadt. Das im spätgotischen Stil erbaute Burgtor in
Lübeck ist das nördliche von ehemals vier Stadttoren der Lübecker
Stadtbefestigung und neben dem Holstentor das einzige, das noch heute
erhalten ist. Es hat seinen Namen nach der alten, hoch über der Trave
gelegenen Lübecker Burg, die 1227 zum Burgkloster umgebaut wurde. Durch
das Tor führt die Große Burgstraße zum Stadtzentrum.
Anfang des 13. Jahrhunderts werden ausgedehnte Befestigungsanlagen um
die Stadt Lübeck errichtet. Anstelle der um 1227 zum Kloster umgebauten
Burg schützen fortan eine Stadtmauer und vier Tore das gesamte
Stadtge-biet. Das Burgtor sichert den Zugang zur Halbinsel im Norden.
1444 wird das Tor in der Form umgebaut, in der es noch heute erhalten
ist.

Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Ostsee, An der Untertrave / Kanalstraße

Gaffelschooner „Samsara"
Samsara ist ein Maine-Schooner aus der Traditionswerft Bültjer,
Ostfriesland. Gebaut Eiche auf Eiche wurde das Schiff 1989 komplett mit
neuen Spanten und Planken ausgestattet. Der Schiffsdiesel aus dem Jahr
1956 hat 4 Zylnder und leistet 138 PS bei 600 U/min. Die beiden
Gaffelsegel und die 3 Vorsegel lassen zügige Reisen zu. Die Samsara
dient dem traditionellen Segeln und damit den Freunden des
Gaffelsegels.
Typ: Maine Schooner
Verdrängung: 52 t
Länge ü.A: 22,25 m
Segelfläche: 230m²
Breite ü.A: 4,60 m
Wert: Bültjer, Ditzum
Tiefgang: 2,50 m
Rufzeichen: DDRY
Takelung: 2-Mast Gaffelschooner mit Topsegel

Holstentor Feldseite / Westseite

Holstentor Stadtseite / Ostseite

Marktplatz Lübeck mit Historisches Rathaus von Lübeck und Ev.-Luth. Kirchengemeinde St. Marien zu Lübeck

Herr Ribbeck von Ribbeck auf Ribbeck aus original NIEDEREGGER Marzipan.
Eine Konditorin aus dem Hause NIEDEREGGER verwirklichte diese „süße
Szene" in 61,5 Stunden Handarbeit.

Burgtor in Lübeck

Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Ostsee, An der Untertrave / Kanalstraße

Museumshafen Lübeck - Hafen mit mehr als 20 historischen Schiffen,
darunter eine Karavelle des 15. Jh. und ein Schlepper von 1910.

Marktplatz Lübeck mit Historisches Rathaus von Lübeck und Ev.-Luth. Kirchengemeinde St. Marien zu Lübeck

Bevor man das Zunfthaus der Schiffergesellschaft durch die Rokokotür
betritt, kann man auf den beiden bemalten Außenstelen lesen: „Allen zu
gefallen, ist unmöglich!“ Das Haus der Schiffergesellschaft gegenüber
der Jakobikirche in Lübeck wurde 1535 als Zunfthaus gekauft und bis
1538 umgebaut und ist bis heute so erhalten. Das Gebäude der Schiffergesellschaft zu Lübeck in der Breiten Straße 2 wurde im Frührenaissancestil gebaut.
Schiffergesellschaft am Koberg mit Blick in die Engelsgrube

Die Schiffergesellschaft zu Lübeck bezeichnet einen seit der Frühen
Neuzeit existierenden Kapitäns- (Schiffer-) verband und ein Sozialwerk
sowie gleichzeitig ein historisches Gebäude, das heute eine Gaststätte
beherbergt. Die Schiffergesellschaft zu Lübeck wurde am 26. Dezember
1401 als St.-Nikolaus-Bruderschaft gegründet. Sinn und Zweck dieser
Vereinigung ist folgenden Worten aus der Gründungsurkunde zu entnehmen:
„Zu Hilfe und Trost der Lebenden und Toten und aller, die ihren
ehrlichen Unterhalt in der Schifffahrt suchen.“ Da sich im Zuge der
Reformation fast alle religiösen Bruderschaften auflösten, vereinigte
sich die St-Nikolaus-Bruderschaft mit der St.-Annen-Bruderschaft. Man
nannte sich die Schippern Selschup und erwarb 1535 für 940 Lübische
Mark ein im 13. Jahrhundert erbautes Haus an der Ecke Breite
Straße/Engelsgrube gegenüber von der Lübecker Jakobikirche.
Vor dem Eingang hat man einen Blick auf den vorgebauten sogenannten
Gotteskeller, eine goldene Wetterfahne mit einem Segelschiff als Motiv
auf dem Giebel und ein Gemälde mit dem Adler von Lübeck.

Europäisches Hansemuseum - Interaktives Museum zur Geschichte der Hanse mit Aufführungen und Ausstellungen.
Seit dem 12. Jahrhundert spannen Kaufleute aus dem niederdeutschen
Sprachgebiet über politische Grenzen hinweg ein weitreichendes
Handelsnetz. Im Ostseeraum dominieren sie im Mittelalter die Märkte, im
Westen erstreckt sich ihr Handelsgebiet bis England und an die
französische Atlantikküste, im Süden sind sie in den Küstenstädten
Spaniens, Portugals und Italiens präsent. An ihren wichtigsten
Handelsplätzen im Ausland gründen die Kaufleute Niederlassungen, die
seit dem 16. Jahrhundert als Kontore bezeichnet werden. Die vier
größten Kontore entstehen in Nowgorod, Brügge, London und Bergen.
Zeitweise zählen Kaufleute aus rund 200 Städten zu dem Verbund, der
sich selbst erstmals im 14. Jahrhundert als Hanse bezeichnet. Der
Begriff Hanse leitet sich von dem althochdeutschen Wort für Schar ab
und wird bereits seit dem 12. Jahrhundert für Gemeinschaften von
Fernhändlern verwendet. Neben dem gegenseitigen Vertrauen und einer
gleichen Rechtskultur verbindet die niederdeutschen Kaufleute vor allem
ihre gemeinsame Sprache. Führende Schriftsprache des Fernhandels ist in
den Regionen an der südlichen Nord- und Ostseeküste bis Ende des 16.
Jahrhunderts Mittelniederdeutsch.

Zur Reise nach Nowgorod starten die niederdeutschen Kaufleute in Visby
auf Gotland. Sie schließen sich Gotländern an, die schon länger in
Russ-land handeln und die Seewege über die Ostsee gut kennen.
Zweimal im Jahr kommen die niederdeutschen Kaufleute in das russische
Handelszentrum. Die sogenannten Winterfahrer erreichen die Mündung der
Newa im Herbst, noch bevor die Flüsse und Seen vereisen, und bleiben
etwa sechs Monate. Wenn sie die Stadt im Frühjahr wieder verlassen,
sind die Sommerfahrer bereits auf dem Weg. Sie bleiben dann wiederum
bis zum Herbst in Nowgorod.
Die Kogge ist nach ihrem Fundort in der Nähe von Kollerup an der
Nordwestküste Jütlands in Dänemark benannt. Sie ist zu Beginn des 13.
Jahrhunderts auf eine Sandbank gelaufen und wurde 1978 entdeckt. Eine
wissenschaftliche Analyse des Schiffbaumaterials hat ergeben, dass das
Holz vermutlich um 1150 bei Schleswig geschlagen wurde. Das Wrack ist
das früheste Exemplar einer Kogge mit Heck- oder Stevenruder - eine
technische Neuerung, mit der sich das Schiff deutlich besser
manövrieren lässt als mit dem bis dahin verwendeten Seitenruder.
Gibt es den Schiffstyp Kogge überhaupt?
Diese Frage diskutieren Seefahrthistoriker und Schiffsarchäologen
aktuell. Ergebnisse aus der jüngeren Forschung zeigen, dass die Kogge
europaweit genutzt wurde. Der Begriff Hansekogge wurde erst zu Beginn
des 20. Jahrhunderts von deutschnational geprägten Forschern
eingeführt. Sprach- und Namensforscher haben Spuren des Begriffs Kogge
bis in das Jahr 862 zurückverfolgt. Allerdings bezeichnete Kogge damals
vermutlich keinen bestimmten Schiffstyp, sondern ganz allgemein ein
Schiff mit großer Tragfähigkeit. Die Bestimmung von Schiffstypen ist
für die Zeit des Mittelalters generell schwierig, denn jede
Schiffbautradition war Veränderungen unterworfen. Häufig wurden neue
Techniken und Konstruktionen übernommen, ohne dass sie die älteren
Bauweisen vollständig verdrängten oder ablösten.
Modell der Kollerup-Kogge im Maßstab 1:20

Im 12. Jahrhundert schließen niederdeutsche und gotländische
Fernhändler sich zu Fahrtgemeinschaften zusammen. Gemeinsam segeln sie
über die Ostsee in den Nordwesten Russlands. Gotland ist zu dieser Zeit
die Drehscheibe des regen Ostseehandels. Auf der strategisch günstig
gelegenen Insel treffen sich u. a. russische, schwedische, dänische und
zunehmend deutsche Kaufleute. Die Herkunft der Münzen im gotländischen
Schatzfund zeigt, dass sich Händler aus allen Teilen Europas für die
Waren interessieren, die auf der Insel umgeschlagen werden. Die
Gotländer dominieren zudem den lukrativen Handel mit Pelzen und Wachs
aus Russland. Die niederdeutschen Kaufleute nutzen die bereits
bestehenden Handelsverbindungen der Gotländer und schließen sich ihnen
an. Zwar gibt es bereits seit Langem Gemeinschaften von Kaufleuten, die
aus der gleichen Stadt oder dem gleichen Herrschaftsgebiet kommen. Ein
Zusammenschluss, bei dem die Herkunft der Bündnispartner eine
untergeordnete Rolle spielt, ist hingegen sehr ungewöhnlich. Er gilt
heute als wegweisend für die Entwicklung der späteren Hanse. Im
Herrschaftsgebiet von Nowgorod angekommen bilden die
Fahrtgemeinschaften für die Weiterreise einen neuen Verband. Sie wählen
einen gemeinsamen Ältermann, der die Gruppe anführt und ihre Interessen
bei Konflikten und Verhandlungen mit den örtlichen Herrschern vertritt.
Mit dem St. Peterhof in Nowgorod gründen niederdeutsche Kaufleute aus
verschiedenen Städten ihre erste gemeinsame Niederlassung. Weitere
große Handelsstützpunkte entstehen in London, Brügge und Bergen.
Gemeinsam ist diesen Städten, dass sie über ein weites Hinterland
verfügen, aus dem viele Handelsgüter in die Stadt gelangen. Sie bieten
den Fernhändlern ein gutes Einkaufs- und Absatzgebiet für ihre Waren.
Auch sind die örtlichen Herrscher hier bereit, den Kaufleuten
weitreichende Handelsprivilegien einzuräumen. Seit dem 16. Jahrhundert
werden die Niederlassungen als Kontore bezeichnet, kleinere Stützpunkte
entstehen beispielsweise in Lynn und Boston in England, in Bourgneuf
und La Rochelle in Frankreich oder in Pleskau und Kaunas in Russland
und Litauen.
In den Kontoren wachen gewählte Älterleute darüber, dass die
Privilegien weder von den Kaufleuten selbst noch von ihren
Handelspartnern verletzt werden. Zudem steht die Kontorsgemeinschaft
einzelnen Fernhändlern in Notlagen bei und gewährleistet die geistliche
Versorgung ihrer Mitglieder. Die vier großen Kontore verfügen alle über
einen gewählten Vorsteher, ein eigenes Siegel, eine eigene Satzung,
eine eigene Gerichtsbarkeit für interne Streitfälle und eine gemeinsame
Kasse. Die Rechtslage innerhalb der Gaststädte ist allerdings
unterschiedlich. Das Areal des St. Peterhofs ist aus der
Gerichtsbarkeit der Stadt Nowgorod herausgelöst.
Niederdeutsche und gotländische Kaufleute schließen gemeinsam Verträge
mit den örtlichen Herrschern. So sichern sie ihre Geschäfte rechtlich
ab, verschaffen sich wirtschaftliche Vorteile und erhalten Schutz auf
den Verkehrswegen. Ein erster Handelsvertrag mit dem Fürsten von
Nowgorod ist aus dem Jahr 1191/1192 überliefert. Ihm folgen zahlreiche
weitere Urkunden, in denen den organisierten Kaufleuten immer wieder
Sonderrechte verbrieft werden. Sie erhalten rechtliche Sicherheit,
beispielsweise vor willkürlichen Verhaftungen oder überteuerten
Gebühren. Dadurch können sie die Risiken für ihre Geschäfte, die sie
auf fremdem Territorium tätigen, deutlich verringern und sich
wirtschaftliche Vorteile gegenüber anderen Kaufleuten verschaffen. Nur
dort, wo die örtlichen Herrscher bereit sind, den fremden Händlern
Sonderrechte einzuräumen, beginnen sie eigene Niederlassungen zu
errichten. In Nowgorod beziehen die niederdeutschen Kaufleute
vermutlich 1193 ihren eigenen Hof. Zuvor sind sie auf dem Hof der
Gotländer zu Gast. Im Laufe des 13. Jahrhunderts geraten die
niederdeutschen Händler zunehmend mit den gotländischen Kaufleuten in
Konkurrenz um die Vorherrschaft in Nowgorod. Vermutlich Anfang des 14.
Jahrhunderts verdrängen sie ihre einstigen Verbündeten aus der Stadt
und übernehmen auch ihren Hof.
Auf dem Markt in Nowgorod gelten die örtlichen Maß- und
Gewichtseinheiten. Niederdeutsche Händler müssen ihre Waren daher stets
umrechnen und kämpfen für die Einführung eigener Gewichte. In Nowgorod
treten die Kaufleute vor allem als Großhändler auf. Die Handelswaren
werden zu dieser Zeit nicht mit Münzen bezahlt, sondern gegen andere
Güter getauscht. Die unterschiedlichen Maß-, Gewichts- und
Werteinheiten machen den Tausch zu einer komplizierten Rechenaufgabe.
Mit dem Handelsvertrag von 1191/1192 werden deutsche Gewichte
eingeführt. Die Niederdeutschen können den Handel jetzt besser
kontrollieren. Die eigenen Einheiten nutzen sie vermutlich auch, um
zusätzlichen Gewinn zu erwirtschaften. Die Kaufleute müssen sich selbst
Grundkenntnisse des Russischen aneignen. Dolmetscher sind rar und
kommen vor allem bei politisch-diplomatischen Verhandlungen zum
Einsatz. Übersetzen sie dabei fehlerhaft, müssen sie mit hohen Strafen
rechnen. Bei ihren Handelsgeschäften verständigen sich die Kaufleute
bald auch mithilfe von Sprachbüchern. Um unabhängiger agieren zu
können, lassen die Fernhändler ihre Kinder in den ausländischen
Niederlassungen oder an den Höfen der Bojaren, des Nowgoroder
Stadtadels, ausbilden. Als Sprachschüler verbringen sie vermutlich
einige Monate im Land. Andere Händler versuchen die Niederdeutschen vom
Erlernen der russischen Sprache auszuschließen. Durch ihren
Wissensvorsprung verschaffen sie sich Vorteile gegenüber der Konkurrenz.

Anfang des 13. Jahrhunderts hat sich in Lübeck durch den lukrativen
Fernhandel eine wohlhabende Oberschicht entwickelt. Zudem profitiert
die Stadt als Durchgangshafen für die Kreuzfahrer von der gewaltsamen
Missionierung im Ostseeraum. Teile einer Reiter- und Militärausrüstung,
die bei der archäologischen Grabung während der Bauarbeiten für das
Europäische Hansemuseum gefunden wurden, belegen die Anwesenheit von
Rittern. 1226 verbrieft Papst Honorius III. in einer Urkunde den
besonderen Status der Stadt Lübeck als Ausgangshafen für die Kreuzzüge
in den Ostseeraum. Weitere Objekte, die bei früheren Grabungen in
Lübeck gefunden wurden, erzählen vom Leben in der Stadt. Anfang des 13.
Jahrhunderts wird das einst sumpfige Gelände an der Großen Petersgrube
trocken gelegt und abwechselnd mit Erdschichten und Abfällen
aufgefüllt. Die in den Füllschichten entdeckten Fundstücke stammen
ursprünglich also aus unterschiedlichen Stadtbereichen. Ein
Adlermedaillon zeugt von der adelsähnlichen Kultur der Kaufleute. Das
Fragment einer Gürtelschnalle sowie ein Bernsteinrohling weisen
ebenfalls darauf hin, dass die Oberschicht in Lübeck zu dieser Zeit
einen gehobenen Lebensstil pflegt.
Städte werden im Heiligen Römischen Reich meist von Landesherren
gegründet. Sie sorgen für eine Infrastruktur, bieten Schutz und werben
mit Sonderrechten um neue Bewohner. Im Gegenzug entrichten die Bürger
Steuern und sind ihrem Stadtherrn rechtlich unterstellt. Lübeck
untersteht Anfang des 13. Jahrhunderts dem dänischen König Waldemar II.
Unter seiner Herrschaft bauen die Kaufleute ihr Handelsgebiet im
Ostseeraum aus. Als der Dänenkönig in Gefangenschaft gerät, nutzen die
Lübecker das entstandene Machtvakuum, um sich von ihrem Stadtherrn zu
befreien. 1226 wird Lübeck durch Kaiser Friedrich II. zur Reichsstadt
(civitas imperii) erhoben. Damit hat die Stadt ihre Steuern nun direkt
an den Kaiser abzuführen. Reichsstädte sind dem Reich unmittelbar
zugehörig und niemand anderem untertan. Sie genießen eine Reihe von
Freiheiten und Privilegien: Die Städte sind im Inneren weitgehend
autonom und besitzen eine eigene Gerichtsbarkeit. Meist dürfen sie
nicht nur über geringfügige Delikte, sondern auch über schwere Vergehen
befinden, die mit Verstümmelungen oder dem Tod bestraft werden. Verfügt
eine Stadt über diese sogenannte Hoch-oder Blutgerichtsbarkeit, ist sie
politisch selbstständig. Das schützt sie insbesondere vor der
Einflussnahme benachbarter Fürsten auf ihre Stadtpolitik und ihre
Handelsinteressen.
Im 13. Jahrhundert steigen die Fernhändler in die politische
Führungsriege ihrer Heimatstädte auf. Als Ratsmitglieder können sie die
politischen, wirtschaftlichen und militärischen Ressourcen der Stadt
für die Interessen ihrer Gruppe einsetzen. Vor allem in Seestädten wie
Lübeck bilden Kaufleute die Mehrheit im Rat. In Lübeck ist ein Rat
erstmals aus dem Jahr 1201 überliefert. Ihm gehören zumeist 24
Ratsherren (consules) an. Als Kollegium gleichberechtigter Mitglieder
repräsentiert der Rat die Stadt als weitgehend autonome
Rechtspersönlichkeit. Er setzt sich in der Regel aus den wirtschaftlich
und politisch einflussreichsten Bürgern der Stadt zusammen. Das sind
vor allem die Fernhändler. Sie bilden zu dieser Zeit jedoch keine
einheitliche soziale Gruppe: Nicht nur Kaufleute, auch Angehörige des
Niederadels zählen dazu. So wundert es nicht, dass die bürgerliche
Führungsgruppe der Stadt den gleichen Lebensstil pflegt, wie ihre
adligen Verwandten auf dem Land.
In der entstehenden Marktökonomie gelangen auch Handwerker zu
Wohlstand, sie bleiben jedoch in den meisten Städten politisch
machtlos. In einigen Städten gelingt es den Handwerkern sich seit der
zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts ein politisches Mitspracherecht zu
erkämpfen. In Lübeck fälschen die Ratsherren eine Ratswahlordnung,
sodass Handwerker und andere soziale Gruppen über Jahrhunderte von der
Wahl in den Rat ausgeschlossen bleiben.
1181 wird Kaiser Friedrich I. Barbarossa Stadtherr von Lübeck und
bestätigt den Lübeckern mündlich die ihnen von Heinrich dem Löwen
erteilten Stadtprivilegien. In einer Urkunde aus dem Jahr 1188 werden
diese Rechte schriftlich fixiert:
„Da also Unsere Getreuen, Graf Adolf
von Schauenburg und Graf Bernhard von Ratzebury, Klage führen gegen
Unsere Bürger von Lübeck über die Grenzen und die Nutzung ihres
Gebiets, haben Wir die vor Uns stehenden Parteien aufmerk-sam angehört
und, nach Einblick in den Sachverhalt bei dem Streit, um das Gut des
Friedens unter ihnen zu bewahren, genannte Grafen dazu veranlaßt, daß
beide aus Ehrfurcht vor der Wahrheit und durch eine rechtsgültige
Übereinkunft auf das Recht, das sie suchten, in Unsere Hand
verzichteten und Wir es mit ihrer Zustimmung den Einwohnern dieser
Stadt verliehen zu Besitz ohne irgendwelche spätere Anfechtung."
Das Original der Urkunde ist nicht mehr erhalten. Wahrscheinlich wird
sie 1225 neu verfasst und anschließend vernichtet. Der alte Text wird
dabei zwar größtenteils wieder verwendet, aber auch durch neue Teile
ergänzt. So entsteht eine Fassung, die alle für die Selbstbehauptung
der Stadt notwendigen Rechte enthält: die neue Urkunde bescheinigt den
Lübeckern die Nutzungsrechte von Wegen, Wald und Wiesen, sie enthält
Artikel zur Förderung des Handels und regelt die Rechte und Freiheiten
der Lübecker Bürger und Einwohner.
Barbarossa-Privileg (1188), Faksimile, Original im Archiv der Hansestadt Lübeck
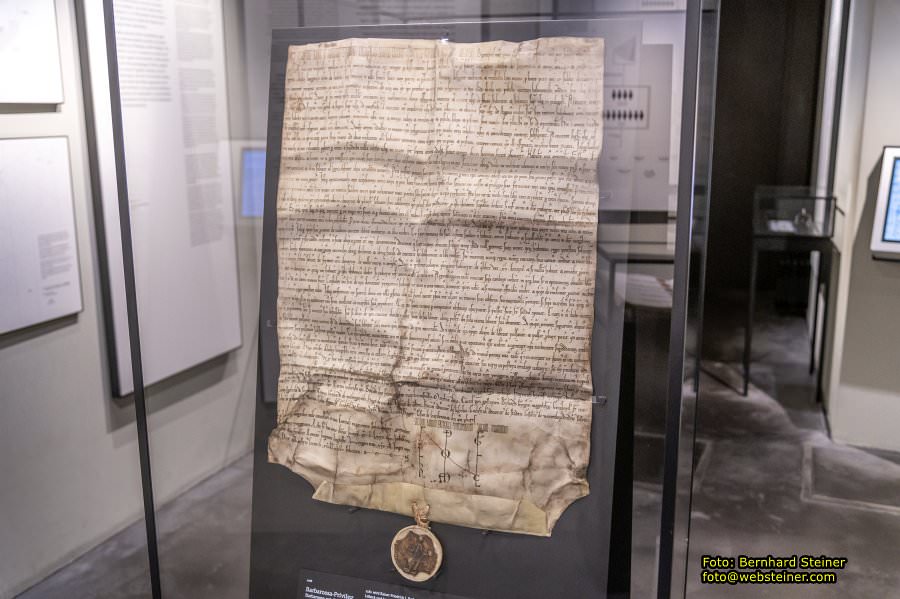
Krisen in Europa verschlechtern die Lage am Handelsplatz Brügge. Die
niederdeutschen Kaufleute setzen ihre wirtschaftlichen Interessen Mitte
des 14. Jahrhunderts mit einem umfassenden Handelsboykott durch. Als
einzige der Städte in Flandern, in denen Tuche produziert werden,
verfügt Brügge über eine direkte Verbindung zur Nordsee. So entwickelt
sich die ohnehin stark urbanisierte Region zur Drehscheibe des
internationalen Handels. Die Kaufleute kommen vor allem wegen der
Stoffe in die Stadt und bringen Waren aus allen Teilen der damals
bekannten Welt mit, die von hier aus wieder exportiert werden. Die
niederdeutschen Kaufleute führen neben Luxusgütern wie Pelzen und Wachs
auch wichtige Zulieferprodukte für die einheimische Tuchproduktion
sowie Getreide, Hering und Stockfisch ein. Zudem zählen sie zu den
Hauptexporteuren teurer Stoffe aus der Region. Als die Stadt Brügge von
ihnen höhere Abgaben fordert und ihre Handelsrechte einschränkt,
stellen die niederdeutschen Kaufleute von 1358 bis 1360 ihre gesamte
Ein- und Ausfuhr nach und aus Flandern ein. Die Tuchproduktion bricht
ein. Arbeitslosigkeit und Hunger sind die Folgen. Eine Missernte in der
Region sowie ein Ausbruch der Pest verschärfen die Auswirkungen der
ausbleibenden Getreideimporte.

Im Januar 1358 beschließen Ratsherren niederdeutscher Städte einen
gemeinsamen Handelsboykott der gesamten Grafschaft Flandern. Ihr Ziel
ist es, die Wirtschaft der stark urbanisierten Region zu schwächen und
durch ausbleibende Getreidelieferungen Unruhen in der Bevölkerung
auszulösen. Mit dem Embargo wollen sie bessere Handels-und
Aufenthaltskonditionen für die niederdeutschen Kaufleute in Brügge
erzwingen. Das Ausmaß der Handelssperre gefährdet allerdings auch die
wirtschaftliche Existenz einzelner Händler. Daher drohen die Ratsherren
in ihrem Aufruf zum Handelsboykott
allen Blockadebrechern mit dem Ausschluss aus der Gemeinschaft, die
sich nun erstmals selbst als Deutsche Hanse bezeichnet. Der Name Hanse
wird zum Kampfnamen. Er soll eine gemeinsame Identität stiften und zu
geschlossenem Auftreten verpflichten. Bereits im Juni 1358 reisen
Gesandte der Grafschaft und der Städte Flanderns nach Lübeck. Ihr
Versuch einzulenken bleibt jedoch ergebnislos. Im März 1360 weitet die
Hanse ihren Einfuhrstopp für Getreide sogar bis an den Rhein aus. Die
Situation zwingt die Flamen schließlich, den niederdeutschen Kaufleuten
ihre früheren Privilegien zu bestätigen und ihnen darüber hinaus mehr
Sonderrechte zuzugestehen als allen anderen Fernhändlern in Flandern.
Im Mittelalter sind Handelsunternehmen entweder hie-rarchisch oder
partnerschaftlich organisiert. Die Kaufleute der Hanse schließen sich
zu partnerschaftlichen Gesellschaften zusammen. Mit verschiedenen
Partnern knüpfen sie ein meist weitreichendes Netzwerk. An einer
Handelsgesellschaft sind in der Regel nur zwei Kaufleute beteiligt, die
rechtlich voneinander unabhängig bleiben. Nicht immer schließen
Handelspartner einen Vertrag ab. Besonders häufig sind
Familiengesellschaften überliefert. Durch gezielte Eheschließungen
verdichtet sich das Netzwerk. Hildebrand Veckinchusen tätigt zu Beginn
des 15. Jahrhunderts beispielsweise Handelsgeschäfte mit seinen
Brüdern, seinem Schwiegervater, seinen Neffen sowie mit Freunden in
London, Lübeck, Danzig, Riga, Reval und Dorpat. Über sein Netzwerk
erhält Veckinchusen wertvolle Informationen, beispielsweise über die
Warenpreise in Bordeaux. Im Vergleich zu den hierarchisch aufgebauten
Handelsunternehmen der oberdeutschen und italienischen Kaufleute kann
der gut vernetzte Hansekaufmann vor allem seine Such- und
Informationskosten senken. Gut informiert kann schnell und flexibel auf
veränderte Marktlagen reagiert werden. Ein Kaufmann in Reval kann so
beispielsweise ein Gebiet im Blick behalten, das von Nowgorod und
Mitteleuropa bis nach Brügge, England und Spanien reicht.

Privilegien der Grafschaft Flandern sowie der Städte Brügge, Gent und Ypern (1360/1361)
Faksimiles, Originale im Archiv der Hansestadt Lübeck
Nach langwierigen diplomatischen Verhandlungen, zu denen flandrische
Gesandte nach Lübeck reisen, gewähren der Graf von Flandern sowie die
Städte Brügge, Gent und Ypern den Kaufleuten der Hanse zahlreiche
Privilegien in ihrem Gebiet. Die Sonderrechte stärken die Stellung der
niederdeutschen Kaufleute in Flandern und Brügge und verschaffen den
Händlern direkte und indirekte Kostenvorteile. Das besondere an dieser
sogenannten doppelten Privilegierung ist, dass die Rechte der
hansischen Kaufleute, die ursprünglich (seit 1309) nur für Brügge
galten, nun auf Flandern ausgedehnt werden. Die beiden neben Brügge
mächtigsten Städte der Grafschaft, Gent und Ypern, stimmen den
Privilegien in einer zusätzlichen Urkunde gemeinsam mit Brügge zu. Die
Privilegien werden im Vergleich zu denen aus dem Jahr 1309 also nicht
nur inhaltlich erweitert, auch ihr Geltungsbereich dehnt sich enorm aus.
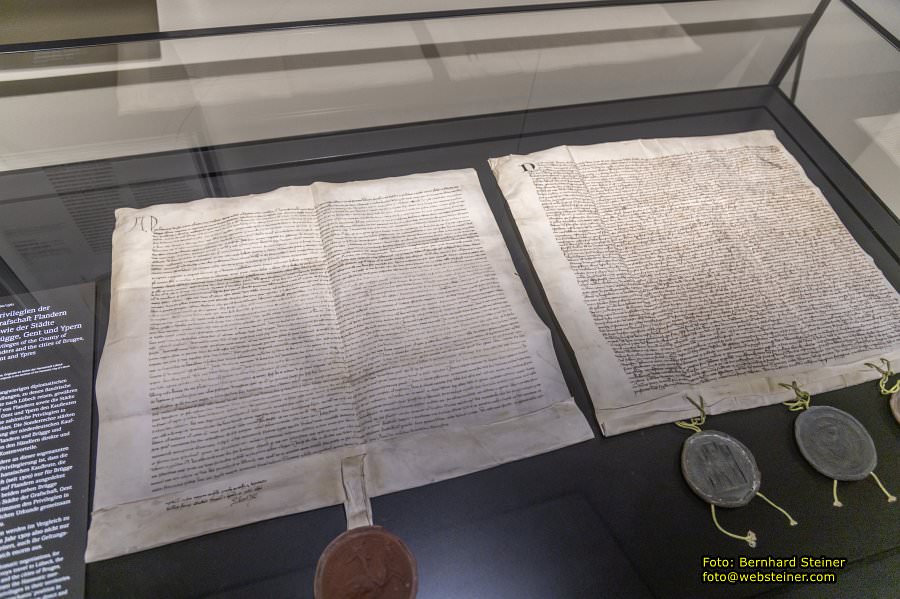
Die Pest sehen viele Menschen im Mittelalter als eine Strafe Gottes an,
die medizinischen Hintergründe sind unbekannt. Durch Spenden und
Stiftungen an geistliche oder wohltätige Einrichtungen versuchen sie
den Zorn Gottes zu besänftigen. In den Jahren, in denen die Seuche in
Europa wütet, steigt die Anzahl der Testamente erheblich. In Lübeck
wächst der Besitz der Kirche durch Spenden und Hinterlassenschaften
immens. Einige werfen „geldt, sulver unnd goldt aver de muren up den kerckhoff"
(Geld, Silber und Gold über die Mauern in den Kirchhof), wie es in der
Chronik des Reimer Kock heißt. Auch das Beichthaus des Burgklosters
entsteht zu dieser Zeit mit Hilfe der Stiftungsgelder. Viele versuchen
sich durch Pilgerfahrten und Bußübungen ihrer Sünden zu entledigen. Wer
die Pest überlebt, gelangt durch Erbschaften nicht selten zu größerem
Wohlstand als zuvor. Die Gesellschaft verändert sich, zahlreiche
Immobilien und Ländereien wechseln ihre Besitzer. Im späten 14.
Jahrhundert beginnt der soziale Aufstieg der Handwerker. Relativ
gesehen ist die Oberschicht stärker von der Seuche betroffen als andere
soziale Gruppen, auch wenn in absoluten Zahlen wesentlich mehr Menschen
aus der Unterschicht sterben. Schätzungsweise jeder Dritte erliegt in
Europa den Folgen der Krankheit.

Der Stalhof ist ein rund 4.000 m² großes Gelände am Ufer der Themse.
Bereits 1176 erhalten Kaufleute aus Köln vom englischen König Heinrich
II. hier ein Stück Land und das Recht, eine Niederlassung zu gründen -
ein Areal mitten in London, in dem die Kaufleute nach eigenen Gesetzen
leben. Die Große Halle ist das älteste und imposanteste Gebäude auf dem
Areal und dient mehrere Jahrhunderte als Stützpunkt der Hansekaufleute
in der Stadt. Erst 1475 geht auch der Rest des Geländes in ihren Besitz
über. Meist leben hier rund 30 Kaufleute, in Spitzenzeiten bis zu 90.
Jedes Jahr am Neujahrsabend wählen alle anwesenden Kaufleute den
Kontorvorstand. Er besteht aus einem Ältermann, zwei Beisitzern und
einem Rat aus neun Kaufleuten. Dem Vorstand zur Seite steht mindestens
ein Sekretär. Er verlässt London nur, wenn das Kontor ihn zu einem
Treffen der Hansestädte entsendet. Dort, auf den Hansetagen, vertritt
er die Interessen der Kaufleute des Stalhofs.
Die englischen Tuchhändler sind für die Hansekaufleute Handelspartner
und Konkurrenten zugleich. Durch ihre Privilegien haben die
Hansekaufleute in London Wettbewerbsvorteile. Diese werden den
englischen Kaufleuten in den Hansestädten allerdings verwehrt. Das
führt seit dem 15. Jahrhundert immer wieder zu Konflikten. Vor allem
die englische Kaufleutegilde der Merchant Adventurers fordert zunehmend
gleiche Rechte auch in London. Denn hier zahlen Hansekaufleute
beispielsweise seit 1327 auf die Ausfuhr von Tuchen sogar einen
geringeren Zollsatz als Einheimische: 12 Pence pro Laken. Will ein
Engländer hingegen Tuche exportieren, muss er beim Zöllner noch zwei
Pence dazulegen. Nach zahlreichen Konfrontationen bestätigt König
Eduard VI. der Hanse 1547 noch einmal alle Privilegien in einem
prachtvoll verzierten Dokument. Doch der Streit um die Handelsrechte
der Hansekaufleute und Engländer geht weiter. 1598 lässt Elisabeth I.
den Stalhof letztlich schließen. Das Gelände bleibt jedoch im Besitz
der Hanse und auch der Handel geht weiter - aber ohne Privilegien.
In diesem Privileg sind alle Sonderrechte aufgelistet, die
Hansekaufleute seit der carta mercatoria im Jahr 1303 in England
erhalten haben. König Eduard VI. erklärt darin, er wolle den Kaufleuten
„Ungestörtheit und völlige Sicherheit verschaffen" und sie in seinem
Königreich unter seinen „Schutz und Schirm" stellen. Mit ihren Waren
sollen sie „frei und ledig sein von Mauergeld, Brückenzoll und Wegzoll"
und dürfen Handel treiben, „wie man es zuvor zu tun pflegte". Das
gesamte Dokument umfasst acht große Pergamentblätter. Die prachtvolle
Ausführung mit aufwändigen Verzierungen ist Teil der politischen
Strategie des Königs und der Hanse. Die Hansekaufleute wollen damit
ihre Bedeutung für das englische Wirtschaftsleben unterstreichen.
Bereits fünf Jahre später aber widerruft der König diese Privilegien.
Privileg König Eduard VI. von England (*1537, † 1553), 1547
Faksimile, Sammlung Europäisches Hansemuseum, Original im Archiv der Hansestadt Lübeck
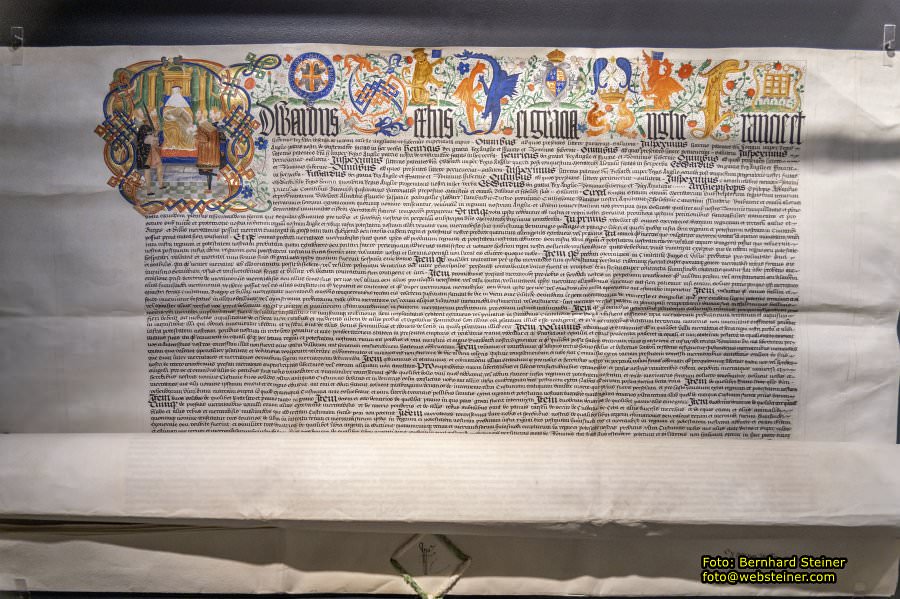
Auf dem Hansetag besprechen die Vertreter der Städte aktuelle Themen,
die den hansischen Handel betreffen. Verlauf und Ergebnis der Sitzungen
werden protokolliert. 1518 stehen insgesamt 41 Themen auf der
Tagesordnung. Die Sitzungen finden vom 19. Juni bis zum 14. Juli in
Lübeck statt. 21 Städte senden ihre Vertreter, die Ratsendeboten, zu
der Versammlung. Sie beraten über allgemeine Handelsangelegenheiten,
Probleme in den Auslandskontoren oder Konflikte zwischen einzelnen
Hansestädten. Die Tagesordnung muss bereits im Vorfeld im Rat einer
jeden Stadt besprochen werden. Erst danach sind die Ratsendeboten
befugt, im Rahmen der ihnen erteilten Richtlinien auf dem Hansetag
mitzuentscheiden. 1518 wird unter anderem diskutiert, wie mit dem
Machtzuwachs der Landesfürsten umzugehen ist. Die Autonomie vor allem
der kleineren Hansestädte ist davon zunehmend bedroht. Die
Ratsendeboten beschließen, dass Städte, die sehr eng an ihren
jeweiligen Landesfürsten gebunden sind, nicht mehr zu den Hansetagen
eingeladen werden. Ihre Beschlüsse müssen die Gesandten nach dem
Prinzip der Einigkeit fassen. Es gibt keine Mehrheitsentscheidung.
Wirtschaftlich sind die Teilnehmer zugleich oft erbitterte
Konkurrenten. In der Sitzordnung wird die Rangfolge der Städte
untereinander festgelegt, worüber es oft Streit gibt.

Auf dem Weg zurück in Richtung des Geschosses der Empfangshalle wird
eine Versammlung von Dominikaner-Mönchen gezeigt. Der zweite Teil der
Ausstellung zur europäischen Hanse befindet sich in den Räumen des
alten Burgklosters. Hier erhält man einen Einblick in das Bergener
Kontor und dessen wichtigstes Exportgut Stockfisch. Außerdem ist das
zwischen 1893 und 1896 entstandene Schöffengericht zu besichtigen.

Ein Tag im Dominikanerkloster
Ein Gebet bei Sonnenaufgang, die Matutin oder Vigil, läutet den Tag der
Mönche im Burgkloster ein. Die Brüder versammeln sich im Chor, dem
Bereich um den Hauptaltar. Dort verneigen sie sich vor dem Altar und
nehmen dann ihre Plätze auf beiden Seiten des Chorraums ein. Wie in
allen Mönchsorden ist ihr Tagesablauf durch Stundengebete, die Horen,
strukturiert. Im Zentrum ihres Klosterlebens stehen zudem das Studium
und die Predigt zu den Menschen. Zu den Mahlzeiten versammeln sich die
Mönche im Refektorium. Fleisch landet dabei nicht auf dem Teller, denn
die Speisevorschriften fordern von den Dominikanern Verzicht. Das gilt
allerdings nur innerhalb der Klostermauern. Unterwegs ist es den
Brüdern durchaus erlaubt „gekochte Speisen mit Fleisch zu essen, damit
sie niemandem zur Last fallen". Bei Tisch herrscht striktes Redeverbot
und auch sonst fallen im Kloster nur wenige Worte. Schweigen gilt den
Dominikanern als wichtige Übung und soll der Kontemplation, also der
inneren Einkehr, dienen. Nach dem gemeinsamen Abendessen und einem
letzten Nachtgebet, der Komplet, gehen die Ordensbrüder kurz nach
Sonnenuntergang im Schlaftrakt, dem Dormitorium, ins Bett.
Lebensgroße Vollplastiken von Dominikanermönchen des 14. Jahrhunderts
Rekonstruktion, Sammlung Europäisches Hansemuseum Lübeck

Zwischen 1893 und 1896 wird das Burgkloster in ein neu entstehendes
Gerichtsgebäude mit Untersuchungsgefängnis integriert. Das obere
Stockwerk des ehemaligen Konvents, in dem sich bis 1531 der Schlafsaal
der Dominikaner befand, wird abgerissen. Über dem Erdgeschoss entstehen
Gefängniszellen und Gerichtsräume. Das gesamte Gebäude erhält eine
einheitliche neugotische Außenverkleidung. Im Inneren des Erdgeschosses
bleibt die klosterzeitliche Architektur weitgehend erhalten. Ein
Fenster im Durchgang bietet Einblick in den restaurierten Kapitelsaal.
Ein Ausschnitt in der Außenwand legt zudem einen Teil der
mittelalterlichen Fassade frei.

Gefängniszellen
Zu Klosterzeiten befindet sich an dieser Stelle das Dormitorium der
Dominikaner. Ende des 19. Jahrhunderts wird das Burgkloster in ein neu
entstehendes Gerichtsgebäude mit Untersuchungsgefängnis integriert, das
Obergeschoss wird abgerissen und dem West- und Nordflügel werden
Zellentrakte mit insgesamt 34 Einzelzellen aufgesetzt. Das Burgkloster
ist in seiner Funktion als Gericht und Untersuchungsgefängnis auch ein
Erinnerungsort an die Zeit des Nationalsozialismus in Lübeck. Religiös
und politisch Verfolgte werden zwischen 1933 und 1945 hier inhaftiert.
Im Gerichtsgebäude finden Prozesse gegen Regimegegner statt. Unter
ihnen auch vier Geistliche, die später als Lübecker Märtyrer bezeichnet
werden, sowie 18 Gemeindemitglieder. Einer von ihnen, Stephan Pfürtner,
beschreibt rückblickend die Haftbedingungen in der etwa neun
Quadratmeter großen Zelle:
„Neben dem Eingang rechts war der Kübel befestigt, also der
Toilettenkasten, der von draußen aus geleert werden konnte. An der
rechten Längsseite standen Zellentisch und -schemel aus grobem, aber
gehobeltem Holz. Darüber hing ein kleiner Wandschrank. In ihm befanden
sich die Esskumme mit Gabel und Löffel, ein Salznapf und ein
Holzbrettchen. [...] Auf der linken Längsseite war eine Schlafpritsche
hochgeklappt, die nur zur Nacht heruntergelassen werden durfte. [...]
Ansonsten gab es nichts mehr in diesem Raum. [...] lediglich noch
einige Worte oder Kurzsätze an den Wänden, eingeritzt in die Farbe oder
den Putz. Meist waren es kleine Erinnerungszeichen, darunter freilich
auch erschütternde Hilferufe, von denen, die vor mir an diesem Ort mit
ihren Schicksalen gehadert hatten."

Biografien des Widerstands - Dr. Julius Leber
Ab 1933 werden zahlreiche Gegner der Nationalsozialisten hier in den
Zellen des Untersuchungsgefängnisses im Burgkloster interniert oder in
den Gerichtsräumlichkeiten verurteilt. Der bekannteste unter ihnen ist
der langjährige Reichstags- und Bürgerschaftsabgeordnete, Lübecker
SPD-Vorsitzende und Chefredakteur des sozialdemokratischen Lübecker
Volksboten (LV) Julius Leber (1891*-1945†). Der aus dem Elsass
stammende Politiker engagiert sich bereits als Jugendlicher in der SPD.
Nach Ende des Ersten Weltkriegs kommt er 1921 nach Lübeck und übernimmt
die Leitung des sozialdemokratischen Lübecker Volksboten. Schnell wird
er zu einer prägenden Persönlichkeit in der Lübecker Politik, ab 1924
als Reichstagsabgeordneter auch deutschlandweit. Als Verfasser scharfer
Artikel und talentierter Redner ist Leber ein prominenter Gegner der
Nationalsozialisten. Als solcher wird Leber bereits einen Tag nach der
Ernennung Hitlers zum Reichskanzler am 30. Januar 1933 im
Burgklostergefängnis interniert. Die größten Demonstrationen in Lübeck
seit dem Krieg können noch einmal Lebers Freilassung erreichen.
Im März 1933 wird er erneut verhaftet und als angeblicher „geistiger
Urheber" eines Totschlags an einem SA-Mann zu 20 Monaten Haft
verurteilt. Nach dieser Haftzeit wird er bis 1937 in den
Konzentrationslagern Esterwegen und Sachsenhausen festgehalten, danach
agiert Leber getarnt als Kohlenhändler von Berlin aus gegen das Regime.
Dabei bringt er den militärischen Widerstand um Claus Graf Schenk von
Stauffenberg mit Widerstandsgruppen aus der Arbeiterschicht in
Verbindung. Julius Leber wird 1944 verhaftet, vom Volksgerichtshof zum
Tode verurteilt und am 5. Januar 1945, wenige Monate vor Kriegsende, in
Berlin-Plötzensee hingerichtet. Wie Leber werden bereits 1933 auch
andere Lübecker Bürgerinnen und Bürger, die sich zuvor für die
Demokratie engagiert haben, in diesen Räumlichkeiten inhaftiert und
verurteilt. Auch die Mitglieder des Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold,
eines millionenstarken republikfreundlichen Veteranenverbands, in dem
auch Julius Leber Mitglied ist, sind nach dem Verbot dieser
Organisation im März 1933 Ziele der ersten nationalsozialistischen
Terrorwellen.
Schöffengerichtssaal
Mit den Reichsjustizgesetzen wird 1879 im Deutschen Kaiserreich eine
einheitliche Gerichtsordnung eingeführt. In Lübeck soll ein neues,
entsprechend repräsentatives und zugleich funktionales Gerichtsgebäude
entstehen. Der 1896 auf dem Gelände des Burgklosters fertiggestellte
Neubau soll das moderne Rechtswesen, den damaligen Standards
entsprechend, nach außen repräsentieren und laut Lübecker Baudeputation
«der Würde einer Gerichtsstätte angemessen» sein. Das Gebäude
beherbergt Amts-und Landgericht. Sie befinden sich hier im
Schöffengerichtssaal, in dem Anklagen geringen Strafmaßes verhandelt
werden. Über schwere Straftaten wird im Schwurgerichtssaal geurteilt.
Auch beim Schöffengericht sind Laien an der Rechtsprechung beteiligt.
Neben einem Berufsrichter urteilen zwei Schöffen über Schuld und
Strafe. Schöffengerichte sind heute Teil der Amtsgerichte. Der
Schöffengerichtssaal ist mit einer repräsentativen, zwei Meter hohen
Holzvertäfelung verkleidet; ein großes Oberlicht erhellt den Raum.
Richter, Staatsanwälte und Gerichtsschreiber sitzen auf einem Podium.
Hinter dem Richtertisch befindet sich der Zugang zu einem
Beratungszimmer. Der Publikumsbereich des Saals ist durch eine Schranke
abgetrennt.

Das Hospital entsteht in der
ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts und ist als einziges Gebäude des
Burgklosters bis heute in seiner ursprünglichen Höhe erhalten. Bereits
um 1400 wird es erstmals umgebaut: Das Hospital wird unterkellert und
das Erdgeschoss in eine zweischiffige Halle mit schmalem Gang
eingeteilt. Die ursprüngliche Bestimmung des Baus ist nicht bekannt,
später wird es als Hospiz genutzt. In der zweiten Hälfte des 15.
Jahrhunderts wohnen hier Pfründner, das sind oft wohlhabende Witwen,
die sich lebenslanges Wohnrecht und Verpflegung im Kloster erkaufen.
Während der Zeit des Armenhauses nach 1531 sind in das Hospital
zahlreiche Wohnungen eingebaut. 1893 wird das Gebäude entkernt und
erhält seine heutige Geschossaufteilung. Eine Besonderheit des
Hospitals ist seine Warmluftheizung, ein Hypokaustum, nicht zu
verwechseln mit der römischen Fußbodenheizung gleichen Namens. In der
Heizkammer unter dem Raum erhitzt ein Feuer große Findlingssteine.
Nachdem das Feuer gelöscht ist, werden Öffnungen im Boden des Raums
geöffnet. Dadurch strömt kalte Außenluft durch die Heizkammer und
zwischen den heißen Steinen entlang, wird so erwärmt und heizt
schließlich den Raum. Unter dem Glasboden sehen Sie die Reste der
Brennkammer. Auch der Ostflügel des Klosters kann so beheizt werden,
die Reste der dortigen Brennkammer sind allerdings nicht zugänglich.
Warmluftheizungen gibt es im Mittelalter häufiger in Rathäusern,
Klöstern und in Häusern wohlhabender Bürger. Sie sind vor allem im
nördlichen Deutschland und in Teilen Skandinaviens verbreitet. Allein
in Lübeck gibt es Spuren von 19 weiteren Heizungen dieser Art. Bei der
Restaurierung des Hospitals wurde dem Schmuckfußboden große
Aufmerksamkeit gewidmet. Der Zustand des Bodens war äußerst kritisch,
er konnte von den Restauratoren jedoch stabilisiert werden.

Skulptur der Maria Magdalena
Mary Magdalene, Kiki Smith (USA), 1994 Silikonbronze, Kette mit Fußring aus Schmiedeeisen
Die Künstlerin Kiki Smith (*1954) verbindet in ihren Arbeiten häufig
religiöse Vorstellungen mit überlieferten Frauenbildern. Die Heilige
Maria Magdalena, die in der christlichen Ikonografie des Mittelalters
und der frühen Neuzeit meist als reuige Sünderin dargestellt wird,
zeigt sie nackt, mit behaartem Körper und stolz nach oben gerichtetem
Blick, eine zerbrochene Eisenkette am Fußgelenk. Die Figur der Maria
Magdalena spielt auch in der Entstehungsgeschichte des Burgklosters
eine entscheidende Rolle. Der Legende nach ist es der Heiligen zu
verdanken, dass sich die Lübecker in der Schlacht von Bornhöved am 22.
Juli 1227 endgültig von der Herrschaft König Waldemars II. von Dänemark
befreien können. Das Gelände, auf dem sich die Burg ihres einstigen
Stadtherrn befand, übergeben sie den Dominikanerbrüdern. Zu Ehren Maria
Magdalenas errichten diese hier mit den Stiftungsgeldern Lübecker
Bürger ein Kloster und eine Kirche.

Marzipan-Speicher Café und Lübecker Marzipan-Speicher

Die Trave am nördlichsten Punkt der Altstadtinsel

Malerwinkel mit Blick auf den Lübecker Dom

Holstentorplatz, Holstentor und St. Petri zu Lübeck

Wem der viele Text zu lange war und lieber Bewegtbilder mit Musik mag,
kann sich gerne dieses Video antun: