web steiner
Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen
Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.
+43/2624/54014 - office@websteiner.com
Magdeburg
die Ottostadt, Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt, September 2024
Magdeburg ist die Hauptstadt des Landes
Sachsen-Anhalt. Die Stadt liegt an der Elbe und mit über 240.000
Einwohnern die größte Stadt Sachsen-Anhalts. Sie war im Spätmittelalter
eine der größten deutschen Städte und ein Zentrum der Reformation. Im
Mai 1631 wurde sie im Verlauf des Dreißigjährigen Krieges nahezu
vollständig zerstört. Zu den historisch bedeutendsten Persönlichkeiten
der Stadt gehören der erste Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, Otto
I., sowie ihr Bürgermeister Otto von Guericke. Sie dienen der
Stadt-Kampagne „Ottostadt Magdeburg“ als Namenspatrone. Im
Dreißigjährigen Krieg wurde Magdeburg durch kaiserlich-katholische
Truppen 1631 erobert und verwüstet („Magdeburger Hochzeit“).
* * *
Das Projekt „Erdachse“
im Maßstab 1:1.000.000 war das Siegerprojekt eines Wettbewerbs der
Philipp Holzmann AG für ein Kunstwerk am Eingang des neuen City Carré
in Magdeburg. Fast
zwei Drittel der 12 m langen und 10 t schweren, vorgespannten Achse aus
Nero-Assoluto-Granit ragen aus einem verglasten unterirdischen Schacht. Zusammen
mit der massiven Granitscheibe auf Äquatorhöhe bildet die Skulptur den
Abstand zwischen den Polen im Maßstab 1:1.000.000.
Die vorgespannte Granitskulptur ist nicht nur parallel zur Erdachse
positioniert, sondern rotiert auch mit derselben Geschwindigkeit,
sodass die genaue Uhrzeit von der rotierenden Scheibe abgelesen werden
kann. Der Uhrzeiger besteht aus einem Edelstahlband im Bodenbelag, das von Nord nach Süd über den gesamten Platz verläuft. Die Granitscheibe auf Äquatorhöhe ist aus einem Stück gefertigt, 30 cm dick und hat einen Durchmesser von 250 cm.
Axis of the Earth, Bahnhofsvorplatz Magdeburg, 1999

Otto von Guericke (1602-1686)
war ein deutscher Politiker, Jurist, Physiker und Erfinder. Bekannt ist
er vor allem für seine Experimente zum Luftdruck mit den Magdeburger
Halbkugeln. Er gilt als Begründer der Vakuumtechnik.
Guericke legte zwei Halbkugelschalen aus Kupfer mit etwa 42 cm
Durchmesser so aneinander, dass sie eine Kugel bildeten. Zwischen den
Kugelschalen diente ein mit Wachs und Terpentin getränkter
Lederstreifen als Dichtung. Anschließend entzog er dem so entstandenen
Hohlraum mit der von ihm erfundenen Kolbenpumpe über ein Ventil die
Luft. Der Luftdruck, der nun nur von außen auf die Kugel wirkte,
drückte diese so stark zusammen, dass sich diese selbst mit 30 (in
Regensburg, zwei Gespanne mit je 15) bzw. 16 (in Magdeburg, zwei
Gespanne mit je acht) Pferden nicht mehr auseinanderziehen ließ. Die
Halbkugeln konnten erst wieder getrennt werden, nachdem durch das
Ventil wieder Umgebungsluft zurück in die Kugel gelassen worden war.
Denkmal am Ratswaageplatz in Magdeburg

Rathaus der Landeshauptstadt Magdeburg
Das Alte Rathaus von Magdeburg befindet sich am Alten Markt im Zentrum
der Stadt. Neben der Gesamtfassade des Alten Rathauses sind einige
Details sehenswert. So zeigt die Bronzetür des Bildhauers Heinrich Apel
Szenen aus der Geschichte Magdeburgs. Im linken Bereich der Fassade
steht der 2005 errichtete Magdeburger Roland. Direkt vor dem Rathaus
steht das vergoldete Standbild des Magdeburger Reiters. Nahe der
Südwestecke des Alten Rathauses steht seit 2012 eine Säule mit einem
Hirsch darauf.

Rathaus - Erbaut 1691-98 im Stil der niederländischen Renaissance von
Ingenieurhauptmann Schmutze. Gotischer Vorgängerbau im 30-jährigen
Krieg zerstört, Gewölbe der Kürschner-Innung aus dem 12./13.
Jahrhundert als „Ratskeller" erhalten.

Die Bronzetür des Bildhauers Heinrich Apel zeigt Szenen aus der Geschichte Magdeburgs.

Der Magdeburger Roland ist eine
Rolandsfigur vor dem Rathaus auf dem Alten Markt in Magdeburg. Die
Tradition der Rolandsfiguren stammt aus dem Mittelalter. Die Figuren
symbolisierten die städtischen Freiheiten und die Unabhängigkeit der
jeweiligen Stadt. Der jetzige Magdeburger Roland entstand im Jahr 2005.
Die 4,80 Meter große Figur wurde aus Cottaer Sandstein geschaffen. Auf
der Rückseite des Rolands befindet sich eine kleine Figur Till
Eulenspiegels, unter welcher sich die Inschrift Roland ano 778
gestorben befindet. Eulenspiegel, der auch in Magdeburg gewirkt haben
soll, konterkariert so das ernste militärische Auftreten des Rolands.
Die erste urkundliche Erwähnung eines Magdeburger Rolands geht auf das
Jahr 1419 zurück.
MAGDEBURGER ROLAND NACH JOHANNES POMARIUS VON 1589 wiedererrichtet im
Jahre 2005 durch den Freundeskreis historischer Roland zur Zeit
des Oberbürgermeisters Dr. Lutz Trümper

Der Magdeburger Reiter ist ein
Reiterstandbild, das um 1240 in der jüngeren Magdeburger Werkstatt
angefertigt wurde. Es handelt sich um ein frühes lebensgroßes
rundplastisches Reiterstandbild der mittelalterlichen Skulptur und
gehört zu den erstrangigen Werken der europäischen Kunstgeschichte.
Zwei Jungfrauen ergänzen ihn zu einer Figurengruppe. Die drei Statuen
bestehen aus mehreren Blöcken eines feinkörnigen Sandsteins. Auf dem
Alten Markt steht eine Kopie, das Original kann man im Kaiser-Otto-Saal
im Kulturhistorischen Museum Magdeburg sehen.
Der Reiter sitzt aufrecht auf seinem Pferd und pariert es mit der
linken Hand. Die Zügel sind nicht erhalten. Die rechte Hand ist mit
einer hoheitsvollen Geste ausgestreckt; prunkvolle Kleidung und Krone
weisen den Reiter als Herrscher aus. Er trägt Stiefel, sitzt auf einem
Sattel, beide Füße sind in Steigbügel gestellt. Unter dem Gürtel trägt
er ein Wehrgehänge mit Scheide und Schwert.
Die beiden Frauenfiguren erreichen nur eine Höhe von 1,45 m, sind also
dem Reiter untergeordnet dargestellt. Jungfrauen gehörten zum Auftritt
des Herrschers vor seinem Volk. Die Falten der schweren Kleider sind
auf dem Boden drapiert. Die Ärmel sind eng. Das Haar der beiden
Jungfrauen ist im Nacken zum Zopf gebunden, sie tragen Stirnbänder. Die
Gesichter der Begleiterinnen sind ausdrucksstark und stolz.

Die Hirschsäule in Magdeburg
ist ein Standbild auf dem Alten Markt der Stadt. Sie befindet sich seit
2012 wenige Meter neben der südwestlichen Ecke des Magdeburger
Rathauses, geht jedoch auf eine ältere Tradition zurück. Eine erste
Erwähnung erfolgte bereits 1429. Das historische Standbild wurde als
Hirsch mit goldenem Halsband beschrieben, der auf einer wohl runden
Säule steht und zum Roland hinübersieht. Die Säule könnte aus Holz oder
Stein gefertigt gewesen sein. Für den Hirsch wird angenommen, dass er
aus Metall gegossen war.

Die Fünf Sinne ist der Name
einer Figurengruppe südlich neben dem Magdeburger Rathaus am
Martin-Luther-Platz in der westlichen Verlängerung der
Johannisbergstraße südöstlich der Hirschsäule. In Magdeburg entstand im
Jahr 1969 eine bildhauerische Umsetzung durch den von Gustav Weidanz
ausgebildeten Heinrich Apel, der in Magdeburg zahlreiche Kunstwerke
schuf. Im Jahr 1972 wurde sie in der Nähe des Alten Marktes südlich des
Rathauses aufgestellt, wo sie sich in direkter Nachbarschaft zu einigen
der wichtigsten Plastiken Magdeburgs, wie dem Roland, dem Magdeburger
Reiter oder der Hirschsäule, befand.

Apel entschied sich für eine Säule aus Muschelkalkstein, auf der er
eine Figurengruppe anordnete, bei der jede der Figuren einen der Sinne
darstellen soll und auf einer eigenen – von der Säule abstehenden –
Plattform steht. Die Figur für den Geruch steckt ihren Kopf in einen
Blumenstrauß, die Figur für das Fühlen hält ein Tier im Arm, die Figur
für das Schmecken führt gerade die Hand an den Mund, die Figur für das
Sehen schaut mit niedergeschlagenen Lidern auf etwas, das sie in der
Hand hält, und auch die Figur für das Hören versucht den Sinn bildlich
darzustellen. In die Mitte zwischen die Figuren installierte Apel einen
Pinienzapfen, dem sie den Rücken zukehren.

Prämonstratenserberg vor dem Gebäude Regierungsstraße 37C

Hundertwassers "Grüne Zitadelle" von Magdeburg
Das Haus befindet sich in der Innenstadt am Breiten Weg in
unmittelbarer Nähe des Domplatzes und des Landtages. Östlich des Hauses
verläuft die Kreuzgangstraße. Der Bau an dieser Stelle war umstritten.
Die Kosten beliefen sich auf etwa 27 Millionen Euro.

Die Grüne Zitadelle ist ein von Friedensreich Hundertwasser entworfenes
Gebäude in Magdeburg. Fertiggestellt wurde es im Jahr 2005. Es handelt
sich dabei um eines der letzten Projekte, an denen Hundertwasser vor
seinem Tod im Jahr 2000 arbeitete. Mit der Hundertwasserschule in der
Lutherstadt Wittenberg hat er ein weiteres Gebäude in Sachsen-Anhalt
künstlerisch gestaltet.

Die Nutzfläche beträgt 11.300 m². Im Erdgeschoss befinden sich mehrere
Läden, ein Café und ein Restaurant. Unter anderem steht hier in der
„Information in der Grünen Zitadelle“ auch das originale Baumodell. Im
Gebäude befindet sich das Theater, ein ART-Hotel und die
Kindertagesstätte „FriedensReich“. In den oberen Etagen des Hauses
befinden sich 53 Wohnungen sowie Praxen und Büros.

FAUNENBRUNNEN von Heinrich Apel entworfen; 1986 errichtet - der aus
Bronze gefertigte Brunnen wird umgangssprachlich auch "Teufelsbrunnen"
genannt; dargestellt werden eine Vielzahl von wasserspeienden Faunen,
gutmütige Fabelwesen, die allerlei Schabernack treiben
Davor die bekannten Halbkugeln von Magdeburg

Der Faunbrunnen, auch als Faunenbrunnen oder Teufelsbrunnen bezeichnet, ist ein Brunnen in der Magdeburger Altstadt.
Der in der Leiterstraße stehende Brunnen wurde durch den Magdeburger
Bildhauer Heinrich Apel geschaffen und bildet den Mittelpunkt einer
platzartigen Erweiterung der als Fußgängerzone ausgestalteten Straße.
Der als großer Topf aus Bronze gestaltete Brunnen steht auf einem mit
mehreren Stufen versehenen, kreisrunden Podest aus Backsteinen. Der
Bronzekessel weist einen Umfang von 3,2 Metern auf und trägt an seiner
Ostseite das Wappen der Stadt Magdeburg. Um den Bronzetopf verläuft
eine Wasserrinne. Bemerkenswert sind die vielen Figuren, die am Rande
des Topfes das Podest bevölkern oder aus dem Topf heraus agieren. Zwei
miteinander kämpfende Jungen, zwei sich gegenseitig abtrocknende
Frauen, eine Frau auf einem Hocker und ein von dieser abgewandt
blickender junge Mann sind wie zufällig auf dem Podest platziert. Neben
dem Frauenpaar, welches wie alle Figuren nackt dargestellt ist, finden
sich auch eine Katze und eine Schildkröte. Ein Hund uriniert an die
Außenseite des Topfes.

Leiterstraße 5a, 39104 Magdeburg, Deutschland

Gebäude der Hauptpost (Ostseite)
1895–1899 im späthistorischen Stil errichteter Gebäudekomplex,
entstanden im Zuge des von v. Stephan initiierten Programms zur
Unterbringung der Post- und Telegraphenverwaltungen, wie der
Oberpostdirektion Magdeburg. Für den Bau wurden Gebäude des 17. und 18.
Jahrhunderts abgerissen. Die Ostfassade ist in ihrer Gestaltung der
niederländischen Spätgotik nachempfunden.

Postbank Filiale im Justizzentrum Eike von Repgow

Röm.-kath. Kathedrale (Bischofskirche) Sankt Sebastian
Um 1015 Gründung dieser Kirche durch Erzbischof Gero als Kollegiatsstift zu Ehren der Hl.Sebastian und Johannes
Um 1150 Neubau einer kreuzförmigen Basilika; in Westwerk und Vierung heute noch erhalten
Anfang 15.Jahrhundert: Umbau zur gotischen Hallenkirche; Chor und
nördliche Seitenkapelle vollendet. Weiterbau ab Vierung sparsam auf
alten Mauern
1489 Einweihung der neuen Hallenkirche durch Erzbischof Ernst von Sachsen
1631 Zerstörung der Stadt durch Tilly; alle Kirchen beschädigt;
St.Sebastian bekommt eine provisorische Holzdecke (bis1876); die
zerstörten Türme werden in der heutigen Form aufgebaut
1810 Säkularisierung: das Kollegiatsstift fällt an den Staat; Kirche wird Lagerhaus und Feldschmiede in der Franzosenzeit
1823 Verkauf der Kirche an die Stadt; Wollmagazin
1876 wurde die Kirche der röm.-kath.Gemeinde übereignet und gründlich renoviert; seit 1878 werden wieder Gottesdienste gefeiert
1945 durch Bomben erheblich beschädigt
1953-1959 und 1980-1990 gründliche Renovierungen
Seit 1949 Bischofskirche eines Weihbischofs von Paderborn mit Sitz in Magdeburg
Seit 1994 Kathedrale des neuen Bistums Magdeburg

Bronzeportal (1987) von Jürgen Suberg, Olsberg-Elleringhausen / Sauerland
Außenseite:
Das Paradies: Friedliches Miteinander von Mensch und Kreatur. Adam und Eva unter dem Baum der Erkenntnis.
Der Sündenfall: Der Mensch will sein wie Gott.
Vertreibung aus dem Paradies.
Der Brudermord des Kain an Abel: Die Brutalität unter den Menschen nimmt zu.
Die Arche Noach: Gott bietet Rettung an; er will nicht den Untergang der Menschen.
Alles überspannt vom Regenbogen (= alttestamentliches Zeichen des
Bundes Gottes mit den Menschen), gehalten von der Vaterhand Gottes.

Bronzeportal (1987) von Jürgen Suberg, Olsberg-Elleringhausen / Sauerland
Innenseite:
Kreuzigungsgruppe: Endgültige Erlösung durch den Kreuzestod Jesu. An
den Armen Jesu hängen die Schächer: Der eine sucht Hilfe in inniger
Zuneigung. Der andere wendet sich ab. Er tritt Jesus buchstäblich vors
Schienbein.
Links oben: Hilflos-nackt liegt das Christuskind zwischen Ochs und
Esel. Es klammert sich an die duldende weltliche Kreatur. Jedes Kind
sucht Halt - auch heute.
Links unten: Hochzeit zu Kana. Aus Wasser wird Wein. Jesus erregt
Aufsehen und Neid. Die Menschen haben sich in 2000 Jahren nicht
verändert.
Rechts unten: Der österliche Engel mit den ungläubigen Frauen am leeren
Grab - wie dicht liegen Tränen und Hoffnung beieinander!
Rechts oben: Der Weltenrichter: Hier mündet alles irdisch Bewegte. ER
verkündet, garantiert und fordert die ewige Wahrheit. Bei IHM werden
Maßstäbe zurechtgerückt. Die Strenge des Urteils läßt (hoffentlich)
Raum für Barmherzigkeit und Gnade.
Grabplatte als Abdeckung der darunter befindlichen Gruft von Jürgen Suberg, Olsberg-Elleringhausen / Sauerland
Abbildung des himmlischen Jerusalem als Zeichen der Vollendung der
Schöpfung, - Ziel aller irdischen Wanderschaft. Christus, der
Auferstandene, „das geschlachtete Lamm" ist Mittelpunkt dieser Stadt,
des neuen Himmels und der neuen Erde. Von dieser Stadt aus fließt durch
die Stadttore in alle Himmelsrichtungen das Wasser des Lebens.

KATHOLISCHE BISCHOFSKIRCHE ST. SEBASTIAN
um 1015 Erzbischof Gero
(1012-1022) gründet ein Kollegiatsstift, das den Heiligen Johannes Ev.,
Fabian und Sebastian geweiht wird. Von diesen Gründungsbau, in dem
Erzbischof Gero 1022 bestattet wird, ist nichts erhalten.
1169 Bau und Weihe einer
kreuzförmigen dreischiffigen Basilika mit doppeltürmiger West-front.
Von dieser aus Bruchsteinen aufgeführten Kirche blieb die
Doppelturmanlage und Teile des Querschiffes mit zeittypischen Baudekor
erhalten.
um 1400 Der romanische Chor
wird nach Osten verlängert und mit einem neuen polygonalen Schluss
versehen. Zeitgleich wird die Sakristei auf der Nordseite des Chores
errichtet.
um 1489 Die Basilika wird zur
Hallenkirche umgebaut und geweiht. Sie ist heute weitgehend erhalten.
Über den Fundamenten der romanischen Basilika errichtet, integriert der
Neu-bau die Doppelturmanlage und Teile des alten Querschiffes. Eine
Besonderheit der Hallenkirche liegt in der unterschiedlichen Gestalt
der Langhausstützen.
1663 Nach dem 30jährigen Krieg
wird der Chor wiederhergestellt und eine hölzerne Decke als
Gewölbeersatz eingebaut. Die Westtürme erhalten barocke Hauben. Der
zerstörte Kreuzgang auf der Nordseite wird nicht wieder aufgebaut.
1876 St. Sebastian wird katholische Pfarrkirche. Das Langhaus wird neu gewölbt und das Westportal in die Turmfront gebrochen.
1946 Mit Ausnahme der
Turmhauben ist die Kirche als einzige im Stadtzentrum schon wenige
Monate nach Kriegsende wieder hergestellt. Ab 1949 ist St. Sebastian
Katholische Bischofskirche eines Weihbischofs von Paderborn mit Sitz in
Magdeburg.
1982-1991 Die Kirche wird
erneut saniert und mit Ausstattungsstücken zeitgenössischer Künstler
versehen, wie mit der Bronzetür des Westportals, dem Altar und der
Farbverglasung der Chorfenster.
1994 St. Sebastian wir zur Kathedrale (Bischofskirche) des wiedererrichteten Bistums Magdeburg erhoben.
2003 Auf der Nordseite der
Kirche werden ein neues Sakristeigebäude mit einem Kapitel-saal und ein
Kreuzgang mit Kapitelfriedhof angebaut.
2003-2004 Die Kathedrale wird saniert und umgestaltet. Sie erhält einen neuen Glockenstuhl.
2005 Einweihung der neuen Orgel auf der Westempore.
Von der mittelalterlichen Ausstattung der bedeutenden Stiftskirche ist
nichts erhalten. Mit der Umwandlung zur katholischen Bischofskirche
brachte man hier kostbare Kunstwerke aus anderen Kirchen zusammen. Dazu
gehören die zwei Marienaltäre und das lebensgroße Kruzifix aus dem 15.
Jahrhundert.

Gotischer Flügelaltar von 1510/20 im Chor, die neuen Fenster im Chorraum von Alois Plum

Die Kathedrale St. Sebastian (vollständig Kathedral- und Propsteikirche
St. Sebastian) in Magdeburg ist die römisch-katholische Propsteikirche
der Stadt Magdeburg und Kathedralkirche des Bistums Magdeburg. Sie ist
Teil der Straße der Romanik. Patron der Kirche ist Sebastian. Die Grundsteinlegung erfolgte um 1015 durch Erzbischof Gero, der nach seinem Tod 1022 in der Kirche beigesetzt wurde.

Nach einem Umbau der Westempore errichtete die Firma Eule im Jahr 2005
eine neue Orgel auf dieser. Das Instrument (op. 637) wurde maßgeblich
in mitteldeutsch-klassischem und mitteldeutsch-romantischem Stil
disponiert, ergänzt um einige Register im französisch-symphonischen
Stil. Es hat 56 Register auf drei Manualen und Pedal. Eine neckische
Spielerei ist im Rückpositiv installiert: In dessen rechter Seitenwand
befindet sich eine Luke. Diese geht beim Ziehen des Registers „Vox
strigis“ auf, und eine lebensgroße Nachbildung einer Eule kommt, in
Anlehnung an die Erbauer, aus dieser hervor.


Weiterhin steht eine zunächst an der Westwand des nördlichen
Querschiffs aufgestellte und 2004 an die Nordwand des Hohen Chores
umgesetzte Chororgel in der Kirche. Diese sollte 19 Register auf zwei
Manualen und Pedal bekommen. Ihr Bau wurde 1992 von der Firma A.
Schuster & Sohn, Zittau begonnen, verharrte jedoch bei einem
Ausbaustand von zunächst 11 und ab dem Jahr 1999 dann bei 13 Registern.
Infolge des Verkaufs der verschlissenen Hauptorgel konnte der Bau der
Chororgel 2001 von der Schuster-Nachfolgefirma Welde abgeschlossen
werden. Bei der Umsetzung in den Chorraum ergänzte Fa. Welde das Werk
durch ein an der Außenseite der Gehäuserückwand installiertes, offenes
16′-Register, sodass die Orgel mit mechanischer Spiel- und
Registertraktur und einem ebenfalls von Fritz Leweke gestalteten
Prospekt nun 20 Register hat.

Die Erstürmung und Verwüstung der Stadt durch Graf Tilly und seinem
General Gottfried Heinrich Graf zu Pappenheim am 20. Mai 1631 ließ auch
von St. Sebastian nur Ruinen übrig. Wem der Name Pappenheim bekannt
vorkommt, kennt bestimmt das Sprichwort „Ich kenne meine Pappenheimer“.
Dieses Sprichwort geht tatsächlich zurück auf den Grafen von
Pappenheim. Im Drama „Wallensteins Tod“ lässt Schiller Wallenstein
diesen Spruch sagen. Wallenstein erkennt hiermit die Treue der Truppen
von Pappenheim an, indem er Gerüchten über eine Untreue hiermit eine
Abfuhr erteilt. Schiller verbindet diesen Satz also mit etwas
Positivem. Wogegen im Laufe der Zeit der Spruch „Ich kenne meine
Pappenheimer“ eher negativ besetzt wurde.

Die Kirche erhielt um 1959 auch einige kostbare Ausstattungstücke. Zu
nennen sind vor allem die beiden mittelalterlichen Flügelaltäre, aber
auch die moderne Figur des heiligen Sebastian, der Taufbrunnen und der
in Freskomalerei gefertigte Kreuzweg. Bereits 1951 war Weihbischof
Weskamm zum Bischof von Berlin ernannt worden. Sein Nachfolger wurde
der Paderborner Generalvikar Friedrich Maria Rintelen. Am 24. Januar
1952 empfing er in St. Sebastian die Bischofsweihe.

DOMKIRCHE ST. MAURITIUS UND ST. KATHARINA
805 Magdeburg wird im
Diedenhofener Kapitular erstmals erwähnt. In dieser Gesetz Karls des
Großen (768-814) werden Bestimmungen über den Handel mit den Slawen
getroffen, die auch für das an der Grenze des karolingischen Reiches
liegende Magdeburg gelten. Archäologische Befunde deuten auf eine
karolingische Befestigung auf dem heutigen Domplatz
929 Otto der Große überträgt im
Rahmen seiner Heirat mit der angelsächsischen Königstochter Editha
Magdeburg als Morgengabe an seine Gemahlin. Bis zum Beginn seiner
Herrschaft (936) sollen sich Otto und Editha in Magdeburg aufgehalten
haben.
937 Otto der Große gründet mit Zustimmung seiner Gemahlin Editha das Benediktinerkloster St. Mauritius.
942 Das Kloster St. Mauritius
erhält von Otto dem Großen das Recht auf die Einnahmen aus Zoll und
Münze. Dies weist auf schon vorhande erl Handel in Magdeburg hin. In
diesem Jahr wird erstmals auch die Pfalz in Magdeburg urkundlich
genannt.
26. Januar 946 Königin Editha stirbt und wird in der Klosterkirche beigesetzt.
955 Nach der erfolgreichen
Schlacht gegen die Ungarn auf dem Lechfeld lässt Otto der Große den Bau
einer Kirche beginnen. Beabsichtigt ist, in Magdeburg ein Erzbistum zu
errichten. Auf Befehl Ottos des Großen werden in den folgenden Jahren
aus Italien antike Säulen, Reliquien und andere Kostbarkeiten für die
Ausstattung der Kirche herbeigebracht.
965 Otto der Große erteilt dem
Abt des Klosters St. Mauritius das Markt-, Münz- und Zollrecht für alle
nach Magdeburg ziehenden Händler. Ebenso werden die in Magdeburg
ansässigen Kaufleute unterschiedlichster Herkunft, zu denen auch Juden
gehören, dem Abt unterstellt. Der wirtschaftliche Aufschwung macht eine
weitere Siedlung für Kaufleute notwendig, die sich im Bereich des
heutigen Alten Marktes zu entwickeln beginnt.
968 Das Erzbistum Magdeburg
wird gegründet, dem die schon 948 entstandenen Bistümer Havelberg und
Brandenburg sowie die ebenfalls neugegründeten Bistümer Merseburg,
Meißen und Zeitz unterstellt werden. Erster Erzbischof wird Adalbert
(968-981).
7. Mai 973 Otto der Große stirbt und wird im ottonischen Dom beigesetzt.
Der ottonische Dom fällt 1207 einem Brand zum Opfer. Noch im selben
Jahr wird mit dem Neubau begonnen. In den gotischen Dom werden einige
als besonders kostbar geltende Gegenstände aus dem ottonischen Dom
einbezogen: so etwa die aus Italien stammenden Säulen und die antike
Marmorplatte, die das Grab Ottos des Großen bis heute bedeckt.

Das ottonische Magdeburg - Eine Stadt in Kaisernähe
Otto I. (936-973) rückte den fränkischen Grenzhandelsplatz und
militärischen Stützpunkt gegenüber den elbslawischen Gebieten in den
Mittelpunkt des Interesses. Politisch und wirtschaftlich förderte er
Magdeburg mit all seiner königlichen und kaiserlichen Gewalt. Die
frühstädtische Siedlung zog eine Bevölkerung unterschiedlichster
Herkunft an, die sich schnell auf einem Gebiet ausbreitete, das fast
die heutige Altstadt und vermutlich Teile Sudenburgs einschloss.
Seit 942 erscheint auf den Urkunden Magdeburg als palatium, als
königliche Pfalz. Zu einer mittelalterlichen Pfalz gehörte eine
angemessene Ausstattung mit repräsentativen weltlichen und geistlichen
Gebäuden, um den umherziehenden König mit seinem Hof aufnehmen und
verpflegen zu können. Spätestens ab 955 verfolgte Otto den Plan, hier
ein Erzbistum einzurichten. Ein prächtiger Dombau entstand vermutlich
an der Stelle des Moritzklosters, wo seine erste Frau Editha (um
910/912-946) bestattet lag. Im ehemaligen Pfalzbereich stand - wie die
archäologischen Ausgrabungen ergaben - möglicherweise zu Zeiten Ottos
eine weitere Kirche, deren Identifizierung mit den schriftlich
überlieferten Kirchen noch nicht gelungen ist. Bisher unentdeckt ist
der königliche Palast, die aula regia Ottos des Großen. Nach der
zeitgenössischen Überlieferung scheinen die königlichen
Repräsentativgebäude im Bereich des späteren erzbischöflichen Sitzes
südlich der heutigen Staatskanzlei gelegen haben.

Der Dom St. Mauritius und Katharina zu Magdeburg, kurz Magdeburger Dom,
ist Predigtkirche des Landesbischofs der Evangelischen Kirche in
Mitteldeutschland, evangelische Pfarrkirche und zugleich das
Wahrzeichen der Stadt Magdeburg. Der Dom ist die erste von Anfang an
gotisch konzipierte und die am frühesten fertiggestellte Kathedrale der
Gotik auf deutschem Boden sowie der größte Sakralbau Ostdeutschlands.

Der Dom ist Grabkirche Ottos des Großen und seiner ersten Gemahlin
Editha. Nach schweren Beschädigungen durch alliierte Luftangriffe auf
Magdeburg 1944/1945 und Restaurierung nach dem Krieg wurde der Dom 1955
wieder eröffnet. Er wurde ab 1209 als Kathedrale des Erzbistums
Magdeburg gebaut, im Jahr 1363 geweiht und 1520 fertiggestellt
(Vollendung der Westtürme).
Der Magdeburger Dom ist eine dreischiffige Kreuzbasilika mit
Umgangschor. Er besteht aus Sandstein. Die Errichtung des gotischen
Neubaus der Kathedrale dauerte über 300 Jahre vom Baubeginn 1207/09 bis
zur Vollendung der Türme im Jahre 1520. Der Dom hat eine
Gesamtinnenlänge von 118 m und eine Innenbreite über alle drei Schiffe
von 33 m. Die Innenhöhe des Mittelschiffs bis zum Gewölbescheitel
beträgt 32 m. Der Querschnitt der Dachkonstruktion auf Mittelschiff und
Querhaus entspricht einem gleichseitigen Dreieck.

Der Dom weist eine sehr lange, reichhaltige und wechselvolle
Orgelgeschichte auf, die schon ab dem 14. Jahrhundert nachweisbar ist.
Im Jahr 1377 ist bereits von „orgelen“ im Plural die Rede. Die Fa.
Schuke begann im Frühjahr 2006 mit der Errichtung der größten Orgel
Sachsen-Anhalts. Am 18. Mai 2008 wurde sie eingeweiht.
Das Instrument ist 14,75 m hoch, 10,75 m breit, 9,15 m tief, 37 Tonnen
schwer und enthält 93 Register (92 echte Register und eine
Transmission). Die 6139 Pfeifen, von denen 5124 aus Metall und 1015 aus
Holz gefertigt sind, lassen sich über vier Manuale und ein Pedal
spielen. Die größte Pfeife ist die 10,37 m hohe Holzpfeife C des
Principal 32′, das Fis des gleichen Registers ist die größte
Prospektpfeife.
Hauptorgel auf der Westempore von Firma Alexander Schuke Potsdam Orgelbau

Das klanglich überzeugende Instrument Querhausorgel befindet sich auf
dem Sims eines Ganges über der „Paradiespforte“. Die Orgel kann mit
ihren 37 Registern auf drei Manualen und Pedal allenfalls das Querhaus
klanglich füllen und ist in den anderen Bereichen des Doms nur
verschwommen hörbar. Im Querhaus hält sich zudem während normaler
Gottesdienste niemand auf, da der Liturgiealtar und die
Standardbestuhlung im Hauptschiff westlich der Vierung stehen. Auch der
Chorraum wird von der Orgel nur indirekt erreicht.
Querhausorgel („Paradiesorgel“)

Otto I. der Große gründete 937 das Mauritiuskloster, im Jahre 946 wurde
dort seine erste Gemahlin Edith bestattet. Offenbar hatte Otto schon
damals Magdeburg auch als seinen eigenen Begräbnisort bestimmt. Im
Zusammenhang damit betrieb er bereits in den 950er Jahren die
Einrichtung eines Erzbistums in Magdeburg. Vor der Schlacht auf dem
Lechfeld 955 gelobte Otto, noch vor seiner Krönung zum Kaiser am 2.
Februar 962 für den Fall seines Sieges in Merseburg ein Bistum zu
errichten – offenbar sollte dieses Bistum zu dem noch zu gründenden
Magdeburger Erzbistum gehören. In den 950er Jahren begann er
nachweislich einen großartigen Neubau. Um seinen imperialen Anspruch in
der Nachfolge der römischen Kaiser zu unterstreichen, ließ er
zahlreiche Kostbarkeiten nach Magdeburg bringen, so auch den Codex
Wittekindeus, ein Evangelistar, das im Kloster Fulda entstanden war,
und Spolien wie antike Säulen, die später im Chor des
spätromanisch-gotischen Domneubaus aufgestellt wurden.
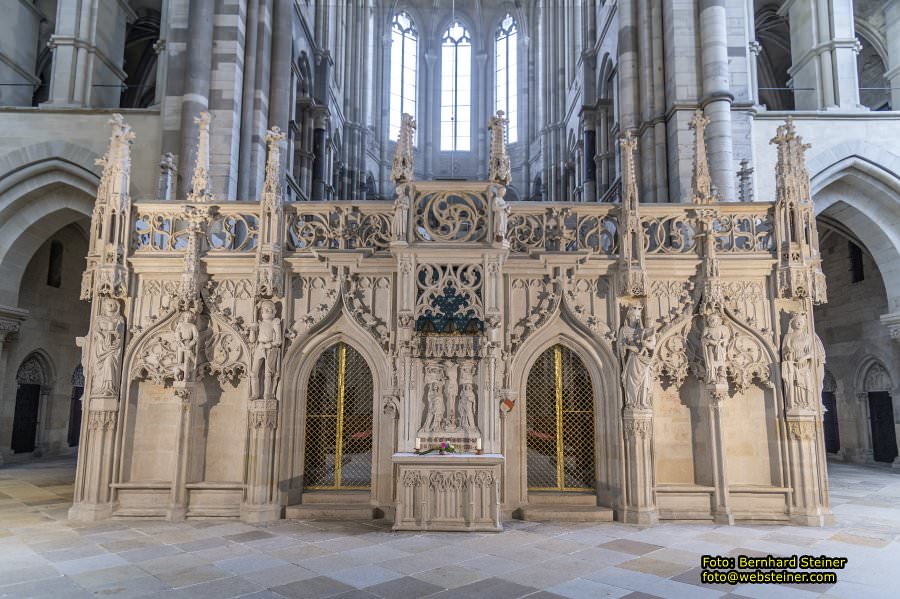
Zur Zeit der Reformation war Magdeburg eine Hochburg des
Protestantismus, nicht zuletzt weil Erzbischof Albrecht von Brandenburg
einen regen Ablasshandel betrieb und dadurch den Unmut der Bürger auf
sich zog. Während des Dreißigjährigen Krieges eroberten am 20. Mai 1631
die Truppen Kaiser Ferdinands II. unter General Tilly und seinem
Truppenführer Pappenheim Magdeburg. Über das anschließende Massaker,
bei dem mit rund 20.000 Menschen fast zwei Drittel der Bevölkerung
umkamen und die Stadt nicht nur ausgeplündert, sondern durch einen
Brand fast vollständig zerstört wurde, die sogenannte „Magdeburger
Hochzeit“, waren die Zeitgenossen in ganz Europa entsetzt. Zwischen
2000 und 4000 Menschen hatten sich drei Tage lang ohne Essen im Dom,
der vom Feuer verschont blieb, verschanzt und sollen ihr Überleben dem
Domprediger Reinhard Bake verdankt haben, der mit einem Kniefall vor
Tilly um das Leben der Insassen bat, was gewährt wurde.

Grabstätte Ottos I. im Magdeburger Dom

Im Magdeburger Dom erstahlt seit dem Reformationstag 2021 ein
Radleuchter! Über dem schlichten Sarkophag des Kaisers Otto bringt ein
Leuchter mit farbigen Gläsern ein vergangenes Element in den Dom
zurück.
Die Glasapplikationen der Künstlerin Christiane Budig aus Halle an der
Saale verbinden die Himmelsrichtungen mit den Jahreszeiten. Im Osten
deuten Knospen in den Zweigen den Frühling an. Im Norden leuchten
stilisierte Fische, das Geheimzeichen der ersten Christen. Im Süden
strahlt das Licht in einer Zentralperspektive und die Westrichtung
bildet mit Äpfeln die Früchte der Erde ab. Damit nehmen wir die
mittelalterliche Tradition der Radleuchter in Kathedralen auf und
führen diese in moderner Form weiter.
Es ist ein Jerusalemleuchter, denn: Die zwölf Tore des himmlischen
Jerusalems sind weit geöffnet und dienen als Lichtquellen. Drei Tore,
dem Morgenlicht zugewandt, schauen nach Osten, drei der Kühle
vertrauend, nach Norden, drei Tore, dem Mittagslicht zu, blicken nach
Süden, drei, im Leuchten des purpurnen Abends, schauen nach Westen. Den
Ring zieren zwei Bibelworte in der Sprache des Propheten und des Sehers.

Die 8 neuen Glocken des Magdeburger Domes der ältesten und bedeutendsten gotischen Kaiser-Kathedrale Deutschlands
Gert Weber umkleidet die Glockenzier mit einer Klammer des spiritualen
Worts an der Haube mit einem Bibelspruch und dem philosophischen Verb
im Schlagring. Die Glocken-Flanke nutzt er dazu, die Glockenzier mit
graphischen Elementen zu gestalten. Hier nutzt er drei Ebenen: die
vitale Ebene mit Glocken-Wolm bis zum Glockenhals, die transzendentale
Ebene in der Glocken-Flanke und die spirituelle Ebene im Glocken-Hals.
Auf der Rückseite der Glocken, dem Revers, hat er den stilisierten
ersten Dom von der Grabplatte Friedrichs von Wettin übernommen, die
Bibelstelle und das Gussjahr eingefügt. Die verzierenden Elemente am
Schlagring verbinden die heutigen Glocken mit den vorhandenen alten
Glocken und dem Domgebäude, da sie von dem Grab Friedrichs von Wettin
mit dem stilisierten ersten Dom abgenommen wurden. Wir finden auf jeder
Glocke eine vitale Gruppe von Menschen, die mit ihrer Lage am Wolm, der
Flanke oder dem Hals eine Bedeutungsebene erhalten. Die Glockenzier
verbindet, illustriert und deutet das spirituelle mit dem
philosophischen Wort. Sie nimmt die immateriellen Obertöne des
Glockenklanges mit auf, indem sie den Schlagton mit seinen Obertönen in
die Höhe führt und so den Klang der Glocke als Ruf und Mahnung zur
Verbindung für die Menschen in der vitalen Ebene in die Höhe der
transzendenten und spirituellen Ebene führt. So verbinden die Glocken
mit ihrem Klang, ihrer Form und ihrer Zier DIESE mit JENER WELT.

Die im Jahr 2023 stattfindenden Feierlichkeiten und Ausstellungen
anlässlich des 1050. Todestages von Kaiser Otto („dem Großen“)
haben den Magdeburger Dom als Grablege des Kaisers und seiner Frau
Editha (oder auch Edgitha, Edgith) wieder mehr bekannt gemacht.
Tatsächlich befinden sich beide Gräber im Dom. Ein weiteres
Ausstattungsstück, welches gern mit dem Kaiserpaar in Verbindung
gebracht wird, ist die sogenannte „Sechzehneckige Kapelle“ oder auch
„Heilig-Grab-Kapelle“ genannt. Dieses eindrückliche Bauwerk befindet
sich im Langhaus des Domes, unmittelbar vor der Kanzel. Doch was hat es
damit auf sich und woher kommendie unterschiedlichen Bezeichnungen?
Diese Kapelle bildet ein Sechzehneck mit ca. 3,75 m Durchmesser und 72
cm Seitenlänge und besitzt ein spitzes Zeltdach. Das Baumaterial des
Zentralbaues ist durchweg Sandstein, nur für den Zugang wurde Holz
verwendet. Damit gleicht diese Anlage ganz auffallend dem Heiligen Grab
in Konstanz. Leider gibt es keinerlei schriftliche Aufzeichnungen, die
uns etwas von der Entstehung dieser Kapelle berichten. Man nimmt an,
dass das äußere Bauwerk wie auch die sich im Inneren befindliche
Figurengruppe um das Jahr 1250 entstanden sind. Auch diese Datierung
ist ähnlich des Heiligen Grabes in Konstanz. Wir hätten damit eine
Nachbildung des Jerusalemer Grabes noch vor der Kreuzfahrerzeit. Die im
Inneren befindliche Figurengruppe wird im Volksglauben als Kaiser Otto
mit seiner Gemahlin gedeutet. Doch die Aufstellung dieser Gruppe ist
nicht ursprünglich, und sehr wahrscheinlich handelt es sich eben nicht
um das Kaiserpaar, sondern eher um eine Darstellung des himmlischen
Brautpaares: Christus und seine Kirche („ecclesia“). Die zwölf
Sternzeichen und sieben Planeten in der Hand des Herrschers deuten
darauf hin. Zusätzlich ist die Figurengruppe auf leichte Untersicht
gearbeitet, war also ursprünglich nicht für die jetzige Aufstellung
vorgesehen.

Der Nordturm ist 100,98 m, der Südturm 99,25 m hoch. Die
Aussichtsplattform in 81,5 m Höhe auf dem Oktogon des Nordturms kann im
Rahmen von Führungen über 433 Stufen bestiegen werden.

Der Kreuzgang hat eine Romanische Südseite und eine Gotische Nordseite

Die Magdeburger Hochzeit (auch
Bluthochzeit oder Magdeburgs Opfergang) bezeichnet die Eroberung und
vollständige Verwüstung der Stadt Magdeburg am 20. Mai 1631 durch
kaiserliche Truppen unter Tilly und Pappenheim im Verlauf des
Dreißigjährigen Krieges. Die sarkastische Bezeichnung „Magdeburger
Hochzeit“ wurde schon unmittelbar danach geprägt und soll die
erzwungene Vermählung zwischen dem Kaiser und der Jungfrau Magdeburg
beschreiben, die auf dem Wappenschild der Stadt abgebildet ist, welche
sich schon über 100 Jahre lang gegen Zahlungen an den Kaiser gewehrt
hatte.

Zur Zeit der Reformation wurde Magdeburg eine Hochburg des
Protestantismus, nicht zuletzt weil der Magdeburger Erzbischof Albrecht
von Brandenburg einen regen Ablasshandel betrieb und dadurch den Unmut
der Bürger auf sich zog. Der Dreißigjährige Krieg begann 1618 mit dem
Ständeaufstand in Böhmen, nach dessen Niederschlagung das Land durch
Kaiser Ferdinand II. gewaltsam rekatholisiert wurde; glaubensflüchtige
Exulanten gelangten auch nach Magdeburg.
Den Kaiserlichen galten die widerspenstigen Magdeburger Bürger als
vogelfrei; die nie besoldeten und daher hemmungslos plündernden
Landsknechte kümmerten sich nicht um die Feinheiten politischer
Einstellungen der verschiedenen Parteien. Alle Häuser wurden
ausgeraubt, die Frauen vergewaltigt, Tausende von Einwohnern ohne
Rücksicht auf Alter oder Geschlecht totgeschlagen – was zwar nach
Reichsrecht bei Todesstrafe verboten war, aber weder von der Soldateska
noch von ihren Truppenführern beachtet wurde, wobei besonders die
Truppen Pappenheims wüteten. Die Gräueltaten waren so zahlreich und in
ihrer Ausführung so entsetzlich, dass sogar einige Angehörige der
Kaiserlichen Armee darüber erschrockene Berichte verfassten.

Die zehn Skulpturen der klugen und törichten Jungfrauen der
Paradiespforte von 1240/50 wurden später an das Gewände des
Nordportales platziert. Es ist die erste monumentale Gestaltung dieses
Themas, voll drastischer Direktheit im Vergleich zu den wesentlich
verhalteneren Schilderungen des gleichen Themas in der Zeit davor, die
wesentlich kleiner waren. Die Figuren sind in der Tracht des 13.
Jahrhunderts dargestellt.
Kluge Jungfrauen, freudig - Törichte Jungfrauen, traurig

Die Kriegshandlungen und Plünderungen zogen sich noch über mehrere Tage
hin, bis sie auf Tillys Befehl am 24. Mai 1631 eingestellt wurden.
Durch die Kriegshandlungen vom 20. Mai 1631 starben rund 20.000
Magdeburger Bürger. Die „Magdeburger Hochzeit“ gilt als das größte und
schlimmste Massaker während des Dreißigjährigen Krieges, das in ganz
Europa Entsetzen hervorrief. Es hieß, die Taten und der Schrecken seien
in ihrer Entsetzlichkeit „nicht in Worte zu fassen und nicht mit Tränen
zu beweinen“. Die meisten der Überlebenden mussten die Stadt verlassen,
da ihnen auf Grund der Zerstörungen die Lebensgrundlage genommen war.
Seuchen, die in der Folge auftraten, forderten weitere Todesopfer. Am
9. Mai 1631 hatte Magdeburg noch rund 35.000 Einwohner, 1639 waren es
nur noch 450. Die Stadt, vor dem Krieg eine der bedeutendsten in
Deutschland, verlor schlagartig ihren Einfluss und wurde in ihrer
Entwicklung um mehrere Jahrhunderte zurückgeworfen. Erst im 19.
Jahrhundert erreichte und überschritt Magdeburg wieder die alte
Einwohnerzahl.
Nach der Zerstörung Magdeburgs war lange Zeit der Begriff
„magdeburgisieren“ als Synonym für „völlig zerstören, auslöschen“ oder
als Sinnbild für „größtmöglichen Schrecken“ in die deutsche Sprache
eingegangen.

Die archäologische Forschung zum Domplatz geht bis in das Jahr 1876
zurück, als erste Schürfungen im Dom stattfanden. Magdeburg wurde durch
die Ausgrabungen Ernst Nickels (1902-1989) im Auftrag der Deutschen
Akademie der Wissenschaften zu Berlin von 1948 bis 1968 zum
Pionierprojekt der Stadtkernarchäologie. Der Domplatz selbst bildete in
den Jahren 1959 bis 1968 den Schwerpunkt der Untersuchungen.
Aufsehenerregendes Ergebnis sind die Überreste eines monumentalen
Steingebäudes auf einer Fläche von mehr als 2000 qm, dessen
Gesamtausdehnung nach Osten wegen der bestehenden Bebauung nicht
ausgegraben werden kann. Die Fundamentmauern, mit Schutt verfüllten
Ausbruchgräben, wenige Reste des aufgehenden Mauerwerks und ihre
umschließenden Erd- und Schuttschichten spiegeln die vermutlich
400-jährige Geschichte eines mittelalterlichen Bauwerkes wider. Bisher
ging die Forschung davon aus, in dem Grundriss den Palast der Pfalz
Magdeburgs entdeckt zu haben. Nach neueren Erkenntnissen stammt der
Grundriss offensichtlich von zwei sich ablösenden Kirchenbauten, von
denen jeweils der westliche Vorbau freigelegt war. Fragmente aus weißem
Marmor, Reste von mehrfach bemaltem Wandputz und Mosaiksteinchen sind
Hinweise auf ihre einstmals prachtvolle Ausgestaltung.

Domplatz Magdeburg und Landtag von Sachsen-Anhalt

Die Hubbrücke in Magdeburg ist
eine alte eingleisige Eisenbahnbrücke, die bei Stromkilometer 325,47
über die Elbe führt. Sie ist eine der ältesten und größten Hubbrücken
in Deutschland. Die Brücke ist heute fest arretiert und ein beliebter
Ort, um die Elbe im Zentrum von Magdeburg zu Fuß oder mit dem Rad zu
überqueren. Die denkmalgeschützte Hubbrücke verbindet die Altstadt von
Magdeburg mit der Elbinsel Werder. Besucher der Hubbrücke haben von
hier einen hervorragenden Blick über die Stromelbe auf die Altstadt und
den Fürstenwall.

Auf einem gepflasterten Platz in der Nähe des Elbufers scheint sie als
Balanceakt den sprichwörtlichen Boden der Tatsachen erreicht zu haben,
obenauf, wie das Kreuz auf dem Reichsapfel, ein sitzender Mann mit
einer großen Normaluhr zwischen den Händen. Das Ziffernblatt zeigt in
Richtung möglicher Passanten, wobei unklar ist, ob diese Situation
absichtlich oder durch Zufall entsteht. Vielleicht, dass es etwas zu
lesen gibt auf der Rückseite der Uhr, vielleicht - und das ist die
surreale Variante - will er sich die Uhr gleichsam als Gesicht
anpassen. Im Werk Gloria Friedmanns erscheint nämlich parallel zum
Zeitzähler eine Figur, die die Künstlerin Unabomber nennt und
"allmächtigen Zeitling". Statt eines Gesichts trägt sie das Zifferblatt
einer Normaluhr im vermeintlichen Kopf.
Zeitzähler Magdeburg, Gloria Friedmann, 2008

Das Theater Magdeburg ist ein Viersparten-Theater mit eigenen Ensembles
für Musiktheater, Ballett, Konzert und Schauspiel in Magdeburg. Es
entstand 2004 aus der Fusion des Theaters der Landeshauptstadt und der
Freien Kammerspiele. Es verfügt mit einem Opern- und einem
Schauspielhaus über zwei Standorte in Magdeburg.
Opernhaus Magdeburg - Bühnenhaus mit Opern-, Ballett- und Philharmonieaufführungen

Bundesverwaltungsamt Magdeburg

FESTUNG MARK
- in der letzten Phase des Ausbaus der Festung Magdeburg als Defensionskaserne Mark an der Nordfront des inneren Verteidigungsringes der Stadt erbaut (1863-1865)
- diente einerseits der Unterbringung von 800 Soldaten und andererseits der aktiven Verteidigung als letztes stadtseitiges Hindernis
- in den 20er Jahren zum Arbeitsamt umgebaut und als Gesundheitsamt genutzt
- diente während des Zweiten Weltkrieges als Unterkunft für 600 italienische Zwangsarbeiter der Firma Krupp-Gruson
- nach 1945 Abriss des teilweise zerstörten Ostflügels
- verbliebene Gebäude bis Anfang der 90er Jahre gewerblich genutzt
- seit 2001 Umbau und Sanierung als Kulturzentrum durch die Stadt Magdeburg sowie die "KulturSzeneMagdeburg e.V."
- seit 2005 in Trägerschaft der "KulturStiftung Festung Mark"

Kunstmuseum Magdeburg - Kloster Unser Lieben Frauen

WALLONERKIRCHE
- 1285 Baubeginn der hochgotischen Hallenkirche des Augustinerordens in Magdeburg mit dem für Bettelorden-Kirchen typischen kleinen Turm neben dem Chor
- im 18. Jahrhundert Kirche der wallonischen Glaubensflüchtlinge
- seit 1968 evangelische Kirche und Gemeindezentrum
- Station des St. Jakobus Pilgerweges
Leider ist die Kirche wegen Baumaßnahmen nicht frei zugänglich.

JAKOBSTRASSE - ehemals dicht besiedeltes Stadtviertel, um 1230 im Rahmen einer Stadterweiterung erstmals bebaut
dominantes Bauwerk des Stadtviertels war St. Jakobi, die größte Pfarrkirche Magdeburgs
heute dominieren dieses Wohngebiet zwei Hochhäuser sowie drei Kirchen (Johanniskirche, St. Petri und Wallonerkirche)
Petrikirche - 1150 Wehrturm der
Schifferkirche Frose. Gotische Hallenkirche nach 1380. Maßwerke
böhmisch. Südliche Vorhalle Backsteingotik. Zerstörungen 1631 / 1945.
Wiederaufbau mit gotischem Dach (Aktion Sühnezeichen) Weihe 1970 als
kath. Kirche

Zur Geschichte der St.-Petri-Kirche
um 1150 romanischer Turm, ältester Teil der Kirche, Turm der früheren Kirche des Fischerdorfes Frose vor den Stadtmauern von Magdeburg
1219 erste urkundliche Erwähnung von St. Petri
ab 1380 dreischiffige gotische Hallenkirche
Ende des 15. Jh. südliche Vorhalle im Stile der Backsteingotik
1524 wurde St. Petri protestantische Kirche
10. Mai 1631 Petri-Kirche bei der Zerstörung Magdeburgs unter Tilly im Dreißigjährigen Krieg schwer beschädigt
1689 Abschluß des Wiederaufbaus
1712 erhielt die Kirche ein neues Mansarddach
16. Jan. 1945 beim schwersten Luftangriff auf Magdeburg im Zweiten Weltkrieg wurde die Petri-Kirche bis auf die Grundmauern zerstört
1958 kaufte die Katholische Kirche die Ruine
1962-1970 Wiederaufbau der Kirche
22. Nov.1970 erneute Weihe der St.-Petri-Kirche als katholische Kirche

ST. PETRI
romanischer Westturm um 1150
dreischiffige gotische Hallenkirche mit aufwendigen Maßwerkfenstern im Chorbereich
südliche Vorhalle in Backsteingotik
Station des St. Jakobus Pilgerweges

ST. PETRI
um 1150 Die Kirche ist als
Pfarrkirche des Fischerdörfchens Frose unmittelbar vor der Stadtmauer
entstanden. Aus dieser Zeit ist noch der breite, gedrungene romanische
Westturm erhalten.
1285 Die Petrikirche, erstmals
1285 urkundlich erwähnt, wird seit der ersten Stadterweiterung im 13.
Jahrhundert mit in den Mauerring der Stadt Magdeburg einbezogen.
um 1480 Die Bauarbeiten zur
Errichtung einer Vorhalle mit Backsteingiebel auf der Südseite des
Schiffes (heutige Marienkapelle) werden abgeschlossen.
1631 Beim Stadtbrand von
Magdeburg brennt die Pfarrkirche võllig aus. Bis 1689 wird die
Pfarrkirche wieder vollständig aufgebaut. Das ursprüngliche Dach wird
1712 zum Mansarddach umgebaut.
ab 1962 Nach der Teilzerstörung
1945 wird im Rahmen der Aktion Sühnezeichen die Kirche von der
katholischen Pfarrgemeinde wieder aufgebaut. Die Dächer werden dabei
nach der mutmaßlichen Form des 15. Jahrhunderts gestaltet.
1970 Die Pfarrkirche St. Petri wird geweiht.
1997 Übernahme der Betreuung durch den Orden der Prämonstratenser
1999 Am 28. August wird St. Petri katholische Universitätskirche.
Ausstattung: Glasfenster von 1970 nach einem Entwurf von Charles Crodel
(1894-1973); liturgische Gegenstände im Altarraum; Konsolen und
Gewölbeabschluss der Marienkapelle nach einem Entwurf von Heinrich Apel.

MAGDALENENKAPELLE
hochgotische Sühnekapelle am ehemaligen Peterssteig
Gedenkort für Mechthild von Magdeburg (1207/10-1282/94), Begine und Mystikerin
1315 Die Magdalenenkapelle wird
der Sage nach aufgrund eines Frevels an der geweihten Hostie (heiliger
Leichnam Jesu Christi), die an dieser Stelle nach einem Diebstahl
ausgeschüttet wurde, als Zeichen der Sühne errichtet und als
Fronleichnamskapelle bezeichnet.
1385 Die Kapelle wird an das benachbarte Kloster St. Mariae Magdalenae überantwortet. Seitdem trägt sie den Namen Magdalenenkapelle.
1631 Beim Stadtbrand wird die Kapelle erheblich beschädigt.
1846-1847 Die Kapelle wird vollständig restauriert, wobei Gewölbe eingebaut wurden.
1966-1969 Die Kapelle wird nach der Kriegszerstörung 1945 wieder hergestellt.
Ein Steildach in Anlehnung an das mittelalterliche Erscheinungsbild wird aufgebracht.
seit 1991 Das katholische Hilfswerk "Subsidiaris" nutzt die Kirche.

JAKOBSTRASSE
Das heutige Jakobsviertel, bestehend aus den alten Pfarreien St. Petri,
St. Jakobi sowie Teilen der Pfarreien St. Katharinen und St. Johannis,
wurde unter Einbeziehung des ehemaligen Fischerdorfes Frose um 1230
unter Erzbischof Albrecht von Kevernburg angelegt und besiedelt.
Prägendes Bauwerk war bis 1959 die größte Pfarrkirche Magdeburgs: die
um 1381-1438 neu errichtete dreischiffige Hallenkirche St. Jakobi. Das
besonders dicht bebaute Stadtviertel um St. Jakobi, im Volksmund
„Knattergebirge" genannt, war weniger durch prunkvolle Bürgerhäuser
geprägt, vermittelte jedoch mit den engen verwinkelten Gassen einen
besonders malerischen Anblick. Von den Zerstörungen am 16. Januar 1945
war das Jakobsviertel mit Ausnahme kleinerer Bereiche am Wallonerberg
vollständig betroffen. Die nach der Zerstörung noch in ihren
Umfassungsmauern weitgehend erhaltene Ruine der St. Jakobikirche an der
Jakobstraße wurde 1959 abgerissen.
Danach entstand in den Jahren 1961-1964 nach Wettbewerbsentwürfen von
G. Funk die Siedlung Jakobstraße als erstes altstädtisches Baugebiet
unter Anwendung typisierter Bauweisen (Großblock- und Plattenbau). Ohne
jegliche Anlehnung an die historische Straßenstruktur errichtete man in
aufgelockerter Bauweise fünfgeschossige sowie achtgeschossige
Wohnscheiben. Einbezogen wurden nur die randlich gelegenen Ruinen der
Johanniskirche, der Petrikirche, der Wallonerkirche und der
Magdalenenkapelle. Das Gebiet wurde 1968 durch drei Wohnscheiben am
Elbhang und 1974 durch das neunzehngeschossige Hochhaus in
Gleitbauweise an der Jakobstraße nach Entwürfen von W. Schmutzler und
G. Preil ergänzt.
Johanniskirche - Älteste
Magdeburger Pfarrkirche, Vorgängerbauten: 2 Saalkirchen der
Karolingerzeit, 1131 romanische Basilika, Westfront nach 1207, Langhaus
15. Jh., spätgotische Vorhalle 1453, Predigt Luthers 1524. Wiederaufbau
als Kulturzentrum.

Die Geschichte der Johanniskirche geht bis in das Jahr 941 zurück. Nach
dem großen Stadtbrand von 1188 entsteht mit dem Aufbau der beiden
Westtürme 1207 bis 1238 zum ersten Mal die später für Magdeburgs
Pfarrkirchen typische Doppelturmfront. Mit der Zerstörung Magdeburgs
1631 versinkt mit der Stadt auch ihre Bürgerkirche in Schutt und Asche.
Der Nachfolgebau wird erst 1670 eingeweiht. Aus der Innenausstattung
der Kirche ist die von Tobias Wilhelmi 1669 geschaffene barocke Kanzel
hervorzuheben, die leider den Bombardierungen Magdeburgs 1944 und 1945
zum Opfer fiel. Nur der Kanzelträger blieb erhalten. Nach dem Zweiten
Weltkrieg fungierte die stark beschädigte Johanniskirche als Denkmal.
Erst 46 Jahre nach der Zerstörung begann der Wiederaufbau. Seit 1999
ist die Johanniskirche wieder für die Öffentlichkeit zugänglich und
macht als außergewöhnlicher Konzert-, Fest- und Tagungsort von sich
Reden.
* * *
Der Magdeburger Bildhauer Heinrich Apel fertigte 1983 die Bronzetür mit
den Plastiken „Krieg“ und „Frieden“. Die Plastiken erinnern an die
beiden Zerstörungen Magdeburgs 1631 im Dreißigjährigen Krieg und 1945
im Zweiten Weltkrieg.
Davor: Skulptur „Mutter mit Kind" und „Trümmerfrau" 1982 von Heinrich Apel (1935-2020)

JOHANNISKIRCHE - älteste Magdeburger Pfarrkirche, spätromanisches
Westwerk, gotische Hallenkirche, Ruhestätte Otto von Guerickes, seit
1999 Kulturzentrum
941 Die Pfarrkirche wird
erstmalig als eine Volkskirche (plebejam ecclesiam) erwähnt, die im 12.
Jahrhundert dem Schutzheiligen St. Johannis (evangelista) gewidmet
wird.
1131 Mit dem Bau einer romanischen Basilika wird begonnen.
1238 Nach dem Niederbrand der
Kirche beginnt im Jahr 1207 der Wiederaufbau. Die Westtürme, die noch
bis zur Balustrade erhalten sind, werden errichtet und 1238
fertiggestellt. Deren Westfenster werden später noch einmal verändert.
1451 Nach einem Blitzeinschlag
brennt die Kirche erneut aus. Innerhalb weniger Jahre wird das
Kirchenschiff ab 1452 als spätgotische Hallenkirche wieder aufgebaut
und eine neue Vorhalle aus Werkstein 1453 errichtet.
1524 Martin Luther predigt in
der Johanniskirche (daher das Denkmal vor der Kirche), kurz darauf
treten fast alle Magdeburger Kirchengemeinden zum Protestantismus über.
Magdeburg wird eine der wichtigsten protestantischen Hochburgen
Deutschlands.
1631 Nach einem Turmeinsturz
1630 brennt die Johanniskirche beim großen Brand von Magdeburg 1631
vollständig aus. Erst 1662-1669 wird sie im wesentlichen in alter Form
vereinfacht wieder aufgebaut.
1672-1675 Die Turmspitzen
werden erneuert. In der Johanniskirche fanden berühmte Magdeburger
Patrizier ihre Ruhestätte, der Magdeburger Bürgermeister und
Naturforscher Otto von Guericke soll in der Familiengruft in der Kirche
beigesetzt sein, auch wenn das Grab nicht exakt nachweisbar ist; auch
ein Vertreter der Großen Französischen Revolution, General Lazare
Carnot, war zeitweilig hier beigesetzt.
1886 Ein von Emil Hundrieser gestaltetes Lutherdenkmal wird vor der Kirche errichtet.
1945 Das Kirchenschiff wird am
16. Januar 1945 beim Bombenangriff auf Magdeburg zerstört. Nach dem
Krieg werden die Reste des Kirchenbaus als Ruine gesichert.
1997-1999 Die Kirche wird als Kulturzentrum wieder aufgebaut.

Feurige Farben, flammendes Licht, großes Drama. Der renommierte
Künstler Max Uhlig hat mit der Gestaltung der sechs Langhaus- und
sieben Chorfenster in der Johanniskirche zwischen 2014 und 2017 ein
epochales Kunstwerk von Zerstörung und Neuanfang erschaffen, das weit
über die Elbestadt hinausstrahlt. Es gehört nach Anspruch und
räumlicher Dimension zu den größten Werken dieser Art in Deutschland,
die nach dem zweiten Weltkrieg entstanden. Initiiert wurde es vom
Magdeburger Kuratorium für den Wiederaufbau der Johanniskirche.
Uhligs Fenstergestaltung basiert auf zwei Themen, die für Uhligs Werke
grundlegend und immer wiederkehrend sind: Vegetation und Landschaft
erscheinen in stark abstrahierter Form. In den Langhausfenstern an der
Südseite erscheint Uhligs Komposition von tiefen Erd- zu leuchtenden
Gelb- und Grüntönen, durchsetzt mit flammendem Rot. Den Kontrast dazu
bilden die ganz in Schwarz gehaltenen Weinstöcke, die sich in den
Chorfenstern nach oben ranken. Der Betrachter ist eingeladen, sich der
Faszination hinzugeben und eine eigene freie Deutung zu finden. In den
intensiven feurigen Farben der Landschaft kann man aber auch die
Flammen sehen, die Magdeburg in der Vergangenheit mehrmals zerstörten.
In gleicher Weise stehen die stilisierten, in die Höhe wachsenden
Rebstöcke für neues Leben. Es ist für die Johanniskirche ein mehr als
passendes Werk: Als Ausgangspunkt der Reformation durch die Predigt
Martin Luthers am 26. Juni 1524 steht sie selbst als steinerner
Zeitzeuge unweigerlich für Erneuerung und Veränderung.

Johanniskirche Guericke-Gedenkstätte
1658 übernahm Otto von Guericke das Erbbegräbnis der Familie seiner
ersten Frau, Margarethe Alemann, in der damaligen Ratskirche. Neben
Guericke selbst (1686) wurden in der Alemann/Guericke-Gruft von 1658
bis 1704 weitere Familienmitglieder beigesetzt. 1674 wurden sowohl das
Stadt- als auch sein Familienwappen vom Bildhauer T. Wilhelmi gefertigt
und in der Kirche angebracht. Diese Würdigung erhielten nur wenige
Magdeburger. Seit 2000 erinnert eine Gedenkstätte an das Universalgenie
Otto von Guericke.

Ausblick von der Johanniskirche auf Rathaus und Alter Markt

Ausblick von der Johanniskirche auf Allee-Center Magdeburg und Dom zu Magdeburg

Ausblick von der Johanniskirche auf Neue Strombrücke, Zollbrücke, Königin-Editha-Brücke, Kaiser-Otto-Brücke
Am Schleinufer das Monument der Völkerfreundschaft

Ausblick von der Johanniskirche auf Jerusalembrücke und Jahrtausendturm Magdeburg

Dom St. Mauritius und Katharina zu Magdeburg, kurz Magdeburger Dom
Davor: Kunstmuseum Magdeburg - Kloster Unser Lieben Frauen

Hubbrücke Magdeburg über die Elbe und Magdeburger Dom

Die Sternbrücke über die Elbe
im südlichen Teil Magdeburgs am Flusskilometer 325,10 verbindet die
Altstadt mit der Elbinsel Rotehorn und dem dort befindlichen
Rotehornpark.

Wie auch die Ottostadt trägt die Hubbrücke eine bewegte Geschichte in
sich. Erbaut im Jahr 1848 als Teil der Magdeburger Hafenbahn, diente
sie ursprünglich dem wachsenden Güterverkehr zwischen dem
Industriehafen und den umliegenden Eisenbahnnetzen. Ein Meilenstein in
der Ingenieurskunst war der Umbau der Brücke im Jahr 1894, bei dem sie
zur Hubbrücke umgestaltet wurde. Diese Konstruktion ermöglichte es, den
mittleren Abschnitt der Brücke anzuheben, um Schiffen auf der Elbe eine
problemlose Durchfahrt zu gewähren. Der einzigartige Mechanismus machte
sie zu einer der modernsten Brücken ihrer Zeit und stärkte die
wirtschaftliche Bedeutung Magdeburgs als Verkehrsknotenpunkt.
Obwohl die Brücke im Laufe des 20. Jahrhunderts ihre ursprüngliche
Funktion verlor, blieb sie als bedeutendes Wahrzeichen erhalten. Nach
einer schweren Beschädigung im Zweiten Weltkrieg wurde sie restauriert
und steht heute unter Denkmalschutz. Eine umfassende Sanierung erfolgte
im Jahr 2013. Heute dient sie als beliebter Fuß- und Radweg, der einen
beeindruckenden Ausblick auf die Elbe und die Magdeburger Skyline
bietet. Die Brücke bleibt somit als ein Relikt industrieller Innovation
erhalten und erinnert an die Blütezeit des Hafenverkehrs in Magdeburg.

Dom zu Magdeburg - Protestantisches Gotteshaus und Deutschlands ältester gotischer Dom von 1520.

Das mdr Landesfunkhaus befindet sich am westlichen Ufer der Elbinsel,
von der aus sich ein Ausblick auf die Stadtsilhouette Magdeburgs
bietet. In unmittelbarer Nähe zur 1927 errichteten Stadthalle und dem
Messegelände setzt es damit die Tradition der kulturellen und
öffentlichkeitswirksamen Bauten an diesem Ort fort. Der
halbkreisförmige, dreigeschossige Büroring mit einer regelmäßigen
Lochfassade aus dunkelblau glasierten Klinkersteinen umfasst die sich
zur Stadt öffnenden Produktions- und Sendebereiche. Auf der Parkseite
erreicht man über eine Rampen- bzw. Treppenanlage den oberhalb des
Technikgeschosses liegenden Mitarbeitereingang zu den Büro-,
Redaktions- und Konferenzräumen.

Dieses Betonfragment war Teil der Mauer, die Berlin und Deutschland
teilte. 28 Jahre lang war sie Mittel und Zeichen der Unterdrückung.
Überwunden durch die friedliche Revolution in Ostdeutschland am 9.
November 1989, sind ihre Teile heute Symbol für die Kraft von Freiheit
und Selbstbestimmung - aber auch ein Mahnmal für deren immerwährende
Gefährdung.
Ein Geschenk von BILD an das Land Sachsen-Anhalt und die Stadt
Magdeburg zum 20. Jahrestag des Mauerfalls am 9. November 2009 - in
Erinnerung an den Zeitungsgründer Axel Springer (1912-1985), der gegen
alle Widerstände an seinem Traum von der Einheit Deutschlands festhielt.

Dom zu Magdeburg - Dom St. Mauritius und Katharina zu Magdeburg, kurz Magdeburger Dom

Dom zu Magdeburg - Dom St. Mauritius und Katharina zu Magdeburg, kurz Magdeburger Dom

Dom zu Magdeburg - Dom St. Mauritius und Katharina zu Magdeburg, kurz Magdeburger Dom

Dom zu Magdeburg - Dom St. Mauritius und Katharina zu Magdeburg, kurz Magdeburger Dom

Hundertwassers "Grüne Zitadelle" von Magdeburg

Alter Markt, Magdeburger Reiter, Rathaus der Landeshauptstadt Magdeburg

GALERIA Magdeburg am Breiter Weg

Hubbrücke Magdeburg - von soweit her bis hier hin

Opernhaus Magdeburg am Universitätsplatz: Freudig trete herein und froh entferne dich wieder


Wem der viele Text zu lange war und lieber Bewegtbilder mit Musik mag,
kann sich gerne dieses Video antun: