web steiner
Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen
Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.
+43/2624/54014 - office@websteiner.com
MAMUZ Schloss Asparn/Zaya
Asparn an der Zaya, September 2023
Im MAMUZ Schloss Asparn/Zaya
werden 40.000 Jahre Menschheitsgeschichte zu einem Erlebnis! Die
Ausstellungen und das archäologische Freigelände mit Nachbauten von
historischen Gebäuden lassen tief in unsere Entwicklung von der
Steinzeit bis ins Mittelalter blicken. Sonderschau 2023:
„Aufgezeichnet! Von der Höhlenmalerei zum modernen Comic“.

Vor etwa 70.000 Jahren lassen sich Menschen in Niederösterreich nieder und leben heute noch hier.
Während der letzten Eiszeit liegt ein dicker Eisschild über den Alpen
und dem heutigen Skandinavien. Dazwischen gibt es eisfreie Gebiete, wo
Pflanzen, Tiere und Menschen leben. Sie sind großen Klimaschwankungen
ausgesetzt. In Abschnitten mit gemäßigtem Klima breiten sich Wälder
aus, in kalten Perioden kann nur eine karge Tundrenvegetation
überleben. In Niederösterreich finden die Menschen jagdbare Tiere, wie
Mammuts, Wollnashörner, Rentiere, Wildpferde und Höhlenbären.
Unterstand suchen sie in Höhlen und bauen sich zeltartige Behausungen
im freien Gelände oder unter Felsdächern. Sie richten sich ein und
nutzen die vorgefundenen Bedingungen für ihr Überleben. Und sie suchen
nach Neuem und erweitern ihr Wissen. Ihre Erfahrungen überdauern durch
Kommunikation und Weitergabe von einer Generation an die nächste.
Wir stoßen heute auf die Spuren ihres längst vergangenen Alltags. Ihre
Werkzeuge, Waffen, Schmuck, Gräber machen uns zu Zeugen eines Lebens,
zu dem, wie heute, auch Freud und Leid gehören. Die Trauer um den Tod
zweier Säuglinge scheint in der pietätvollen Bestattung spürbar zu
sein. Dem steht das Rätsel um etwa hundert gewaltsam zu Tode gekommene
und scheinbar achtlos verscharrte Menschen gegenüber. Nicht nur Höhlen
bieten ein schützendes Dach über dem Kopf. Der Mensch nutzt die
vorhandenen Ressourcen von Anfang an und baut sie aus. Neben Wohnraum
in Höhlen baut er stabile Hütten im Freiland. Im Neolithikum werden
dann erstmals große Holzhäuser errichtet, die ersten Tiere gezüchtet
und Getreide angebaut. Die gedankliche Welt können wir heute nur
versuchen zu erahnen. Die riesigen Kreisgrabenanlagen, deren Funktion
für uns heute nicht ersichtlich ist, liefern uns Hinweise dafür. Sind
sie nach den Sternen ausgerichtete Versammlungsplätze, eine Art Tempel
oder doch Funktionsbauten?
Der Ackerbau und die Viehzucht bedeuten eine große Errungenschaft für
den Menschen. Etwa um 5.500 v. Chr. erreichen sie Mitteleuropa und
breiten sich langsam und kontinuierlich aus. Damit etablieren sich
Sesshaftigkeit, stabiler und langlebiger Hausbau sowie die
Keramik-Produktion. Der künstlerische Ausdruck scheint dem Menschen
seit vielen Jahrzehntausenden ein Bedürfnis zu sein. Allerdings wissen
wir heute nicht, welchen Stellenwert und welche Rolle die von uns als
Kunst interpretierten Objekte hatten. Die Kunst zu überleben, die Kunst
sich mit vorhandenen Gegebenheiten auseinanderzusetzen, sie zu nutzen
und weiterzuentwickeln, sind die Pfeiler, auf denen wir heute stehen.
Wir bauen auf diesen auf.

WENN MAUERN SPRECHEN KÖNNTEN. DER GASTGEBER SCHLOSS ASPARN/ZAYA ERZÄHLT VON SICH
Das Schloss Asparn steht wahrscheinlich auf einem ehemaligen Hausberg.
Urkundlich wird erstmals im Jahr 1108 ein Herr Poto de Asparn genannt.
Dieses Geschlecht wird als Begründer des kolportierten Hausberges
angenommen. 1286 soll Hademar III. von Sonnberg neben einer Holzburg
ein „prächtiges Schloss" erbaut haben.
In den folgenden Jahrhunderten wechselt das Schloss immer wieder seine
Besitzer. Reinprecht von Wallsee lässt 1421 neben anderen Umbauten die
beiden Ecktürme errichten. Von 1610 bis 1894 bleibt Schloss Asparn im
Besitz der Grafen Breuner, dann fällt es an das Haus Ratibor. Während
des 30-jährigen Krieges (1618-1648) wird es von den Schweden zerstört.
Neben Plünderungen und Abgaben leiden die Asparner zu dieser Zeit auch
unter der Pest. Ungefähr 30 Jahre später dokumentiert eine Zeichnung
das Schloss wieder als mächtigen Bau. Eine neuerliche Zerstörung
erfährt es mitsamt dem Ort im frühen 18. Jh. durch die ungarischen
Kuruzzen. Kurze Zeit später baut Max Ludwig Breuner das Schloss um. Im
frühen 19. Jh. wird ein Flügel des Schlosses geschleift, seither ist
der Innenhof zum Schlosspark hin geöffnet. Der Umbau, der die Funde aus
der Gewölbebeschüttung erbrachte, fand 2001/2002 für die damalige
Neugestaltung der Schausammlung statt. Seit 1964 in Pacht und seit 2010
im Besitz des Landes Niederösterreich, beherbergt das Schloss Asparn
das Museum für Urgeschichte. Ab 2014 werden hier anhand der Archäologie
Niederösterreichs 40.000 Jahre Menschheitsgeschichte erzählt.
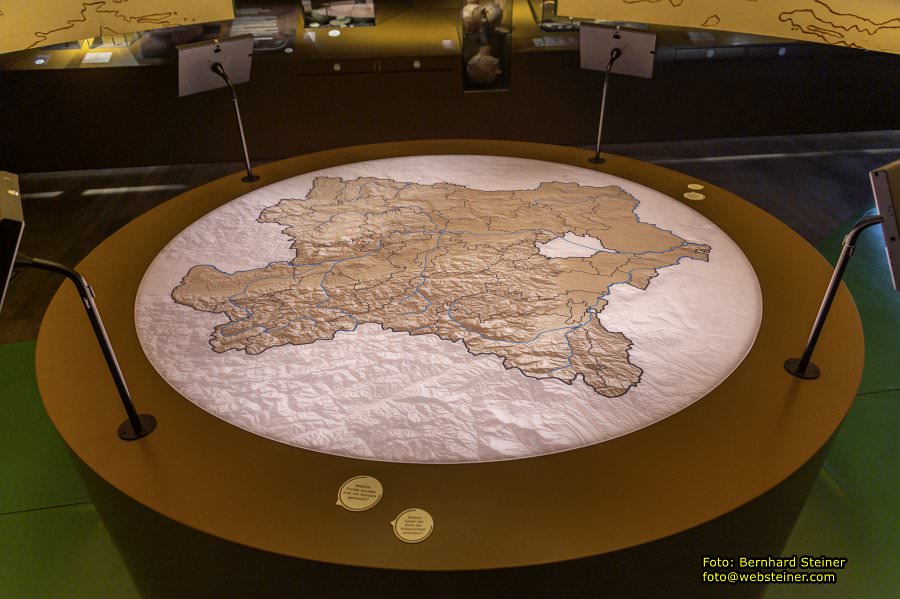
EINE KLEINE BEMALTE STATUETTE
Die Haut gelb, die Schürze ist aus schwarzen schräg gestellten Mäandern
aufgemalt. Die Haare, ebenfalls schwarz und gewellt, scheinen auch auf
Hals und Brust vorhanden zu sein. Ein roter Gürtel sitzt über dem
schwarzen Rock, unter der Brust eine große Doppelspirale. Ein kleiner
roter Punkt am Kopf wird auch als Schmuck gedeutet. Die Form des Kopfes
wirkt eher abstrakt, aufgesetzt auf einen sehr langen Hals.
AUS DEM NEOLITHIKUM
Solche Frauenstatuetten, bemalt und unbemalt, sind häufig in der mittleren Jungsteinzeit Niederösterreichs.
Meist kommen sie in Siedlungen vor. Daher weist ihr die Archäologie
gerne das Wesen eines Schutzsymboles für Haus und Hof, für Geborgenheit
zu.
WEIBLICHES IDOL VON FALKENSTEIN (moderne Replik), Fundort des Originals: Falkenstein (Bez. Mistelbach)
Kein Fund sieht heute noch so aus wie vor Tausenden von Jahren. Farben
verändern sich oder blättern ab. Diese neu geformte Replik der „Venus von Falkenstein" soll zeigen, wie die jungsteinzeitlichen Farben ursprünglich ausgesehen haben könnten.


Vom Stein zu Metall. Der Schritt ist zweifellos groß. Ohne Metall wären
keine effizienten Werkzeuge, keine wirksamen Waffen und erst recht
keine komplizierten Maschinen möglich. Aber es waren mehrere Schritte,
die am Ende zu dem führten, was wir in der Archäologie fassen. Wie es
sich abgespielt hat, versuchen wir aufgrund der archäologischen Funde
nachzuvollziehen. Wir kennen die ältesten Metallobjekte und beobachten
die schrittweise Entwicklung. Die einzelnen Epochen der Metallzeiten
sind nach den jeweils neuen Werkstoffen Kupferzeit (ca. 4000-2200
v.Chr.), Bronzezeit (ca. 2200-800 v.Chr.) und Eisenzeit (ca. 800-15
v.Chr.) benannt. Vermutlich breitete sich das metallurgische Wissen von
Vorderasien Über den Balkan nach Mitteleuropa aus.
Bereits in der vorangehenden Jungsteinzeit waren den Menschen
gediegenes Gold, Kupfer oder Eisen als seltene Materialien bekannt. Der
entscheidende Durchbruch war jedoch die Entdeckung, wie man reines
Kupfer aus Kupfererzen schmelzen konnte. In der Kupferzeit gelangen die
ersten Kupfergeräte nach Österreich. Sie stammen vermutlich aus
Südosteuropa. Jene Menschen, welche die Kunst der Kupfergewinnung
beherrschten, waren zweifellos gefragte Spezialisten. Das Kupfererz
wurde ab dem Beginn des 4. Jahrtausends v.Chr. in Bergwerken abgebaut.
Die Verarbeitung des Metalls führte auf Dauer zu einer Arbeitsteilung
innerhalb der Gesellschaft und zur Herausbildung von Berufen. Dennoch
dauert es fast zwei Jahrtausende, bis das weiche Kupfer von der
härteren Bronze abgelöst wird. Die Bronzezeit definiert sich durch eine
neue Entdeckung: die Legierung von Kupfer mit Zinn, wodurch Bronze
entsteht. Die handwerkliche und künstlerische Bronzetechnologle
steigert sich zur Perfektion. Dieser Werkstoff lässt sich leichter
gießen, besser schmieden und einfacher härten. So entstehen in der
Bronzezeit prächtige Schmuckformen, bessere Werkzeuge und völlig neue
Waffen.
Weiträumige Kontakte sind notwendig, um den hohen Bedarf an Rohstoff zu
decken. Die Erze sind ja nicht so einfach verfügbar, vor allem
Zinnlagerstätten sind selten. Am Ende der Bronzezeit und am Beginn der Eisenzeit
scheint das hohe Niveau der Bronzeverarbeitung schon fast Routine zu
sein. Zusätzlich kommt ein neues Material ins Spiel, das Eisen. Wie bei
der Bronze breitet sich auch das Wissen um die Eisenverhüttung zu
Beginn des 1. Jahrtausends v.Chr. aus dem Nahen Osten nach Mitteleuropa
aus. Schnell erreicht man auch damit höchstes handwerkliches und
künstlerisches Niveau. Von den ersten Kupferbeilen der Kupferzeit zu
den fein verzierten Kunstwerken der Kelten in der jüngeren Eisenzeit
vergehen einige Jahrtausende. Aber jedes Stück auf diesem Weg stellt
einen Meilenstein der Geschichte dar.

HAUSRAT IN SCHUTT UND ASCHE
Fundort: Kleiner Anzingerberg (Bez. Krems-Land), Datierung: ca. 2900 v. Chr.
SCHMUCK - Perlen wurden aus den unterschiedlichsten Materialien hergestellt.
TEXTILHERSTELLUNG - Die Spinnwirtel belegen die Herstellung von Fäden
auf Handspindeln. Die Webgewichte dienen zum Spannen der Kettfäden auf
einem Gewichtswebstuhl.
MUSCHELN UND SCHNECKEN - EINE DELIKATESSE - Wo sich Gewässer in der
Nähe befanden, wurden Flussmuscheln gesammelt. Auch Schnecken waren in
der Jungsteinzeit und Kupferzeit beliebte Delikatessen.
KNOCHEN- UND GEWEIHGERÄTE - Aus Tierknochen und Hirschgeweihen wurden
Geräte für viele Zwecke hergestellt: Spitzen zum Durchstechen von Leder
oder Rinde, Spateln zum Glätten von Leder, Meißel für feine
Holzarbeiten, Äxte zum Holzfällen und Hacken zur Bodenbearbeitung.
KERAMIKGEFÄSSE - Die Keramik der Jevišovice-Kultur ist häufig mit
Kerbleisten und Einstichen verziert. Auch die flächige Bemalung mit
Graphit ist üblich und verlieh den Gefäßen einen metallischen Glanz.

IN DER KUPFERZEIT: VERBRENNUNG DER TOTEN NEBEN GRÄBERN MIT SKELETTEN
Ihre Gefäße haben die Form einer auf den Kopf gestellten Glocke. Die
Archäologie nennt sie „Glockenbecherkultur". Ihr Verbreitungsgebiet
liegt von Marokko bis Polen, von Schottland bis Sizilien. Ihre
Hinterlassenschaften stammen sehr selten aus Siedlungen, vor allem aus
Gräbern. Beide Grabsitten, sowohl die der Körperbestattung als auch die
der Verbrennung, kommen nebeneinander vor. Neben dem typischen
Glockenbecher gehören Feuersteinpfeilspitzen, Armschutzplatten, oft
Kupferdolche zum Grabinventar der Männer. Die Frauengräber enthalten
neben Bernsteinobjekten oft Stirnbänder aus Kupfer, Silber und Gold.
Woher kommt diese neue und weiträumige Kultur? Das ist eine viel
diskutierte und bis heute unbeantwortete Frage. Von einem fremden
nomadisierenden „Volk (von) Bogenschützen" bis zu einer „einheimischen"
Kultur reichen die Meinungen. In Lichtenwörth, Wr. Neustadt, birgt eine
Grube acht Tote. Fünf Erwachsene und drei Kinder, 4, 5 und 8 Jahre alt,
deren Körper zum Teil übereinander liegen. Die Todesumstände sind
unbekannt. Zwei Äxte, fünf Pfeilspitzen, drei vollständige
Ösenhalsreifen und vier Fragmente befinden sich im Grab. Die
Ösenhalsreifen aus Kupfer sind Boten des neuen Werkstoffes Kupfer.
DOPPELBESTATTUNG ZWEIER KINDER
Sterbealter: 2 und 6 Jahre, Fundort: Unterhautzental (Bez. Korneuburg), Datierung: ca. 2200 bis 1550 v. Chr.
ZWEI KINDER IM GRAB, IN LIEBEVOLLER UMARMUNG
Die Siedlung Unterhautzental liegt bei Stockerau auf einem nach Süden
ausgerichteten Hang. Der Friedhof zur Siedlung enthielt einst
wahrscheinlich etwa 50 Gräber, 42 davon können noch geborgen werden.
Einige Tote liegen in Holzsärgen, in einem Fall, sogar in einem
Baumsarg. Die Bestatteten sind in ihrer Tracht niedergelegt, auf ihrer
rechten Seite in Hockerposition. An Beigaben erhalten sie Gefäße,
wahrscheinlich einst gefüllt mit Speisen und Getränken und
Fleischportionen von Hausschwein, Hausrind und Schaf. In einer kleinen
Grabgruppe am Rande der Siedlung werden auch zwei Kinder in äußerst
liebevoller Weise bestattet. Ein zweijähriges und ein ca.
siebenjähriges Kind liegen einander zugewandt in Hockerlage in einem
Grab. Die beiden Kinder scheinen sich an Schultern und Oberarmen
festzuhalten, sich zu umarmen. Die Todesursache ist unbekannt, die
Verletzung am Schädel des älteren Kindes könnte aber ein Hinweis sein.

BRONZEZEITLICHE WAFFEN
GRIFFPLATTENSCHWERT - Von der Länge her handelt es sich um eine
Übergangsform zwischen Langdolch und Kurzschwert. Fundort:
Vorder-Hainbach (Wien 14.), Datierung: ca. 1550 bis 1400 v. Chr.
VOLLGRIFFSCHWERT - Der Griffteil wurde in einem komplizierten
Gussverfahren separat an die Schwertklinge angegossen. Fundort: Ybbs an
der Donau (Bez. Melk), Datierung: ca. 1250 bis 1050 v. Chr.
ANTENNENGRIFFSCHWERT
GRIFFDORNMESSER MIT VERZIERTER KLINGE - Das Schwert wurde zusammen mit
dem Griffdornmesser gefunden, wahrscheinlich handelt es sich um eine
Deponierung oder um Grabbeigaben. Fundort: Leopoldsberg (Wien 19.),
Datierung: ca. 1050 bis 900 v. Chr.

AUFBRUCHSTIMMUNG IN DER SPÄTBRONZEZEIT?
Die Landwirtschaft bleibt unverändert die Lebensgrundlage, wie in den
vorangegangenen Abschnitten. Ein Anwachsen der Bevölkerung benötigt
aber neue Strukturen und Organisationen. Neue Gebiete, bis dahin
unbewohnt, werden jetzt erschlossen. Im offenen Flachland breiten sich
große Dörfer aus. Lange hallenartige Wohnhäuser, kleine Bauten für
Handwerker und Speicher in Pfostenbauweise verteilen sich über die
Siedlung. Diese großen bäuerlichen Dörfer sind vermutlich imstande,
mehr als ihre eigenen Gemeinschaften zu ernähren. Dies ermöglicht eine
gewisse Arbeitsteilung und Spezialisierung in der Gesellschaft. Von
zentraler Bedeutung sind die Ortschaften auf den Anhöhen.
Strategisch günstige Plätze, immer natürlich geschützt, werden mit
starken Wällen befestigt und mit Toranlagen versehen. Auf den Wällen
steigern oft noch zusätzliche Palisadenreihen das Gefühl der
Sicherheit. Unruhige Zeiten scheinen solche Maßnahmen zu fordern. Auf
der anderen Seite formen sich auch Kommunikationsnetze mit einem Fluss
von Wissen und Waren. Die große befestigte Höhensiedlung Schanzberg bel
Thunau am Kamp im Waldviertel liegt auf einem Höhenrücken mit gutem
Überblick über das umliegende Land. Ein steiler Abbruch sichert das
Gelände im Osten und Süden, ein mächtiger Wall schützt an den anderen
Seiten. Über zwei Tore ist die Siedlung zu betreten. In den Wohnhäusern
garantieren Backöfen, Webstühle, Vorratsgruben und Kellerbereiche die
Versorgung im Alltag. Gussformen aus Stein und Ton belegen sogar eine
Bronzeverarbeitung in der Siedlung.
Eine Brandkatastrophe lässt die Bewohner und Bewohnerinnen all das
aufgeben. Im Hanghaus 01 erhält sich durch den Brand ein Teil des
Hausinventars in Originallage. In der Hausecke im Inneren bleibt eine
Herdplatte erhalten, an der Außenwand der Rest eines Backofens.
Zahlreiche Gefäße beim Herd bilden das Spektrum von Behältern in einem
spätbronzezeitlichen Haushalt ab. Sogar eine Reibplatte mit Reibstein
zum Mahlen von Getreide lehnt noch an der Hauswand. Durch den Brand ist
auch Getreide verkohlt, das uns wertvolle Informationen über den
spätbronzezeitlichen Ackerbau liefert. Gerste dominiert neben Emmer,
Einkorn, Dinkel, Nacktweizen und Rispenhirse. Zu den bereits bekannten
eiweißhaltigen Pflanzen Erbse und Linse gesellen sich jetzt Ackerbohne
und Linsenwicke. Leindotter und Mohn dienen als wichtige Quelle
pflanzlicher Fette. Wo sind die Menschen wohl hingezogen, nachdem sie
Haus und Hof überstürzt verlassen mussten?

DAS PHANOMEN DEPOTFUND
Die Deponierungen werden als Teil des Lebens und des
Gemeinschaftsempfindens gedeutet. Das Vergraben in der Nähe oder sogar
in Siedlungen scheint diese Interpretation zu stützen. Die
unterschiedlichen Zusammensetzungen der Depots könnten dabei die
möglichen Motivationen und Hintergründe für die Deponierung ausdrücken.
Mit den Gefäßdepots werden in erster Linie Speise- und Trankopfer
verbunden, mit einer anschließenden „Entsorgung" der Gefäße. Diese Art
von Opferungen wird oft von Ackerbaukulturen gepflegt, im Rahmen von
zyklisch wiederkehrenden Jahresereignissen. Auch hinter den sogenannten
Metallwertdepots werden rituelle Handlungen vermutet. Vielleicht sollte
der Erde symbolisch ein Teil von dem zurückgegeben werden, was ihr
vorher aus den Bergwerken „geraubt" worden war.
Trotzdem sind manche Depots auch als reine Materiallager oder
vielleicht sogar Verstecke in Betracht zu ziehen. Merkwürdig aber, dass
diese Lager in vielen Fällen nicht mehr abgeholt werden. Die
sogenannten Ausstattungsdepots verfolgen vielleicht ähnliche Ziele wie
die Metallwertdepots. Dabei könnte man bei einigen Ausstattungsdepots
und den Schmuckdepots auch an verstecktes „Familiensilber" denken. Ein
Depot vereint alle Elemente der archäologischen Erforschung vergangener
Kulturen in sich. Es enthält den sakralen Aspekt der Bestattung, den
profanen Aspekt des Alltags, den technischen Aspekt des Handwerks, auch
wenn der Grund für die Deponierung oft nicht eindeutig ist.

NUR DAS BESTE GUT GENUG FÜR DIE REISE INS JENSEITS?
Die Archäologie versucht Alltag, Leben und Sterben anhand von Dingen
nachzuzeichnen, die sich bis heute erhalten haben. Die meisten und am
besten erhaltenen Objekte stammen dabei aus Gräbern. Oft wird
angenommen, dass die Grabausstattungen eine soziale Ordnung abbilden,
dass sie wie ein „Spiegel" des Lebens wirken. Sie sollen nicht nur den
Reichtum oder die Armut der Toten zu Lebzeiten, sondern auch ihren
Status in der Gemeinschaft verdeutlichen. Die Gedankenwelt der
Gesellschaft verraten die Gräber zwar nicht, aber sie bezeugen Sitten
im Umgang mit dem Tod. Welche Änderung in der Vorstellungswelt bedeuten
die Verbrennung der Toten auf einem Scheiterhaufen und die Bestattung
der Überreste in Urnen? Die Ausbreitung dieses Brauches ist bald über
weite Teile des heutigen Mitteleuropas zu beobachten. Die Archäologie
nennt diesen Abschnitt der Bronzezeit auch Urnenfelderzeit.
Warum und von wo startet dieser Grabbrauch? Warum wird der Leichnam
„vernichtet"? Auf welche Weise breitet sich diese Bestattungssitte aus?
Vielleicht ist es Ausdruck eines Kommunikationsnetzes, das auch für die
Verbreitung der Rohstoffe Kupfer und Zinn angenommen wird. Der Leichnam
wird vermutlich in seiner besten Kleidung, mit dem Schmuck, den Waffen
aus Bronze und anderen persönlichen Dingen auf dem Scheiterhaufen
verbrannt, die Überreste bestattet. Aber oft liegen im Grab auch
unverbrannte Gegenstände aus Bronze neben ganzen Serien von Gefäßen,
die ebenfalls nicht im Feuer lagen. Dabei wissen wir nicht, wessen
Eigentum die Objekte in den Gräbern sind: Gehörten sie den Bestatteten
oder den Hinterbliebenen?
Auch wenn wir die Lebensanschauung hinter den Grabbräuchen nicht
kennen, versuchen wir die Menschen zu sehen und ihre Trauer zu erahnen.
„Sich Mühe machen um ein Begräbnis,
eine würdige Beerdigung, einen großartigen Leichenzug zu haben: All
dies ist mehr zum Trost der Lebenden als von Nutzen für die Toten."
Augustinus von Hippo, 354-430, Bischof von Hippo Regius, im heutigen Algerien

MÄCHTIGE HÜGEL PRÄGEN DIE LANDSCHAFT DES WEINVIERTELS
Es sind Grabstätten, die seit etwa 2.500 Jahren an die Toten erinnern,
die unter ihnen bestattet sind. In der älteren Eisenzeit, der
Hallstattzeit, sind die Grabsitten vielfältig. Die Toten werden unter
einem Hügel oder in einem Flachgrab bestattet. In Niederösterreich ist
die Verbrennung der Toten, gemeinsam mit Schmuck, Waffen und
Werkzeugen, üblich. Die Ausstattung mit Trink- und Speisegeschirr ist
von großer Bedeutung. Dient sie für das letzte Festmahl im Diesseits
oder für die Versorgung im Jenseits? Beeindruckend sind die mächtigen
Hügelgräber, einzeln oder in Dreiergruppen, wie in Gemeinlebarn,
Bernhardsthal, Rabensburg, Oberweiden. Das größte unter ihnen ist der
Großmugi, 14 m hoch und 46 m im Durchmesser. Er steht jetzt allein, war
ursprünglich aber auch Teil einer kleinen Gruppe, die heute leider
eingeebnet und nur mehr im Luftbild als Umriss zu sehen ist. In
Absdorf, Gaisruck, Niederhollabrunn, Niederfellabrunn stehen die
einzelnen imposanten Hügel auf einer Geländeerhebung und wirken dadurch
noch majestätischer.
„LEBERN" ODER „LEWARN" BEDEUTET ERDHÜGEL
Der „Ort, wo Grabhügel sind" wird Langenlebarn im Jahr 836 n. Chr. in
einer Urkunde genannt. Die Grabhügel stammen aus der Hallstattzeit.
Einer davon, der Tumulus 3, enthält eine große Grabkammer aus Holz mit
einem reichen Trink- und Speiseservice. Fast genau in der Mitte des
Grabes wurden die verbrannten Knochenreste des Tofen, ursprünglich wohl
in einem Holzkistchen niedergelegt. Mindestens sieben Tonfiguren
begleiten den Verstorbenen, drei davon zur Hälfte schwarz und rot
bemalt. Wie diese Figuren sind wohl auch die Reiterfigur und das Gefäß
mit aufgesetzten Stierköpfen Ausdruck der Zeremonien bei diesem
prunkvollen Begräbnis.



AUFGEZEICHNET. VON DER HÖHLENMALEREI ZUM MODERNEN COMIC
Wussten Sie, dass die steinzeitliche Höhlenmalerei auch als Vorgänger
unserer Comics gilt? Urgeschichte und Archäologie faszinieren bis heute
viele Menschen, deshalb gab es immer auch eine populäre Aufarbeitung in
Bildgeschichten und Illustrationen. Tatsächlich gibt es
altsteinzeitliche Darstellungen, die offenbar karikaturhaften Charakter
besitzen. Die meisten Höhlenbilder lassen sich aber wohl mit
religiös-magischen Vorstellungen und Zeremonien verbinden Die
dargestellten Tiere und Fabelwesen bevölkerten sicherlich auch die
Geschichten, die man sich am Lagerfeuer erzählte. Gute Erzählungen
begeistern uns Menschen aber immer noch nicht nur am Lagerfeuer. Stoff
für gute, satirische Geschichten und Karikaturen bieten auch unsere
Vorstellungen vom Lebensalltag unserer Vorfahren und von der Arbeit der
Archäolog:innen. Es geht aber keineswegs darum, bloß zu spotten - sie
sind ein Mittel, die gängige Praxis und Interpretation humorvoll zu
hinterfragen. Wissenschaftscomics und archäologische Zeichnungen sind
wichtige Ausdrucksmittel der Forschung und Vermittlung.


DIE STÄDTE BILDUNG, HANDWERK, FORTSCHRITT, HUNGER, KRANKHEIT
Im 12. Jh. kommt es zu einem starken Anstieg der Bevölkerungszahl, es
entwickeln sich größere Siedlungen mit städtischem Charakter. Sie
liegen meist an wichtigen Verkehrswegen, wie etwa der Donau, sowie an
Verkehrsknotenpunkten. Beispiele für Städte aus dieser Zeit sind Tulin,
Wien oder Krems, die bereits in der Römerzeit eine wichtige Stellung
eingenommen hatten. Um 1200 erhalten nach und nach auch abgelegene
Siedlungen wie etwa Zwettl ein städtisches Gepräge. Im 13. Jh. kommt es
zu einem weiteren Aufschwung der Städte. Besonders die größeren
landesfürstlichen Zentren gewinnen zunehmend an Selbstständigkeit. Zu
nennen sind hier etwa Wien, Wiener Neustadt, Krems und Tulin. 1365
gründet Rudolf der IV. die Universität Wien. Bevor Universitäten und
Privatschulen aufkamen, war das Bildungswesen von der Kirche getragen
worden.
Die Städte sind also Zentren für Bildung und Kultur, aber auch für
Handel und Geldwirtschaft. Gemeinsam mit der steigenden Produktion und
der wachsenden Spezialisierung der Handwerke bringt das Aufblühen der
Städte gute Absatzmärkte mit sich. Besonders ab dem 13. Jh.
organisieren sich die freien Handwerker in Zünften, in Österreich
Zechen genannt. Es herrscht Beitrittspflicht, wobei die Anzahl der
Meister beschränkt bleibt. Als rechtliche Grundlage gilt die
Zunftordnung, die Rechte und Pflichten der Mitglieder regelt, wie die
Unterstützung kranker Mitglieder. Die Vertreter der Zünfte
konzentrieren sich oft in gewissen Straßen und Vierteln, die auch nach
ihnen benannt werden. Auf der anderen Seite hat die große
Bevölkerungskonzentration auch negative Auswirkungen: Seuchen breiten
sich in den Städten aus. Die medizinische Versorgung ist gering,
teilweise werden Kranke in Quarantäne genommen. Im besten Fall erfolgt
eine Behandlung, Hilfe erhofft man sich besonders durch das Gebet als
auch durch abergläubische Handlungen.
Anfang des 14. Jhs. kommt es in weiten Teilen Europas zu einer fast
zwanzig Jahre währenden Hungersnot. Durch die weltweiten
Handelsbeziehungen eingeschleppt, verbreitet sich die Pest über ganz
Europa. Sie wütet zwischen 1347 und 1353, ungefähr 25 Millionen
Menschen sterben. Das ist ein Drittel der damaligen Bevölkerung
Europas. Aber es beginnt auch eine Zelt der Aufbrüche und der
wissenschaftlichen und künstlerischen Fortschritte. Die Erfindung des
modernen Buchdrucks durch Gutenberg in der Mitte des 15. Jhs. gilt als
eine der Errungenschaften, die mit dem Übergang vom Mittelalter in die
Neuzeit verbunden werden. Die Renaissance führt zu einer Wiederbelebung
antiker kultureller Errungenschaften; im Humanismus spiegelt sich die
veränderte Auffassung des Menschen wieder. Die großen
Entdeckungsfahrten bringen neue naturwissenschaftliche und geografische
Erkenntnisse und damit verbunden die Nutzbarkeit neuer Handelswege.

ÜBERLIEFERN MIT UND OHNE SCHRIFT
Viele Tausende von Jahren geschieht Weitergabe von kulturellem Wissen
über mündlichen Austausch. Wahrscheinlich oft über Symbole, die nur
Eingeweihte verstehen und deuten können. Viele Völker schreiben nichts
über sich selbst nieder. Wir erfahren von ihrer Existenz aus
Schriftquellen von Kulturen, die über
sie schreiben. Diese Berichte sind natürlich subjektiv, teils
wurden sie gar mit einer besonderen Absicht, etwa zu Propagandazwecken,
verfasst. So sind die Darstellungen oft wohlgesinnt wohlgesinnt
gegenüber gegenüber Freunden, Freunden, abwertend gegenüber Gegnern.
In die Gebiete nördlich der Alpen kommt die Schrift erst mit den
Römern. Inschriften auf Grabsteinen, Bauinschriften und Meilensteine
zeugen davon. Im Laufe des Frühmittelalters und mit der
fortschreitenden Christianisierung werden Klöster zu Zentren der
Schriftkultur. In den Scriptorien vervielfältigen Mönche Schriften und
Bücher und füllen damit die Bibliotheken der Klöster. Lebensgeschichten
von Heiligen sind etwa aussagekräftige Dokumente dieser Zeit. Lange
Zeit sind es nur wenige, die lesen und schreiben können.
Schriftkundigkeit bedeutet auch Macht. Zugang zu Bildung und damit zu
Unterricht in Lese- und Schreibkunst war lange Zeit vor allem dem
Nachwuchs der Kirche, den Novizen in den Klöstern zugänglich.
Die karolingische Bildungsreform Karls des Großen bringt kulturellen
Aufschwung. Die sogenannte „karolingische Minuskel", eine Erneuerung
der Schriftart, breitet sich ab der Zeit um die Mitte des 8. Jhs. von
der Hofschule Karls des Großen aus. Im Verlauf des Mittelalters werden
in den Städten Domschulen und schließlich private Schulen und
Universitäten gegründet. Es kommt zu einem Anstieg des allgemeinen
Bildungsgrades. Mit der Einrichtung der Unterrichtspflicht unter Maria
Theresia 1774 wird Schulbildung einer größeren Anzahl von Kindern
zugänglich. Trotzdem werden Teile der Bevölkerung, wie Mädchen und
Arme, noch immer von Bildung ferngehalten. ferngehalten.

DER RÖMISCHE LIMES - 5.500 KM GRENZE
Entlang der römischen Grenze - hier symbolisiert durch die Palisade aus
Holz - existierten rege Handelsbeziehungen zwischen dem Süden und dem
Norden, angedeutet durch die roten Bänder. Mit dem Limes markieren und
sichern die Römer die Außengrenzen ihres Reiches. Seine Gestaltung
richtet sich nach den örtlichen Bedingungen. Einzelne Kastelle und
Wachttürme bis zu durchgehende Steinmauern, wie der Hadrianswall in
Großbritannien, sichern und schützen die Grenze. Große Flüsse wie Donau
und Rhein werden als natürliche Grenze genutzt.
Das Königreich Noricum wird im Jahr 15 v. Chr., unter Kaiser Augustus,
Teil des Römischen Reiches. Zur römischen Provinz wird es 45 n. Chr.
unter Kaiser Claudius. Zu dieser Provinz gehören Niederösterreich,
Kärnten, Salzburg, Oberösterreich, Steiermark und Teile Tirols im
heutigen Österreich. Im heutigen Nieder- und Oberösterreich bildet der
norische Limesabschnitt vom 1. bis zum 5. Jh. n. Chr. einen Teil der
nördlichen Grenze des Römischen Reiches. Er verläuft die Donau entlang
von Passau (Batava) bis Zeiselmauer (Cannabiaca). Östlich liegt die
Provinz Pannonien. Der Limes an der Donau wird nach und nach durch
verschiedene Befestigungsanlagen gesichert. Erste Holzkastelle mit
Palisaden, Erdwällen und Gräben werden im fortschreitenden 1. Jh. n.
Chr. errichtet. Im frühen 2. Jh. n. Chr. kommen weitere Kastelle dazu,
einige Lager werden in Steinbauweise ausgebaut. Während der
Markomannenkriege, von 166-180 n. Chr., wird der norische Limes weiter
verstärkt.
Unter Kaiser Trajan (98 bis 117 n. Chr.) findet das Imperium Romanum
seine größte Ausdehnung. Der Limes hat eine Länge von ca. 5.500 km. Am
Ende des 2. Jhs. n. Chr. findet der Umbau von Holz-Erde-Lagern zu
Steinkastellen am norischen und pannonischen Limes statt. Im 4. Jh. n.
Chr. schließlich schwächt eine Heeresreform die Grenzheere in den
Provinzen. Die Kastelle an den Grenzen werden in der Folge von reinen
Militäranlagen auch zu zivilen Städten. Es kommt zu einer Bauoffensive;
viele Kastelle werden massiv verstärkt. In Mautern, Traismauer, Tulln,
Zeiselmauer werden Ecktürme und Zwischentürme zu Fächer- und
Hufeisentürmen umgebaut. Bürgerkriege innerhalb des Imperiums und ins
Reich drängende Völker aus dem Norden und dem Osten erschüttern Rom ab
der Mitte des 4. Jhs. Spezielle Truppen sichern jetzt die Grenzen, die
reguläre Armee wird in das Landesinnere verlegt. Die Anlagen werden zu
Restkastellen verkleinert. Die Soldaten leben mit ihren Angehörigen
innerhalb der Militäranlagen, die Zivilsiedlungen rund um die Lager
werden aufgegeben. 395 n. Chr. kommt es zur Teilung in ein Ost- und
Weströmisches Reich. Diese politischen Umstellungen führen in der
Provinz Noricum zu wirtschaftlichen Krisen. Die militärische Sicherung
der nördlichen Reichsgrenzen wird unmöglich. Verschiedene Völker
belagern, plündern und zerstören die Limesorte an der Donau. Das Jahr
476 bringt das Ende des Weströmischen Reiches. Im Jahr 488 zieht ein
Teil der romanischen Bevölkerung, vor allem die wirtschaftliche,
politische und militärische Elite, aus der Provinz Ufernoricum nach
Italien ab. Die nicht abgewanderten Bevölkerungsgruppen richten sich
mit den germanischen Zuwanderern ein.

TONGEFÄSSE AUS HÜGELGRÄBERN
Die Grabzusammenhänge sind nicht überliefert. Die Gefäße zeigen lokale und römische Einflüsse.
Fundort: Niederhausleithen (Bez. Amstetten), Datierung: ca. O bis 150 n. Chr.
GESICHTSURNE - Einzigartiges Gefäß mit Gesicht und drei aufgesetzten Nebengefäßen.

BARBARICUM NENNEN DIE RÖMER DIE GEBIETE AUSSERHALB IHRES REICHES
Der Begriff Barbaricum geht auf die Griechen zurück, die alle nicht
Griechisch Sprechenden als bárbaroi bezeichneten. Die Römer übernehmen
diesen Ausdruck und nennen die Gebiete östlich des Rheins und nördlich
der Donau, außerhalb des Römischen Reiches, Barbaricum. Unter Kaiser
Augustus, dem ersten Kaiser Roms, werden diese Gebiete zur römischen
Provinz Germania. Auch die Markomannen unter ihrem König Marbod im
heutigen Böhmen siedeln in diesem Gebiet. Mit der Niederlage in der
Varusschlacht 9 n. Chr. muss dieses expansive Vorhaben fallengelassen
werden. Kaiser Augustus beschränkt sich jetzt auf die Stabilisierung
bestehender Grenzen. Ein reger Austausch zwischen dem Barbaricum und
dem Römischen Reich ist zum Vorteil für beide. Römer, Germanen und
Angehörige anderer Völker gehen ihren Geschäften nach und reisen
zwischen dem Römischen Reich und dem Barbaricum hin und her.
DER LIMES, EINE DURCHLÄSSIGE „GRENZE" ZUR KONTROLLE DES GRENZVERKEHRS
Der Limes stellt weniger eine durchgehende Mauer oder Trennlinie als
vielmehr ein System der Überwachung und Kontrolle der Grenzen des
Reiches dar. Die Verbindungen zwischen den Wachposten dienen auch der
schnellen Nachrichtenübermittlung. Reger Austausch und Verkehr mit
Waren aller Art über den Limes hinweg findet statt. Rom beobachtet das
Geschehen, nimmt Steuern ein, reguliert aber auch den Zuzug von
Völkerschaften. Germanische Völker aus dem Norden und Völkerverbände
aus dem Osten drängen im Laufe der Jahrhunderte ins Römische Reich. Im
fortgeschrittenen 4. Jh. n. Chr. nehmen kriegerische Einfälle
germanischer Gruppen zu. Gleichzeitig werden Germanen immer mehr in die
spätrömische Militärorganisation integriert und auf Reichsgebiet oder
in der Grenzzone angesiedelt..
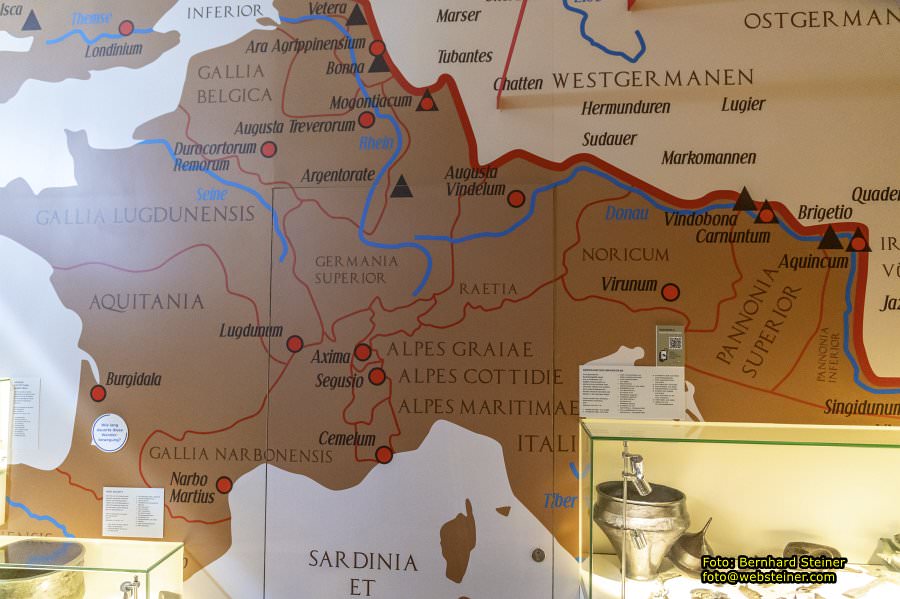
GERMANISCHE PRÄSENZ IN NIEDERÖSTERREICH NÖRDLICH DER DONAU IM 1. JH. N. CHR.
Die früheste Präsenz von Germanen in Niederösterreich fällt in die
Regierungszeit von Tiberius (14-37 n. Chr.) und Claudius (41-54 n.
Chr.). Die germanischen Markomannen unter ihrem König Marbod kommen vom
main-fränkischen Raum kurz vor Christi Geburt ins heutige Böhmen. Die
Quaden lassen sich in den Gebieten östlich davon nieder. Marbod wird
vom Stammesadeligen Catualda gestürzt, der bald darauf selbst
vertrieben wird. Kaiser Tiberius siedelt die Gefolgschaften Marbods und
Catualdas im Gebiet zwischen Waag und March neu an. Er unterstellt sie
Vannius, dem romfreundlichen König der Quaden.
Die frühe Anwesenheit der Germanen in Niederösterreich ist
archäologisch anhand ihrer Gräber nachzuweisen. Aus der 1. Hälfte des
1. Jhs. stammt das älteste bis jetzt bekannte germanische Brandgrab
Niederösterreichs, gefunden in Mannersdorf/March. Die verbrannten
Überreste des Toten und seine Ausstattung werden in einen Bronzekessel
gelegt, die Waffen vorher unbrauchbar gemacht. Reste eines Trinkhornes,
Kasserollen und Bronzegefäße aus rätischen oder norischen Werkstätten
weisen den Bestatteten einer sozialen Oberschicht mit weiträumigen
Kontakten zu. Eine Körperbestattung einer 35-45-jährigen Frau aus
derselben Zeit wurde in Baumgarten/March entdeckt. Diese mag mit dem
quadischen Vanniusreich zu verbinden sein. Besonders erwähnenswert sind
die Bestandteile eines norischen Gürtels. Ein Spiegel aus Silber stellt
aufgrund seines Materials eine Seltenheit dar. Das Marchtal dient
einmal mehr als wichtiger Verkehrsweg von der römischen Provinz nach
Norden.

ΕΙΝ ΚΟΜMEN UND GEHEN - MIT UND OHNE GEWALT
Die dynamische Wanderschaft der Völker auf (dem heutigen)
niederösterreichischem Territorium wird durch die keilförmig in den
Raum ragenden Gestaltungselemente verdeutlicht: Auch hier basieren die
Wandgrafiken auf ausgewählten Fundstücken aus der Frühgeschichte
Niederösterreichs. Um 375 n. Chr. löst der Druck der Hunnen in Richtung
Westen die große Völkerwanderung" aus. Der Grund dafür ist nicht
gesichert. Eine mögliche Erklärung wird in einer starken Klimaänderung
gesehen, die viehzüchtende Nomaden zur Suche nach neuen Weidegründen
zwingt. Mit der Ankunft der Hunnen 375/376 n. Chr. im Schwarzmeerraum
und der Zerschlagung des Gotenreiches des Ermanerich lässt die
Forschung die Völkerwanderungszeit beginnen. 433 n. Chr. erhalten die
Hunnen als Dank für ihre Unterstützung einen Teil der römischen Provinz
Pannonien, wo sie langsam sesshaft werden. 445 wird Attila alleiniger
Herrscher über die Hunnen. Sein Herrschaftszentrum liegt in der
Pannonischen Tiefebene. 453 stirbt Attila, nur kurze Zeit darauf
zerfällt das Hunnische Reich. Die Periode der Völkerwanderungszeit ist
geprägt von Konflikten zwischen den vom Schwarzmeergebiet bis Spanien
und Nordafrika bis Skandinavien wohnenden Völkern. Bündnisse und
Allianzen zwischen allen Seiten wechseln sich mit gegenseitigen
Angriffen ab.
Die Wanderbewegungen östlicher sowie germanischer Völkerverbände,
darunter Hunnen, Goten, Vandalen und Alanen, bringen das bestehende
Gefüge durcheinander und führen zum Teil in Folge zu Reichsbildungen.
Der durch die Bevölkerungsverschiebungen ausgelöste „Domino-Effekt"
erhöht den Druck auf die Grenzen des Römischen Reiches. Viele der
spätantiken Städte werden zerstört, neue Zentren entstehen und vergehen
wieder im Laufe der folgenden Jahrhunderte. Zeitgenossen berichten über
und beschreiben die verschiedenen Völker, die ihnen manchmal nur aus
Erzählungen und Beschreibungen bekannt sind, oft voller Vorurteile und
zu „Propagandazwecken". In Niederösterreich, Teil der römischen
Provinzen Noricum und Pannonien, leidet die Bevölkerung unter dem
Verfall des Römischen Reiches. Die Unruhen an den Grenzen und die
Überforderung der römischen Armee wirken sich auf die gesamte Provinz
aus. Die Verwaltung löst sich auf, Städte verwahrlosen, sodass
Ammiannus Marcellinus über die Provinzhauptstadt Carnuntum sagen kann,
sie sei „ein verlassenes und verwahrlostes Nest". Mit der Abwanderung
der Langobarden von Pannonien nach Italien im Jahr 568 n. Chr. endet
nach allgemeiner Übereinkunft die Völkerwanderungszeit.
ZWEI POLYEDEROHRRINGE, GOLD MIT GRANATEINLAGEN

BESTATTUNG MIT DEFORMIERTEM SCHÄDEL
Grab einer reich ausgestatteten 25-30-jährigen Frau, deren Schädel
künstlich verformt wurde. Einzelne Bestattungen und kleine Grabgruppen
in der Nähe von Weilern sind in diesem Zeithorizont häufig zu
beobachten.
Fundort: Ladendorf (Bez, Mistelbach), Datierung: ca. 470-500/510 n. Chr.

DIE LANGOBARDEN ZIEHEN IN DAS EHEMALIGE LAND DER RUGIER
487/488 n. Chr. wird das Rugierreich im Auftrag des weströmischen
patricius und rex italicae Odoaker zerschlagen. Teile der romanischen
und romanisierten Bevölkerung ziehen gegen Süden ab. Danach siedeln
sich die Langobarden noch unter der Oberherrschaft der Heruler - im
„Rugiland", dem heutigen westlichen Weinviertel und Südmähren, an.
Paulus Diaconus, ein langobardischer Geschichtsschreiber, berichtet
darüber. Die Langobarden gehören zur großen Gruppe der Elbgermanen und
siedelten zuvor wohl im nördlichen Mitteldeutschland.
Etwa 505 überschreiten sie die Donau. Laut Paulus Diaconus halten sie
sich im „feld", wohl das heutige Tullnerfeld, auf. Nachdem sie ihr
Siedlungsgebiet auf das nordöstliche Weinviertel und Teile Panonniens
ausgedehnt haben, ziehen die Langobarden 568 n. Chr. nach Italien ab.
Ein Vertrag mit den Awaren räumt ihnen ein Rückkehrrecht auf 200 Jahre
ein.
Die frühesten Gräber der Langobarden finden sich in Niederösterreich in
der Gegend von Krems und Hollabrunn, dem einstigen „Rugiland". Auf
ihrer Reise vom Norden Europas in den Süden nehmen sie verschiedene
Einflüsse auf, diese sind in ihren Gräbern wiederzufinden. In Freundorf
im Tullnerfeld enthalten zwei nebeneinander liegende und gleich alte
Gräber die Skelette eines Hundes und eines Pferdes sowie eines
erwachsenen Mannes. Auf seinem Sarg sind eine Lanze und eine fränkische
Wurflanze, ein Ango, deponiert. Die Kombination von Waffenausstattung
und Tierbestattung weist ihn als vornehmen berittenen Krieger des 6.
Jhs. aus. Er könnte ein Langobarde oder auch ein Mann aus dem
Frankenreich gewesen sein.
NEUE GERMANISCHE KÖNIGREICHE AM NÖRDLICHEN DONAUUFER IM 5. JH. N. CHR.
Nach dem Untergang des Attilareiches 453 n. Chr. entsteht im östlichen
Wald- und Weinviertel „Rugiland", das Königreich der ostgermanischen
Rugier. Der Handel mit den Römern spielt sich auf eigenen Märkten ab.
Archäologische Hinweise sind Münzen mit Monogrammen rugischer Könige.
487-488 wird das Rugierreich von den Römern unter Odoaker zerschlagen.
Ab Mitte des 5. Jhs. gründen die ostgermanischen Heruler ein Reich
nordöstlich des „Rugilandes". Sie siedeln an der March, in Südmähren
und im östlichen Weinviertel. Im Jahr 508 befreien sich die Langobarden
von der herulischen Vorherrschaft, deren Reich sich auflöst.
Vermutlich steht in Asparn/Schletz ein Dorf der Heruler, gleich daneben
liegen auch die dazugehörigen Gräber. Der Platz ist wohl aufgrund
seiner Nähe zu einer Kreuzung der Bernsteinstraße gewählt worden. Ein
hier bestatteter Mann wird durch seinen silbernen Ohrring als ein
Vornehmer, wohl Mitglied einer Kriegerschicht, identifiziert. In einem
Mädchengrab bleiben eine kleine Fibel vom Mantelverschluss und Perlen,
wohl ihres bestickten Kleides erhalten. In Ladendorf findet man das
Grab einer reich ausgestatteten 25-30-jährigen Frau, vermutlich einer
Herulerin. Auffallend ist die künstliche Deformation ihres Schädels.
Dies ist eine Sitte, die sich mit den Hunnen und ostgermanischen
Völkern im 5. Jh. bis nach Mitteleuropa ausbreitet und im 6. Jh. wieder
verschwindet. Um den Schädel in diese Form zu bringen, muss er schon im
Kindesalter so bandagiert werden, dass er sich turmartig nach oben
verlängert.

EIN HERRSCHAFTSZENTRUM NACH RÖMISCHEM VORBILD
Auf der Hochfläche des Oberleiserberges bei Ernstbrunn, Bezirk
Korneuburg befindet sich in der Völkerwanderungszeit wahrscheinlich ein
Herrschaftssitz eines suebischen Königs. Die germanischen Sueben gelten
als die Nachfahren der Markomannen und Quaden. Es handelt sich offenbar
um einen Ort besonderer politischer Bedeutung am Rand des Römischen
Reiches. Im Zentrum der Siedlung liegt ein Herrenhof. Er besteht etwas
über hundert Jahre, in denen er vier Ausbauphasen erlebt. Mit römischer
Fußbodenheizung, Steinfundament, Fachwerkwänden, Prunkfassade und
römischen Dachziegeln aus Ton dient er als großes Wohnhaus,
Wirtschaftsgebäude und Repräsentationsbau.
Um 450 n. Chr. wird er ein letztes Mal ausgebaut. Die Architektur
spätantiker Paläste ist besonders in der Gestaltung der Fassade des
Herrenhofes erkennbar. Im Römischen Reich ausgebildete Handwerker
führen wohl den Auftrag aus. Werkzeuge zur Holzbearbeitung, wie Dechsel
und Löffelbohrer, sind bei den Ausgrabungen gefunden worden.
Glasgefäße, Fensterglas, Ziegel und römische Keramik sind zum Teil aus
dem Imperium importierte Luxusgüter, die die hohe soziale Stellung und
den Grad der Romanisierung anzeigen. Die Romanitas, die römische
Lebensart, Wohnkultur und gehobene Tischkultur wird in hohem Maße
imitiert. Wahrscheinlich wird die Anlage in der 2. Hälfte des 5. Jhs.
n. Chr. gewaltsam zerstört. Vielleicht ist dieses Ereignis in der
Gotengeschichte des Jordanes beschrieben: Der ostgotische König
Thiudimir, Vater Theoderichs des Großen, besiegt den Suebenkönig
Hunimund an einem „hochgeschützten Ort".

DIE AWARISCHEN REITERNOMADEN ERREGEN GROSSES AUFSEHEN IN ΒΥΖΑNZ
Der byzantinische Chronist Theophanes (760-817/818) berichtet: „Die
ganze Stadt lief zusammen, um sie zu betrachten, da man ein solches
Volk noch nie gesehen hatte. Denn sie trugen die Haare hinten ganz
lang, gebunden mit Bändern und geflochten, während die übrige Tracht
den anderen Hunnen ähnlich war." Das trägt sich 558/559 in
Konstantinopel/Byzanz zu, und es ist eine awarische und keine hunnische
Gesandtschaft, die beim römischen Kaiser Justinian I. vorspricht. Die
Awaren, eine Stammeskonföderation von nomadischen Steppenreitern,
erbitten die Erlaubnis, sich im byzantinischen Reich niederlassen zu
dürfen. Im Gegenzug versprechen sie militärische Unterstützung. Und
wirklich besiegen sie in wenigen Jahren die „Barbarenreiche" an der
Nordschwarzmeerküste.
Als der Kaiser vertragsbrüchig wird, verbünden sich die Awaren mit den
Langobarden. Sie suchen Unterstützung gegen die germanischen Gepiden,
Verbündete von Byzanz. Der awarische Khagan Baian muss erst zum Bündnis
überredet werden. „Die langobardischen Gesandten betonten ferner, ein
Krieg gegen die Römer liege im eigensten Interesse der Awaren, weil
ihnen andernfalls jene zuvorkommen und mit allen Mitteln die Macht der
Awaren niederwerfen würden, wo immer auf Erden sie sich befänden",
schreibt dazu Menandros Protector, ein griechischer
Geschichtsschreiber. Der awarische Khagan Baian ist ein geschickter
Verhandler. Bei einem Sieg sollen die Awaren die Hälfte der Beute, das
gesamte Gepidenland und ein Zehntel des gesamten Viehbestandes der
Langobarden erhalten. Die Gepiden werden besiegt, die Langobarden
überlassen den Awaren ihr Land und ziehen 568 n. Chr. nach Italien. Mit
diesem Ereignis endet nach allgemeiner Lehrmeinung die Periode der
Völkerwanderung.
Im Karpatenbecken wird das Awarenreich 200 Jahre lang eine ernst zu
nehmende politische Kraft im Europa des frühen Mittelalters. Mit klarer
Strategie sowie einem gut organisierten und disziplinierten Heer
verschaffen sich die Awaren Respekt und Prestige. Sowohl durch
Tributzahlungen vom Frankenreich und von Byzanz als auch durch
Plünderungen sichert der Khagan seine Machtposition an der Peripherie
des byzantinischen Reiches. Karl der Große bringt schließlich das
Khaganat zu Fall und plündert seine Reichtümer. Zum Völkerverbund der
Awaren gehören neben Resten von Langobarden, Gepiden und vielleicht
sogar Romanen und Slawen. Im Lauf der Zeit werden die Awaren sesshaft.
Sie bestatten ihre Toten auf großen Friedhöfen mit reihenförmig
angeordneten Gräbern. Über die Anfangszeit ist wenig bekannt.
Wahrscheinlich sind die frühen Gräber Brandbestattungen, die
Bestattungssitte ändert sich aber bald zu Körpergräbern so bleibt es
bis zum Ende des Awarenreiches.
DIE AWARISCHE FRAUENTRACHT REPRÄSENTIERT WEITRÄUMIGE KONTAKTE
Eine Rekonstruktion der awarischen Bekleidung ist vor allem aufgrund
der erhaltenen Trachtbestandteile möglich. Für die Vorstellung der
Frauentracht sind damit Grabfunde fast die einzigen Quellen. Die
Trachtbestandteile aus Metall, Glas oder Bein erhalten sich im
Gegensatz zu organischen Materialien im Boden besser. Das Obergewand
der Frauen kann mit einer Mantelschließe zusammengehalten werden, wie
im Kindergrab 82c von Leobersdorf. Aus den Grabfunden können wir
erkennen, dass die awarische Frauentracht vielfältige Kultureinflüsse
aufweist, mit einer starken Kontinuität bis in die Spätawarenzeit.
Spinnwirtel liegen in den Frauengräbern, sowie auch Messer und
Nadelbüchsen an der linken Körperseite. Kleine Metallringe weisen
darauf hin, dass sie wohl an das Gewand angenäht waren. Frauen der
Mittelawarenzeit (650-710 n. Chr.) tragen Halsketten mit sogenannten
Hirsekornperlen. In der Spätzeit sind die Ohrringe oval und es kommen
Armreifen aus Bronze und Drahtfingerringe hinzu. Typische Perlen sind
Melonenkernperlen. Eine Besonderheit sind Perlenketten aus
Mosaikaugenperlen, Augenperlen und Mehrfachüberfangperlen. Sie sind von
Irland im Westen bis zum Kaspischen Meer im Osten, von Oberägypten im
Süden bis nach Skandinavien im Norden bekannt. Dabei ist es noch nicht
gelungen, die Produktionszentren zu lokalisieren.
DIE SLAWISCHE LEBENSART BREITET SICH SCHNELL AUS
Die früheste slawische Besiedlung in Niederösterreich nördlich der
Donau ist durch Grabfunde belegt. Es sind einfache Brandbestattungen in
Urnen, die vor allem im Gebiet zwischen Manhartsberg und
Dunkelsteinerwald geborgen wurden. Schriftliche Quellen und
archäologische Funde der frühen Slawen allgemein zeichnen ein Bild
einer stark landwirtschaftlich geprägten Gesellschaft. Sie scheinen in
dezentral organisierten Strukturen mit geringen sozialen Unterschieden
zu leben. Zeitlich ist die Ankunft der Slawen in Niederösterreich nicht
sicher fassbar. Sie mag mit dem Rückzug der Langobarden aus den
Gebieten nördlich der Donau, In der zweiten Hälfte des 6. Jhs.
zusammenhängen. Die Slawen sind auch Teil des awarischen
Völkerverbandes und kommen mit diesen in unseren Raum. In schriftlichen
Quellen wird außerdem von einem Verband slawischer Völker berichtet. Er
bildet sich Anfang des 7. Jhs. im Zuge einer Rebellion gegen die Awaren
unter dem fränkischen Kaufmann Samo heraus. Dieses „Samo-Reich" soll an
der Peripherie des awarischen Herrschaftsgebietes liegen, wobei aber
seine genaue Lokalisierung umstritten ist. Frühe slawische Siedlungen
in Niederösterreich wurden beispielsweise in Mitterretzbach und
Michelstetten im Weinviertel ergraben. Die Grubenhäuser weisen meist
Feuerstellen auf, zum Teil regelrechte Öfen. Tiefe luftdicht
verschließbare Speichergruben zur Getreidelagerung, Mühlsteine zum
Mahlen von Getreide sowie Spuren von Geweihbearbeitung sind in den
Siedlungen nachzuweisen. Die Keramik erlaubt aufgrund ihrer technischen
Veränderungen und Verzierungsweise eine zeitliche Einordnung.
VERGOLDETE SCHEIBENFIBEL AUS PRESSBLECH, VERZIERT MIT TIERWIRBEL UND ZENTRALER GLASEINLAGE
Fundort: Pitten (Bez. Neunkirchen), Grab 43A, Datierung: 700 bis 800 n. Chr.

Der Geschmack der Awaren verändert sich im Laufe der Zeit. Dies zeigt
sich eindrucksvoll an der Art, wie sie die verschiedenen Bestandteile
ihrer prunkvollen Gürtel sowie ihre Zopfspangen herstellen und
verzieren.
GÜRTELGARNITUR, ZWEITEILIG AUS BUNTMETALL GEGOSSEN, DURCHBROCHEN Der
vielteilige Gürtel mit gegossenen Einzelteilen ist typisch für die
Spätawarenzeit. Die Hauptriemenzunge ist zweiteilig gearbeitet und
zeigt ein stilisiertes Rankenmotiv. Awarische Männer flochten ihre
langen Haare und hielten sie mit Zopfspangen zusammen.
Fundort: Leobersdorf (Bez. Baden), Grab 81, Datierung: vor 800 n. Chr.

MIT GOTTES HILFE - KARL DER GROSSE UND DAS AWARENREICH
Die Raumarchitektur zeigt, wie Karl der Große seine Pranke nach dem
Gold anderer Völker ausstreckt. Die auf heutigem niederösterreichischem
Gebiet vorherrschende Volksgruppe der Awaren wird dabei besiegt und ihr
Reich zerschlagen. Das Frühmittelalter in Europa ist geprägt durch den
Niedergang des Weströmischen Reiches und das Entstehen neuer Reiche auf
dessen Gebieten. Bis 795/796 n. Chr. stellt das awarische Reich,
Khaganat genannt, eine starke Macht in Europa dar. Große Teile Mittel-
und Westeuropas beherrschen die Franken unter Karl dem Großen. Im Osten
bleibt das Oströmische Reich eine stabile Größe. Seine Hauptstadt
Byzanz ist eine alte griechische Stadt, die im 1. Jh. n. Chr. Teil
einer römischen Provinz wird. Kaiser Konstantin der Große macht sie 330
n. Chr. offiziell zur Hauptstadt. Schließlich erhebt Kaiser Theodosius
I im Jahr 380 n. Chr. das Christentum, das bis 311 n. Chr. - dem Jahr
der offiziellen Erlaubnis seiner Ausübung - verfolgt wurde, zur
Staatsreligion.
Im Lauf der Völkerwanderungszeit werden germanische Völker auf
römischem Reichsgebiet angesiedelt. Viele germanische Anführer sind
Anhänger des Arianismus, einer vom Katholizismus abweichenden
christlichen Lehre. Die Karolinger, ein Herrschergeschlecht der
Franken, bauen auf ein katholisches Königtum. 751 kommen sie im
Frankenreich an die Macht. Karl der Große ist ab 768 König und wird zu
Weihnachten im Jahr 800 in Rom von Papst Leo III. zum Kaiser gekrönt.
Schon 788 wird das Herzogtum Baiern Teil des Frankenreiches. Karl
bringt das Frankenreich zu seiner größten Ausdehnung und macht es zu
einem Großreich neben Byzanz und dem arabischen Kalifat im Osten.
Daneben ist er ein vehementer Streiter für das Christentum. Er erobert
das (nunmehr schon fast vollständig katholische) Langobardenreich in
Italien, führt Krieg gegen die islamischen „Mauren" in Spanien, kämpft
erbittert gegen die heidnischen Sachsen und zerstört das Reich der
Awaren. Gleichzeitig bemüht er sich um einen kulturellen Aufschwung in
seinem Frankenreich. Er sorgt für eine Bildungsreform und stabilisiert
die Verwaltung. Kaiser Karl ist einer der größten Herrscher des
Mittelalters. 1165 wird er sogar von Gegenpapst Paschalis III. im
Auftrag Friedrichs I., genannt Barbarossa, heiliggesprochen. In
Nordeuropa beginnt die Wikingerzeit 793 n. Chr. mit dem Überfall auf
das Kloster Lindisfarne an der Nordostküste Englands. Bis 1066 sind die
Skandinavier ein wichtiger Faktor. Neben Überfällen unterhalten sie
Handelsbeziehungen mit dem Frankenreich, sie sind begehrte
Geschäftspartner im Osten und bekleiden Ämter als Garden in Byzanz.
ZERSTÖRTES REITERGRAB
Ein awarischer Reiter wurde bei Drasenhofen mit seinem aufgezäumten
Reitpferd bestattet. Die genauen Fundumstände sind heute nicht mehr
nachvollziehbar, Gräber dieser Art wurden im östlichen Weinviertel aber
erst im 8. Jh. angelegt.
Fundort: Drasenhofen (Bez. Mistelbach) Datierung: 700 bis 800n. Chr.
ZWEI SCHMUCKSCHEIBEN (PHALEREN) AUS EISEN, GOLDPLATTIERT; TRENSE AUS EISEN

IN HOC SIGNO VINCES - DIE AUSBREITUNG DES CHRISTENTUMS
Der rote Ausstellungsraum ist geprägt durch Kreuz und Taufschale,
beides Symbole für die Ausbreitung des Christentums. Auszüge aus den
vier Evangelien des Neuen Testamentes, geschrieben in der
karolingischen Minuskel, lassen zusammen ein Kreuz entstehen. Im Juni
172 n. Chr. werden die römischen Truppen bei einem Feldzug gegen die
germanischen Markomannen von diesen eingeschlossen. Hitze und
Wassermangel scheinen sie zum Aufgeben zu zwingen. Da bricht ein
Gewitter mit starkem Regen los und rettet sie aus ihrer ausweglosen
Situation. Dieses Ereignis wird einem Wunder zugeschrieben, das
betenden christlichen Soldaten zu verdanken sei. Während der Römischen
Kaiserzeit bringen Soldaten den christlichen Glauben, den sie im Orient
kennengelernt haben, in den Donauraum. Die Verbreitung der christlichen
Religion im Römischen Reich ist ein lange währender Prozess. Unter
immer größer werdendem gesellschaftlichen Druck konvertieren immer mehr
Heiden zum Christentum. Kaiser Konstantin schließlich macht das
Christentum zur offiziellen Staatsreligion. Vor allem in den Städten
findet das Christentum zahlreiche Anhänger und es entstehen kirchliche
Organisationsstrukturen. Diese zerbrechen mit dem Niedergang des
Weströmischen Reiches 476 n. Chr. Möglicherweise hielt sich jedoch in
der darauffolgenden Zeit ein „Restchristentum", das von der
verbleibenden romanischen Bevölkerung getragen wurde. Nachdem Karl der
Große den Krieg gegen die Awaren gewonnen hat, wird auch östlich der
Enns die Missionierung verstärkt. Kirchliche Institutionen und
fränkisch-bairische Adelige werden gezielt mit Ländereien im Osten
belehnt oder nehmen diese auch ohne ausdrückliche Zustimmung des
Kaisers in Besitz. Zuständig ist vor allem das Bistum Passau. Kyrill
und Method, die sogenannten „Slawenapostel", wirken im angrenzenden
Mährischen Reich.
KÖNIG KARL ZERSTÖRT DAS AWARENREICH
Die Enns ist der „limes certus", die Grenze zwischen den Awaren und den
Baiern. Dennoch werden im 8. Jh. im niederösterreichischen Donauraum
rege Kontakte gepflegt. Die Franken bauen unter Karl I. ihre
Vormachtstellung aus. Acht Jahre lang kämpft Karl I., später der Große,
gegen die Awaren. Einhard, sein Biograf, meint, der Awarenkrieg sei
Karls größter Sieg, neben dem gegen die Sachsen. Es geht um die
Ausdehnung des Fränkischen Reiches, aber er führt den Krieg auch gegen
den heidnischen Glauben. Mitte September 791 findet der erste Angriff
gegen die Awaren statt. Davor schlägt Karls Heer bei Enns/Lorch sein
Lager auf. Es wird mehrere Tage gefastet, gebetet und es werden
zahlreiche Messen gefeiert, wie Einhard berichtet. Der Feldzug soll
durch göttlichen Segen gestützt erfolgreich sein. Aber erst 796 sollte
Karl das awarische Khaganat endgültig zerstören können. Durch
Bürgerkriege geschwächt unterwirft sich der Khagan dem fränkischen
König ohne Widerstand. Die awarische Residenz wird zerstört und
geplündert, die Reichtümer ins Frankenreich gebracht. Die Missionierung
der heidnischen Awaren wird jetzt mit großem Eifer betrieben.
UNGARISCHER REITERKRIEGER
Mit Säbel und Pferd wurde ein junger ungarischer Reiterkrieger wohl um
das Jahr 1.000 in Gnadendorf bestattet. Zwischen 14 und 18 Jahren
dürfte er alt gewesen sein.

DER REITER VON GNADENDORF - UNGARISCHE STEPPENREITER IN NIEDERÖSTERREICH
Der Völkerverbund der Magyaren oder Ungarn lässt sich gegen Ende des 9.
Jhs. im Karpatenbecken nieder. Sie kommen aus den östlichen
Steppengebieten, anderen Gruppen ausweichend. Bereits im 9. Jh. sind
sie einerseits kurzfristige Bündnispartner für Baiern oder Mährer,
andererseits unternehmen sie zahlreiche Beutezüge und Überfälle oder
handeln Verträge für Tributzahlungen aus. Bereits 881 wird über eine
Schlacht gegen die Ungarn bei Wien/am Wienfluss berichtet. Um 900
plündern die ungarischen Reiter unter ihrem Führer Árpád Norditalien im
Auftrag Kaiser Arnulfs. Nach bewährter Methode werden den Ungarn
Greueltaten zugeschrieben. Dies geschieht mit eindeutig
propagandistischer Ausrichtung.
Im Jahre 907 erlebt das Frankenreich bei Pressburg gegen die Ungarn
eine empfindliche Niederlage und bedeutende territoriale Verluste. Das
bairische Ostland geht an die Ungarn verloren, die Grenze wird an die
Enns zurückverlegt. Für die Bevölkerung scheint sich durch die
Herrschaft der Ungarn nicht viel verändert zu haben.
Verwaltungsstrukturen und Grundherrschaften sind offenbar von den
Ungarn nicht zerstört worden. In den darauffolgenden Jahren mehren sich
ungarische Überfälle und Beutezüge, bis König Otto I. 955 in der
Schlacht am Lechfeld das ungarische Heer aufreibt. Dieser Sieg beendet
die Periode der ungarischen Überfälle. 962 lässt sich König Otto I. zum
Kaiser krönen. Die Herrscherdynastie der Liudolfinger wird daraufhin
auch als Ottonen bezeichnet. Sie stellt für die folgenden zwei
Jahrhunderte den Kaiser. Im Osten entwickelt sich das Königreich Ungarn
unter Stephan I. der 1001 formell gekrönt wird. Anlässlich von
Aushubarbeiten stößt man in Gnadendorf auf einen menschlichen Schädel
und ein Stück eines Schwertes. Eine rasch eingeleitete Rettungsgrabung
birgt das Grab eines jungen Mannes, der mit Säbel und Schwert bestattet
wurde.
RÄTSEL UM EINEN JUNGEN UNGARISCHEN REITER
2000 wird bei Aushubarbeiten in Gnadendorf ein Grab entdeckt. Auf dem
rechten Arm des Skelettes liegt ein eiserner Säbel in seiner Scheide,
eine Besonderheit an Prunk und Kunstfertigkeit. Im Bauchbereich finden
sich Gürtelbeschläge. Bei den Beinen des Toten erhielten sich Schädel
und Teile der Beine eines Pferdes. Eine Trense und Steigbügel stammen
vom Reitzubehör. Zur Fleischbeigabe, dem Oberschenkel eines Pferdes,
gehört ein Messer. Mehrfach gelochte Silbermünzen dienten wohl der Zier
der Kleidung oder des Zaumzeuges.
Laut Untersuchungen handelt es sich um einen jungen Mann, zwischen 14
und 18 Jahren, kräftig, gut trainiert und ein geübter Reiter. Eine
nicht verheilte Wunde in der Armbeuge und eine Monate alte
Kopfverletzung könnten zum Tod geführt haben. Außergewöhnlich ist der
Nachweis des sogenannten „Klippel-Feil-Syndroms". Eine angeborene
Krankheit mit Verwachsungen der Wirbelkörper, einer Deformation der
Schädelbasis und vermutlicher Schwerhörigkeit. Der junge Mann bekommt
eine veraltete Ausstattung aus der sogenannten Landnahmezeit zwischen
ca. 895-940 n. Chr. mit ins Grab. Ist sie ein Statussymbol und stammt
von einem Vorfahren? Die archäologischen Objekte sind also mehr als 50
Jahre älter als das Radiokarbondatum ergibt. Diese Situation wirft neue
Fragen zur Anwesenheit der Ungarn nach 955 auf. Zu dieser Zeit liegt
das Siedlungsgebiet der Ungarn weit östlich der Grabstelle. Stirbt er
an einem der historisch belegten Ungarneinfälle und wird im
„Niemandsland" begraben?

DER EINFLUSS DER KIRCHE IN POLITIK UND BILDUNG WÄCHST
Die Kirche hat im Mittelalter großen Einfluss auf Kultur und
Wirtschaft. Der Wein findet vor allem durch seine Rolle in der
christlichen Liturgie sowie als Genussmittel bald in den Klöstern
seinen festen Platz. Bibliotheken in den Klöstern sind Hüter der
Schriftkultur. Im Scriptorium, der Schreibstube, werden Bücher
geschrieben und durch Abschreiben vervielfältigt. Hier findet die
Ausbildung der Novizen, aber auch die Unterweisung von Laien im Lesen
und Schreiben statt. Das verleiht der Kirche großen Einfluss auf das
Bildungswesen und die Schriftkultur. Städtische Domschulen übernehmen
eine wichtige Rolle in der Bildung, im Verlauf des Mittelalters werden
sie nach und nach von Universitäten und Privatschulen abgelöst.
In der Zeit nach 1000 n. Chr. entstehen neue geistliche Orden wie jene
der Zisterzienser und der Kartäuser. Das hochmittelalterliche Ideal
eines strikt kontemplativen Ordens haben sich die Kartäuser bis heute
erhalten. Bodenfliesen in den Klöstern und manchmal auch in
Profanbauten, wie der Gozzoburg in Krems, tragen Darstellungen mit
christlicher Symbolik, immer eng verbunden mit der Vorstellungswelt des
Mittelalters. Im Hochmittelalter unternahm man Pilgerfahrten aufgrund
von Gelübden, speziellen Privilegien im Kirchenrecht oder in der
Hoffnung auf Heilung körperlicher Gebrechen. Im Spätmittelalter pilgert
man vor allem zum Erwerb von Ablässen, also dem Erlassen von zeitlichen
Sündenstrafen, zum Gnadenort. Pilgerandenken, wie die Pilgermuschel aus
Grafendorf oder das winzige Pilgerzeichen aus Drösing, sind begehrte
Erinnerungen an Pilgerreisen.
Zu einem langjährigen Machtkampf zwischen Kirche und Kaiser kommt es,
als sich der Papst im 11. Jh. gegen die Ernennung eines Erzbischofes
durch den Kaiser zur Wehr setzt. Diese Auseinandersetzung fällt in die
Zeit einer allgemeinen Kirchenreform, eine Rückbesinnung auf die
ursprüngliche Aufgabe der Heilsverkündung mit Betonung der Autorität
des Papstes findet statt. Der sogenannte Investiturstreit (Investitur =
Einsetzung von Bischöfen und Reichsäbten) gipfelt im bekannten
„Canossa-Gang". Der vom Papst mit dem Bann belegte und von ihm sogar
abgesetzte Kaiser muss Abbitte leisten. Nach dreitägigem Bitten im
leichten Bußgewand mitten im Winter befreit ihn der Papst am 28. Jänner
1077 vom Bann. Der Streit zwischen Kaiser und Kirche um die Macht ist
damit nicht beigelegt. Erst 1122, also 45 Jahre später kommt es zu
einer Einigung, dem Wormser Konkordat. Der Kaiser verzichtet in Folge
auf die Einflussnahme bei der Einsetzung von Bischöfen.
Eine bedeutende Folge dieser Konflikte ist die Auflösung der
traditionellen Einheit von Kaisertum und Papsttum; das Verhältnis
zwischen weltlicher und geistlicher Gewalt wird neu bestimmt. Die
Konkurrenz zwischen weltlicher und geistlicher Vorherrschaft wird bis
ins Spätmittelalter erhalten bleiben. Ein weiterer, epochenprägender
Streit ist jener innerhalb der Kirche, der sich im fortgeschrittenen
14. Jh. an der Frage nach dem rechtmässigen Papst entzündet. Hierbei
spielen auch politische Aspekte eine große Rolle. Es kommt zu einer
jahrzehntelangen Spaltung der lateinischen Kirche, die Sitze der beiden
Päpste befinden sich in Rom und Avignon. Teils erheben sogar mehrere
Päpste gleichzeitig den Anspruch, das legitime Oberhaupt der Kirche zu
sein. Schließlich führten Abdankungen beziehungsweise Absetzungen der
Päpste und eine Wahl zur Existenz eines einzigen, allgemein anerkannten
Papstes.
ARM UND REICH IM HEILIGEN RÖMISCHEN REICH
Die Idee des strategischen Schachspiels wird in diesem Raum der
mittelalterlichen Ständestruktur in einem Spannungsfeld
gegenübergestellt. Inspiriert vom Boden des Raumes spiegelt die Decke
ein schachbrettartiges Muster, wobei die Vitrinen wie mittelalterliche
Schachfiguren im Raum verortet sind. 962 n. Chr. lässt sich Otto der
Große durch den Papst krönen und ist somit der erste Kaiser des
„Heiligen Römischen Reiches". Davor hatte er sich bereits mit dem Sieg
über die Ungarn 955 am Lechfeld als Beschützer der Christenheit und der
Kirche bestätigt. Das Reich sollte eine von Gott gewollte Fortsetzung
des antiken Römischen Reiches sein, das „Heilig" im Titel betont das
Kaisertum von Gottes Gnaden.
1095/1096 folgt Papst Urban II. einem Hilferuf des byzantinischen
Kaisers und initiiert den Kriegszug zur Rückeroberung des islamisch
eroberten Palästinas. Es kommt zwischen 1096 und 1101 zu mehreren
großen Kreuzzugswellen, dem sogenannten Ersten Kreuzzug. Das Ziel, die
Eroberung Jerusalems, wird um 1099 erreicht, das Kreuzritterheer
plündert und verwüstet die Stadt. 1273 wird Rudolf von Habsburg zum
König des „Heiligen Römischen Reiches". 1282 erwirbt er Österreich,
Steiermark und die Krain und leitet so den Aufstieg der Habsburger zu
einem der mächtigsten Herrscherhäuser ein.
Die Gesellschaft im Europa des Mittelalters ist in Ständen organisiert,
in die man überwiegend hineingeboren wird. Diese Ordnung wird als fest
und von Gott gegeben angenommen. Als erster Stand gilt der Klerus, als
zweiter der Adel und als dritter das Bürgertum und der Bauernstand, dem
die meisten Menschen angehören. Die Aufgaben der Stände sind klar
definiert. Dem Klerus obliegt das Seelenheil und die moralische und
sittliche Erziehung. Die Adeligen verpflichten sich zu Schutz und
Verteidigung von Volk und Land. Die Bauern sorgen für die
Lebensgrundlage der oberen Stände. Die Schicht der einfachen Bürger
lebt vor allem in den Städten. Der Wechsel von einem Stand in den
anderen ist zwar möglich, geschieht aber selten. Die Zugehörigkeit zum
Adel und dem dritten Stand hängt von der Abstammung, nicht vom Reichtum
ab. So kann ein Bürger aus dem dritten Stand vermögender sein als ein
verarmter Adeliger des zweiten Standes. Die Angehörigen des ersten
Standes, des Klerus, entstammen fast ausschließlich dem Adel. Sie
besitzen Rechte und Pflichten und genießen Privilegien gegenüber dem
dritten Stand der Bürger und Bauern.

ADEL VERPFLICHTET - HERRSCHAFTSDEMONSTRATION
Adel, so wie wir ihn heute verstehen, bildet sich im Mittelalter
heraus. Er beruht auf dem feudalistischen Prinzip, für das die
Abstammung und das Lehenswesen wichtige Merkmale sind. Daraus erwächst
Macht und Herrschaft über Land und Menschen, die als von Gott gegeben
legitimiert werden. Diese Machtposition bringt Einfluss auf politische
Entscheidungen und verpflichtet zur Übernahme von Verantwortung für das
Gemeinwohl. Die Erblichkeit überträgt den gehobenen gesellschaftlichen
Status auf die gesamte Familie. Eine eigene Erziehung bereitet den
Nachkommen auf seine Position in der Gesellschaft und seine Aufgaben
als Adeliger vor. Die Erhebung von Personen mit besonderen Verdiensten
in den Adelsstand kann nur vom Adel selbst vorgenommen werden, meist
sogar nur von ihren höchsten Vertretern, wie dem König oder Kaiser. Die
Herausbildung des mittelalterlichen Adelsstandes ist umstritten.
Bereits im Frühmittelalter bestehen durch Grundbesitz und
Grundherrschaft soziale Unterschiede. Die moderne Forschung betrachtet
den politischen Einfluss durch die Herrschaft über Menschen als einen
wichtigen Faktor für die Herausbildung des Adels. In Niederösterreich
richten unter anderem Adelige aus dem Frankenreich infolge des Sieges
Karls des Großen über die Awaren im Jahr 796 n. Chr. Grundherrschaften
ein.
Ein Merkmal des Adels nach außen ist die Repräsentationskultur. Das
äußert sich in einem besonderen Lebensstil mit eigenem Ehrenkodex,
Kleidung, sogar eigener Esskultur und dem Leben in großen
repräsentativen Wohngebäuden. Die Jagd als Freizeitvergnügen und
„Sport" ist dem Adel vorbehalten, Würfelspiele dienen zum Zeitvertreib.
Eine Ausrüstung mit Waffen und Pferden sind wichtiger Bestandteil des
aufwändigen Lebensstils. Die ersten Burgen mit Steinarchitektur
entstehen im heutigen Niederösterreich ab dem Übergang vom Früh- zum
Hochmittelalter, ungefähr im 11. Jh. Sie werden auf Anhöhen erbaut wie
die Burg Raabs, oder als Niederungsburgen, wie ein turmartiger Steinbau
in Sachsendorf. Handwerkliche Tätigkeiten werden sowohl auf den
Burganlagen als auch in den umliegenden waldfreien Flächen (sogenannten
Rodungsinseln) oder Siedlungen ausgeführt. Zwei wichtige Funktionen von
Burgen waren Repräsentation und Schutz. Daneben wird ihnen eine
gewichtige Rolle im mittelalterlichen Wirtschaftsleben zugeschrieben.


Das archäologische Freigelände des MAMUZ Schloss Asparn an der Zaya
gibt einen einzigartigen Einblick in mehr als 20.000 Jahre europäische
Siedlungsgeschichte. Die Entwicklungen der Menschheit von der
Altsteinzeit bis ins frühe Mittelalter werden durch die Wohn- und
Wirtschaftsgebäude sowie deren Inneneinrichtung erlebbar. Die im
Maßstab 1:1 errichteten Gebäude beruhen allesamt auf archäologischen
Befunden, wie etwa Balkengräben, Pfostenlöcher und Feuerstellen.
Aufgrund der oftmals spärlichen archäologischen Evidenz sind die
aufgehende Architektur sowie die Innenausstattung der Gebäude als
Idealrekonstruktionen zu verstehen. Denn schriftliche Überlieferungen
aus dem Zeitalter der Urgeschichte gibt es nicht. Sämtliche Modelle
wurden unter experimental-archäologischen Aspekten errichtet. Das heißt
die Gebäude entstanden unter Berücksichtigung urgeschichtlicher
Handwerkstechniken ebenso wie unter Verwendung von Materialien und
nachgeformten Werkzeugen der jeweiligen Zeitepoche. Der durch das
Gelände verlaufende Hauptweg führt direkt in die einzelnen
Siedlungsbereiche und verbindet die unterschiedlichen Gebäude-Ensembles
miteinander.

JUNGSTEINZEITLICHE SIEDLUNG ab ca. 5.600/5.500 v. Chr.
Das Ensemble besteht aus dem Nachbau eines Langhauses, in dem etwa 25
Personen wohnten, einem Backhaus und einem bereits 1995 errichteten,
neolithischen Brunnen. Im Zuge der Errichtung 2012 ergab sich die
Möglichkeit, nachgebaute Werkzeuge des Neolithikums aus Stein, Knochen
und Holz zu erproben. Die Kunst der Holzbearbeitung war schon in der
Linearbandkeramik hoch entwickelt.
Der Bau des Langhauses (Befund: Schwechat) hat gezeigt, dass ein derart
großer Bau in der damaligen Zeit viel Planung erforderte, schon allein
wegen der Bereitstellung der Baumaterialien. Langhäuser sind ein
Glücksfall für die Archäologie, da die aufgehenden Pfosten tief in den
Boden eingegraben wurden und sich somit deren Spuren gut nachweisen
lassen. Die Pfostensetzung des 28,75 Meter langen Hauses basiert auf
den archäologischen Ergebnissen. Dieses Langhaus ist dreigeteilt und
besteht aus Vor- und Arbeitsraum, Wohn- und Schlafraum und einem stark
gesicherten - möglicherweise auch sakralen - Bereich. In den
Langhäusern dürften etwa 25 Personen im Familien- oder Sippenverband
gelebt haben. Dieses Haus, wohl eine Sonderform, stellt möglicherweise
den Wohnbereich eines Häuptlings dar.
Eine Backhütte (Befund: Traisental) sowie Acker- und Gartenflächen
ergänzen das Ensemble. Der neolithische Brunnen (Befund:
Asparn-Schletz) wurde bereits 1995 als archäologisches Experiment
errichtet. Etwa 2.000-2.500 Stunden Arbeitszeit dürften die Menschen
der Steinzeit benötigt haben um einen derartigen Brunnen zu bauen. Die
Pflanzen, die auf den angrenzenden Feldern wachsen, fanden auch schon
in der Jungsteinzeit Verwendung.









ACKER & GARTEN DER BRONZEZEIT
In der Bronzezeit erfolgten massive Umbrüche in der Landwirtschaft: Die
Aufstallung des Viehs ermöglichte das gezielte Sammeln von Mist und
dessen Ausbringung als Dünger, die Ernteerträge stiegen. Rinder wurden
nun häufig zum Pflügen eingesetzt, die Äcker nahmen deutlich an Größe
zu: 400 bis 2.000 m² waren keine Seltenheit. Natürlich musste der Acker
auf diesem Gelände aus Platzgründen deutlich kleiner ausfallen. Da die
landwirtschaftlichen Techniken der späten Bronzezeit annähernd
vergleichbar waren mit denen der beginnenden Eisenzeit, kann dieser
Acker auch als Beispiel für eisenzeitlichen Ackerbau dienen.
Der Acker ist mit Dinkel (Triticum spelta) bepflanzt, der ab der
jüngeren Bronzezeit große Bedeutung in Teilen Mitteleuropas hatte.
Entsprechend den archäobotanischen Daten ist ein buntes Spektrum von
Ackerbeikräutern ausgesät: Sommer-Adonisröschen, Kornrade,
Österreichische Hundskamille, Roggen-Trespe, Rundblatt-Hasenohr,
Kornblume, Ackerrittersporn, Stängelumfassende Taubnessel,
Venusspiegel, Acker-Steinsame, Acker-Schwarzkümmel, Klatschmohn,
Einjahrs-Ziest und Wildes Stiefmütterchen.
Im Garten wird das Spektrum der Hülsenfrüchte bereichert durch die
Saubohne (Vicia faba), die Ölpflanzen werden erweitert durch den
Leindotter (Camelina sativa), der ursprünglich als Unkraut in
Flachsfeldern vorkam. Die aus Zentralasien stammenden Hirsearten
(Rispenhirse Panicum miliaceum und Kolbenhirse Setaria italica) werden
in der späten Bronzezeit zu einem der wichtigsten Grundnahrungsmittel
und bleiben es bis ins 18. Jahrhundert.








Wem der viele Text zu lange war und lieber Bewegtbilder mit Musik mag,
kann sich gerne dieses Video antun: