web steiner
Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen
Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.
+43/2624/54014 - office@websteiner.com
MAMUZ Museum Mistelbach
Museumszentrum, September 2023
Das MAMUZ Museum Mistelbach widmet sich 2023 mit der
Ausstellung KELTEN einer außergewöhnlichen Kultur. Dabei stehen Alltag,
Kunst und Rituale im Mittelpunkt, die uns die Lebenswelten der Kelten
näherbringen und gängige Klischees widerlegen. Besucher:innen freuen
sich auf neue Funde, die durch Forschungen der vergangenen zwanzig
Jahre zutage gekommen sind.
Kelten - Fantasie & Wirklichkeit
„Kelten" oder „Gallier" so benannten antike Schriftsteller im 5.
Jahrhundert v. Chr. die Bevölkerung in Mittel- und Westeuropa. Griechen
und Römer verwendeten diese Namen als Sammelbezeichnung für die aus
ihrer Sicht barbarischen Gruppen. Rund 2000 Jahre später bezeichneten
die europäischen Entdecker auf ähnliche Art und Weise die
Ureinwohner:innen Amerikas als „Indianer" - obwohl auf dem
amerikanischen Kontinent eine große Vielfalt an menschlichen Kulturen
und Sprachen existierte. Ist diese Pauschalisierung gerechtfertigt? Wie
lebten die „Barbaren" der späten Eisenzeit wirklich, die von den
anderen als „Kelten" betrachtet wurden?
In dieser Ausstellung hinterfragen wir die fantastischen Vorstellungen
über die „Kelten" und versuchen die Lebenswelt in Mitteleuropa in der
Zeit von ca. 450 v. Chr. bis Christi Geburt zu rekonstruieren. Was
drückten die Menschen in ihren Kunst-werken aus? Was war ihnen heilig
und wie traten sie mit den Göttern in Kontakt? Für das Gebiet des
heutigen Nieder-österreichs sind dazu keinerlei antike Schriftquellen
überliefert. Die Ausstellung zeigt daher eine Vielzahl an
archäologischen Funden, die in den letzten Jahren bei zahlreichen
Ausgrabungen entdeckt wurden. Sie vermitteln ein detailreiches Bild vom
Leben und Alltag der Menschen, die vor mehr als 80 Generationen in
Niederösterreich lebten - auch wenn wir nie erfahren werden, wie sie
sich selbst nannten.

Der „Herr der Tiere" groß auf Achse
Der Achsnagel aus Unterradlberg in St. Pölten zeigt die keltische
Abwandlung eines antiken Motivs. Dargestellt ist der „Herr der Tiere",
ein Motiv, das seine Ursprünge im Vorderen Orient hat und über
Griechenland nach Europa gelangte. Auf dem Achsnagel wird der Herrscher
von zwei Raubvogelpaaren flankiert. Der Achsnagel ist ein wichtiger
Bestandteil des Wagens, denn er verhindert, dass das Rad von der Achse
abrutscht. Die Verzierung des Nagels sollte Glück bei der Wagenfahrt
bringen. In Bewegung - bei rotierenden Rädern - war der dargestellte
„Herr der Tiere" allerdings nicht erkennbar.
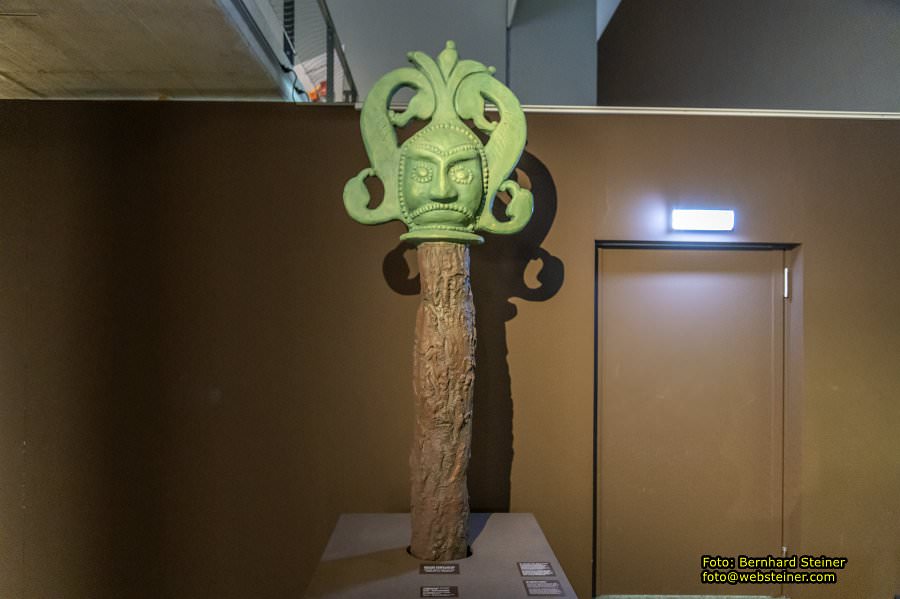
Kunst & Mythos
Die Namen der Künstler:innen sind Schall und Rauch. Aber ihre Werke
faszinieren bis heute. Um die Mitte des 5. Jahrhunderts v. Chr.
entsteht im Gebiet der Kelten ein võllig neuer Kunststil, der sich in
kürzester Zeit von Frankreich bis Ungarn verbreitet. Die
Kunsthandwerker:innen stellen mit Vorliebe menschliche Figuren und
Gesichter, Tiere und Mischwesen dar. Sie verwenden zum Teil Vorlagen
und Ornamente aus dem Mittelmeergebiet, wandeln diese ab und entwickeln
daraus eigene originelle Motive. Das Wesen mit Menschenkopf und
Vogelkörper, der Herr zwischen den Tieren, die Masken mit
Doppelspiralen - all diese fantasievollen Motive stammen aus Mythen,
deren Inhalt den einstigen Betrachter:innen sicherlich aus Gedichten
oder Gesängen bekannt war. Besonders prunkvoll sind goldene Halsreifen
mit Maskendarstellungen, die nur die ranghöchsten Mitglieder der
Gesellschaft tragen durften. Auch Gürtelschnallen oder kleine
Gewandspangen (Fibeln) zeigen kunstvolle Verzierungen mit Fantasiewesen.
Die künstlerischen Darstellungen stehen nicht für sich allein, sondern
dienen als Verzierung von persönlichen Schmuck-gegenständen, von Waffen
oder von Trinkgeschirr. Die Motive sind in erster Linie für die
Besitzer:innen dieser Gegenstände von Bedeutung, denn sie sind nur aus
nächster Nähe sichtbar. In der Ausstellung wird diese Sichtweise
verändert, indem zwei herausragende Kunstobjekte als Kopie stark
vergrößert sind - machen Sie sich selbst einen Eindruck davon!
Rekonstruktion eines Streitwagens im Maßstab 1:1
(nach einem Vorbild aus dem 5. Jhdt. v. Chr.) Holz, Leder, Eisen

Achsnagel mit figürlicher Verzierung, 5. Jhdt. v. Chr., Bronze, Eisen, Fundort Unterradiberg, Niederösterreich
In der Mitte der Verzierung auf dem eisernen Achsnagel steht der ovale
Menschenkopf mit nach unten gebogenen Mundwinkeln. Darüber ist eine
Palmette mit drei Blättern aufrecht dargestellt ein Motiv, das aus der
Kunst des Mittelmeergebiets stammt. Links und rechts des Kopfes
befinden sich zwei S-förmige Körper, aus denen sich Vogelköpfe
entwickeln. Sie bilden zusammen ein Leiermotiv.

Situla von Kuffern (Kopie), 5. Jhdt. v. Chr., Bronze, Fundort Kuffern (Grab 1), Niederösterreich

Kleine Maskenfibel in groß
Die winzige Fibel (Gewandspange) wurde im Grab einer Frau in Ossarn
gefunden - für die Ausstellung wurde sie im Maßstab 1:90 vergrößert.
Das Mischwesen besitzt Raubtierpfoten, den Körper eines Vogels und
einen menschlichen Kopf. Auf dem Kopf trägt das Wesen einen Helm mit
aufgestellten Wangenklappen. Auf den Flügeln sind sorgfältig die Federn
herausgearbeitet, die sich aus einer Spirale entwickeln. Die Attribute
Helm und Flügel verweisen auf die etruskische Göttin Minerva.
Vergrößerung der figürlichen Fibel im Maßstab 1:90
Material Styropor, Glasfaserbeton, Hersteller Atelier Macala, Salzburg

Festmahl
Gemeinsam zu essen und zu trinken war sicher zu allen Zeiten üblich.
Bei den Kelten kam den Festmahlen vermutlich aber auch eine tiefere
religiöse, soziale oder politische Bedeutung zu. Feierlichkeiten, bei
denen ein Festmahl das zentrale Ereignis war, sind von vielen
Bilddenkmalen der Eisenzeit überliefert. Die Pflicht, Gäste zu bewirten
und zu unterhalten, findet sich auch als Thema im - wahrscheinlich auf
älteren Traditionen beruhenden - altirischen Epos „Táin Bó Cúailnge"
(„Der Rinderdiebstahl von Cooley") wieder. Bei archäologischen
Grabungen fanden sich folglich auch vielfach Trinkgeschirre,
Speiseservice und Tranchiermesser, die bei realen oder symbolischen
Festmahlen verwendet wurden. Bei gehobenen Tafeln benutzte man auch
importierte griechische Luxusware. Analysen ergaben, dass aus den
hochwertigen Weinschalen jedoch auch ganz bodenständig einheimisches
Bier getrunken wurde.

Keltische Namen aus Pannonien und Noricum
Aus dem Gebiet des heutigen Ostösterreichs, Tell der römischen Provinz
Pannonia, sind aus römischen Inschriften immer wieder keltische Namen
überliefert. Sie weisen einerseits in die vorrömische Zelt zurück,
zeigen aber auch das Welterleben keltischer Sprache und Traditionen
unter römischer Herrschaft. Die Kelten trugen meist sprechende Namen,
die eine konkrete Bedeutung haben und etwa auf bestimmte Elgenschaften
hinweisen. Die Deutung durch die Sprachwissenschaft erfolgt aufgrund
von Vergleichen mit anderen indogermanischen Sprachen, wie Latein,
Griechisch oder Altirisch.
Aptomarus - Eine verkürzte Form von Atepomarus, was vermutlich
als „der im Kampf zu Hilfe eilt" zu deuten ist. Der Name Aptomarus ist
von einer Inschrift aus Maria Lanzendorf überliefert.
Bella - Vermutlich mit dem
lateinischen „bellum" (Krieg) verwandt, ist wahrscheinlich eine
Kurzform von zusammengesetzten Namen wie „Bela-gentus" oder
„Bello-vesus", die als „Zum Töten geboren" oder „der geborene Krieger"
gedeutet werden.
Biturix - Setzt sich aus den
Silben „Bitu" („Welt" oder „Leben", von altirisch „bith") und „rix"
(König, lateinisch „rex") zusammen und bedeutet so viel wie „König der
Welt". Wir kennen konkret einen Titus Flavius Biturix aus Mannersdorf
an der Leitha, der offenbar ein boischer Aristokrat war, der das
römische Bürgerrecht besaß.
Brogimarus - Setzt sich aus den
Silben „Brogi" (Land) und „marus" (groß, altirisch „mór") zusammen, was
als „groß (= reich) an Landbesitz" gedeutet werden kann. Ein Brogimarus
ist aus Maria Lanzendorf, als Bruder des Aptomarus, überliefert.
Bussumarus - Setzt sich aus den
Silben „Bussu" (Lippe, mittelirisch „bus") und,marus" (groß, altirisch
„mór") zusammen, was in etwa „Mit großer Lippe" bedeutet.
Dibugius - Die Bedeutung
dieses, aus Ebreichsdorf überlieferten Namens ist sehr unsicher.
Möglicherweise bedeutet er „Der in die Flucht schlägt".
Imrinn - Name eines berühmten
Druiden aus dem altirischen Epos „Táin Bó Cuailnge" (Der
Rinderdiebstahl von Cooley), er bezeichnet ein poetisches Versmaß.
Matugenta - Die Deutung ist
nicht ganz sicher, vermutlich ist die Silbe „Matu" mit „gut" zu
übersetzen, in Kombination mit „genta" (lateinisch „genus", Geschlecht,
Sippe) könnte es „aus gutem Geschlecht" oder „Wohlgeboren" bedeuten.
Nemetomara - Setzt sich aus den
Silben „Nemeto" (Heiligtum, Hain, abgegrenzter heiliger Bereich) und
„mara" („groß", altirisch „mór") zusammen und lässt sich als „groß in
der Verehrung des Göttlichen" deuten.
Verclovus - Setzt sich aus den
Silben „ver" (überaus) und „clovus", („Ruhm", altirisch cló) zusammen
und wird daher als „überaus berühmt" gedeutet.

Ein Gastgeber im Jenseits
Im Grab sollte der Tote von Rodenbach als Gastgeber inszeniert werden,
der nach italischer Sitte seine Gäste mit Wein oder anderen
alkoholischen Getränken bewirtet. Zum umfangreichen Trinkservice, das
im Prunkgrab von Rodenbach (Rheinland-Pfalz) gefunden wurde, gehören
ein attisch-rot-figuriger Kantharos, eine bronzene Schnabelkanne, eine
Feldflasche, ein Becken mit Henkeln und eine Schale sowie der Griff
vermutlich eines Weinsiebs. Der hohe Rang des Verstorbenen zeigt sich
an dem goldenen Arm- und dem goldenen Fingerring.
Grabbeigaben eines Prunkgrabes, 5. Jhdt. v. Chr., Fundort Rodenbach, Deutschland
Die flache Schale und das Henkelbecken dienten zum Servieren von Speisen oder zur Waschung vor dem Gastmahl.

Geld regiert die Welt - in
Mitteleuropa seit der Keltenzeit. Es sind keltische Söldner, die auf
Sizilien, in Ägypten oder Syrien für hellenistische Herrscher kämpfen
und mit Münzen bezahlt werden. So lernen sie die Verwendung ebendieser
kennen. Sie kehren mit diesem Wissen und ihrem Sold zurück in die
Heimat. Die Vorteile der Geldwirtschaft werden allgemein rasch
akzeptiert. Nur so ist es zu erklären, dass die keltische Elite
beginnt, eigene Münzen aus Gold und Silber zu prägen.
Als Vorbild für die keltischen Prägungen dienen die Münzen, die der
makedonische König Alexander der Große und seine Nachfolger als
Zahlungsmittel eingeführt hatten. Die keltischen Münzmeister übernehmen
die Gewichtsstandards und die Münzbilder und wandeln sie im Laufe der
Zeit ab. So entsteht um 250 v. Chr. ein komplexes Münzsystem aus Gold-
und Silberprägungen im Bereich der Bernsteinroute. Die einheitliche
Währung ist von Schlesien über Mähren bis nach Niederösterreich
verbreitet, was den großräumigen Handel stark vereinfacht. Viele
Rohstoffe (Eisen, Kupfer, Gold, Silber, Grafit) müssen über weite
Distanzen beschafft werden. Weitere begehrte Handelsgüter sind
Glasschmuck, qualitätvolle Mühlsteine oder Bronzegefäße aus dem
Mittelmeerraum. So manch prunkvolles Gefäß könnte aber auch als Beute
von den Raubzügen nach Italien oder Griechenland in das Gebiet nördlich
der Alpen gelangt sein.
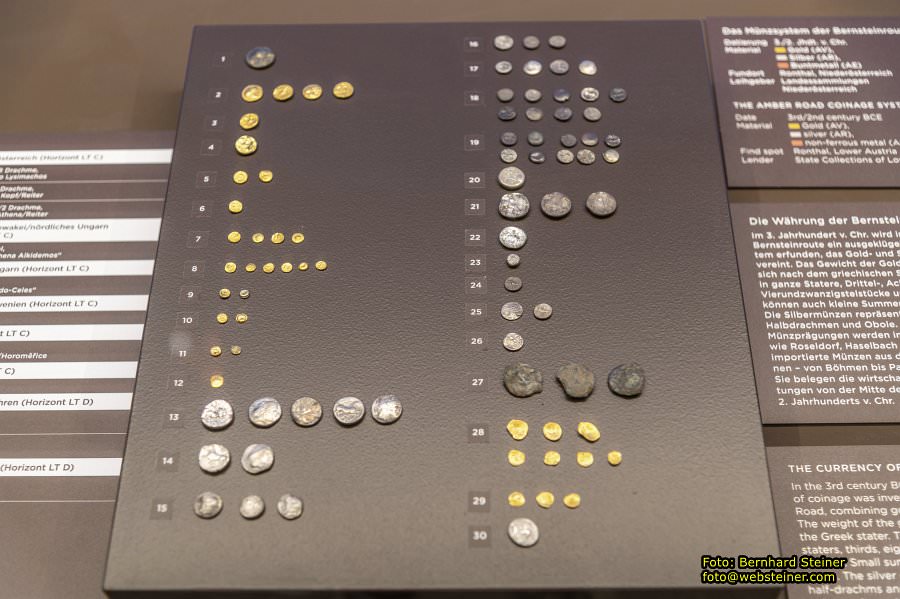
Vom Acker in die Schüssel
Selbstversorgung aus eigenem Anbau das ist das Motto in der
eisenzeitlichen Landwirtschaft. Durch den Anbau mehrerer Getreidearten
(Gerste, Einkorn, Dinkel, Hirse) versuchen die Bauern, das Risiko von
Ernteausfällen zu verringern. Auf den Feldern wachsen abwechselnd
Sommer- und Wintergetreide sowie Hülsenfrüchte (Bohnen, Erbsen) und
Ölpflanzen wie Lein oder Schlafmohn. Dank technischer Fortschritte
gelingt es mit der Zeit, den Ertrag zu steigern und Überschüsse zu
produzieren. Die wichtigste Neuerung ist die eiserne Pflugschar, die
auf den hölzernen Hakenpflug montiert wird. Mit diesem Gerät ist es
möglich, auch schwere Böden zu bearbeiten. Der Speisezettel wird
ergänzt durch Milchprodukte, süße Beeren, wildes Obst und Kräuter,
manchmal auch Fisch und selten Jagdwild. Fleisch kommt nicht jeden Tag
auf den Tisch, sondern nur anlässlich von Festen, Opferritualen oder
Totenfeiern. Zu diesen besonderen Anlässen werden Rinder, Schweine,
Schafe und Ziegen geschlachtet. Als besondere Delikatesse gelten Hunde-
und Pferdefleisch. Gegessen wird aus großen Schüsseln, getrunken aus
flachen Schalen. Spezielle Gefäßformen wie Linsenflaschen und
Röhrenkannen dienen zum Ausschenken von alkoholischen Getränken wie
Wein, Bier oder Met. Nur wenige können sich Tafelgeschirr aus Bronze
leisten, das von weither aus Werkstätten in Italien oder Griechenland
importiert wird.

Aufbruch, Blütezeit und Krise
Zu Beginn der späten Eisenzeit (5. und 4. Jahrhundert v. Chr.) leben
die Menschen in kleinen Dörfern oder in verstreuten Einzelgehöften. Die
Dörfer liegen in der Nähe von Flüssen oder Bächen und sind von guten
Ackerböden umgeben. In einem Dorf wohnen höchstens 100 bis 200
Menschen. Das 3. Jahrhundert v. Chr. ist die Blütezeit der keltischen
Kulturen wie aus dem Nichts entstehen plötzlich größere Siedlungen.
Entweder wandern größere Menschengruppen ein und gründen eine neue
Siedlung oder die Einwohner:innen ziehen aus mehreren kleinen Dörfern
zusammen. Manche neu gegründeten Orte sind genau nach einem
rechteckigen Raster geplant. Die Einwohner:innenzahlen vervielfachen
sich auf 500 bis 2000 Menschen. An den größeren Orten finden regelmäßig
Märkte statt. Hier prägt man Münzen, der Handel und das Handwerk
florieren. Gegen Ende des 2. Jahrhunderts v. Chr. kommt es aufgrund von
inneren Konflikten und äußeren Bedrohungen zu einer Krise. Viele
Menschen übersiedeln an geschützte Orte, auch wenn sie dafür ihre
besten Ackerflächen verlassen müssen. Zum Schutz vor Angreifern
errichten die Einwohner:innen Befestigungsmauern aus Holz und Steinen.
Gleichzeitig dienen die Mauern zur Repräsentation der Bewohnerschaft.
Die größten Befestigungen liegen an wichtigen Verkehrsknotenpunkten und
Flussübergängen, wo sie den Handel und Verkehr kontrollieren.

Schneller, schärfer, bunter
In jedem größeren Dorf sind spezialisierte Handwerker:innen ansässig,
die Geschirr, Werkzeuge, Geräte und Schmuck herstellen. Während in der
Frühzeit die meisten Gegenstände individuell angefertigt werden, setzt
sich ab dem 3. Jahrhundert v. Chr. in vielen Bereichen eine
einheitliche Massenproduktion durch. Die Serienproduktion hält auch
Einzug in die Töpferwerkstätten. Unter den Töpfern:innen breiten sich
neue Techniken wie die schnelle Drehscheibe aus. Auf der Töpferscheibe
können neue Formen wie Linsenflaschen hergestellt werden. Ein begehrtes
Produkt sind feuerfeste Töpfe aus Grafitton, die sich besonders gut zum
Kochen eignen.

Eine erfolgreiche Erfindung gelingt den Glashandwerker:innen. Sie
stellen Armringe in verschiedenen Farben mit unterschiedlichen
Verzierungen her, die vor allem von Frauen gerne als Schmuck getragen
werden. Die Zerbrechlichkeit der Glasringe sorgt für ständige Nachfrage
und steigenden Absatz. Schmiede werden in jeder Siedlung benötigt, um
Reparaturen an den Pflugscharen, Sicheln oder Beilen durchzuführen. Die
Herstellung der eisernen Schwertklingen und der kunstvoll verzierten
Schwertscheiden beherrschen aber nur spezialisierte Waffenschmiede.
Schritt für Schritt ersetzt der Werkstoff Schmiedestahl die
althergebrachte Bronze. Komplizierte Schmuckformen oder figürliche
Darstellungen werden dennoch weiterhin in Bronze gegossen.


Stabwürfel, 2. Jhdt. v. Chr., Geweih, Knochen, Sandstein, Fundort Oppidum Stradonice, Tschechien
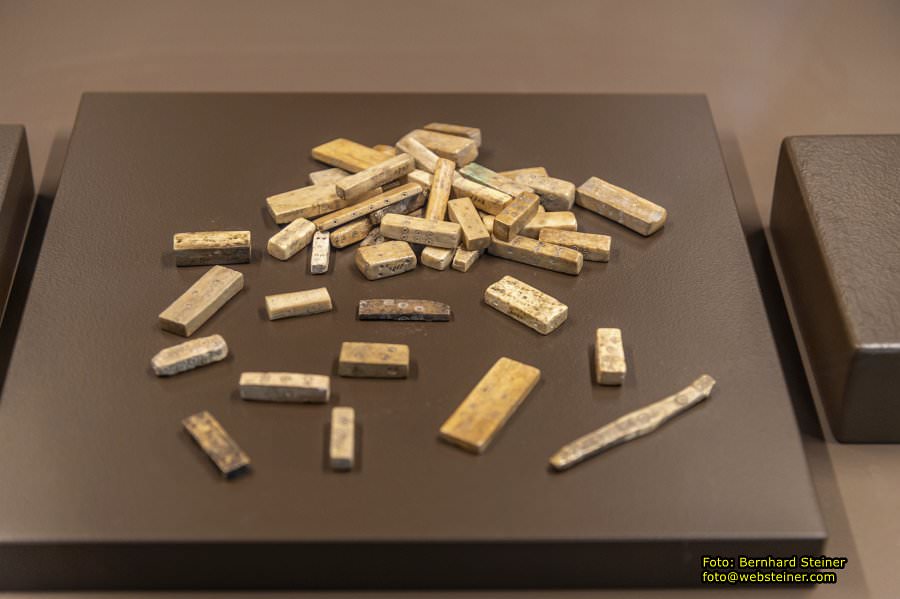
Schädel eines Kriegers mit Operationsspuren, 3. Jhdt. v. Chr., Knochen, Fundort Katzelsdorf, Niederösterreich
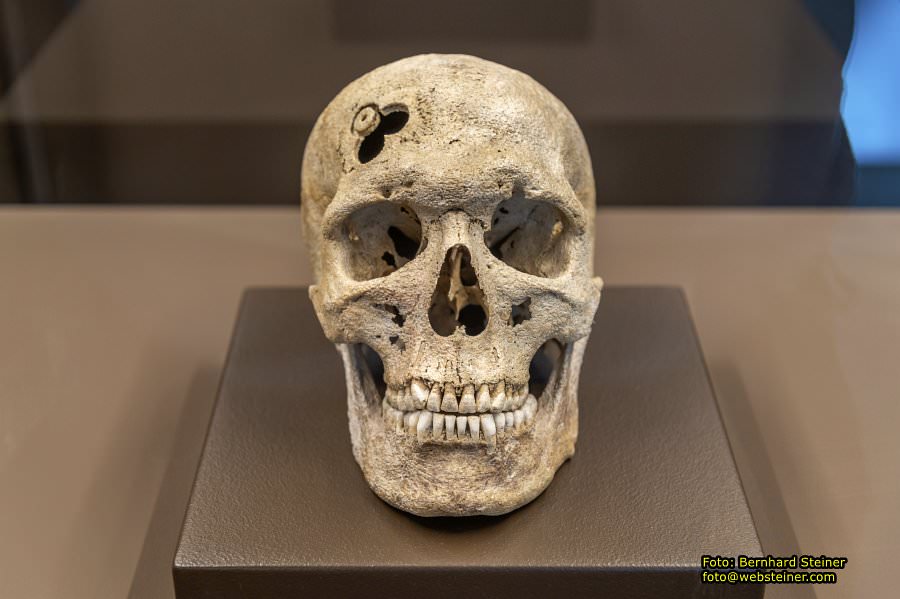
Rituale und Heiligtümer
Profaner Alltag und Religion sind in der Eisenzeit eng miteinander
verknüpft. Wichtige Ereignisse im Leben der Menschen werden von
Ritualen begleitet. Der Bau eines Hauses ist ein solcher Anlass, ein
Opfer darzubringen. Es sollte die künftigen Bewohner:innen vor Unglück
bewahren beziehungsweise über- oder unterirdische Mächte besänftigen.
Man bringt ein Trankopfer in einer Schale dar oder legt ein Amulett in
die Pfostengrube - dort, wo später der tragende Pfosten des Hauses
stehen sollte. Sicherlich gibt es viele weitere Rituale, wie zum
Beispiel Gebete, die für uns heute schwierig verständlich sind, weil
sie wenige oder gar keine Spuren hinterlassen haben.
Im 3. Jahrhundert v. Chr. entstehen Heiligtümer, in denen verschiedene
Gottheiten verehrt werden. In der Großsiedlung von Roseldorf im
Weinviertel befinden sich sogar mehrere Kultbezirke. Die Heiligtümer
sind durch Gräben und Holzpalisaden von der Außenwelt abgegrenzt. Hier
werden Opfer dargebracht, um das Wohlwollen der Götter zu erlangen oder
ein Gelübde einzulösen. In den Heiligtümern werden geopferte Waffen zur
Schau gestellt, Knochen der verstorbenen Krieger aufbewahrt und die
Reste von Tieropfern deponiert. Ein Teil der geschlachteten Tiere
gebührt den Göttern, den anderen Teil verspeisen die
Kultteilnehmer:innen im Zuge der Opferfeste selbst.
Jupiterstatuette, 1. Jhdt. n. Chr., Bronze, Fundort Lienz - Klosterfrauenbichl, Tirol

Kontakt oder Konfrontation
Der Kontakt mit der Militärmacht der Römer verläuft in den Alpen und
östlich davon entlang der Bernsteinroute sehr unterschiedlich. An der
Bernsteinroute verfolgt Rom im 1. Jahrhundert v. Chr. zunächst
wirtschaftliche Interessen. Hier wird nicht nur Bernstein von der
Ostsee bis zur oberen Adria gehandelt. Auch Schmiedestahl aus dem
mittleren Burgenland und Sklaven werden gegen römisches Silbergeld,
Wein und das zugehörige Trinkgeschirr verkauft.
Weniger friedlich verläuft der Kontakt Roms mit den keltischen Stämmen
in den Alpen. Sie werden in zwei Feldzügen 16 und 15 v. Chr.
militärisch unterworfen. Aus diesem Anlass erfahren wir erstmals die
Namen der besiegten Stämme: Norici, Ambilini, Ambidravi, Uperaci,
Saevates, Laianci, Ambisontes und Elveti. Das Gebiet zwischen Osttirol,
Salzburg und dem Wiener Becken wird als Provinz Noricum dem römischen
Reich eingegliedert. Im frühen 1. Jahrhundert n. Chr. sichern die Römer
schließlich auch die Aufmarschroute der Bernsteinstraße militärisch.
Dieses Gebiet wird Teil der Provinz Pannonien. Nördlich der Donau
siedeln sich die germanischen Stämme der Markomannen und Quaden an,
deren Könige von Rom kontrolliert werden und eine militärische
Pufferzone entlang des Limes sichern. Die einheimische
keltischsprachige Bevölkerung lebt zwar in den römischen Provinzen
weiter. Ihre politische Macht und kulturelle Eigenständigkeit gehen
aber mit der Zeitenwende zu Ende.
Nachbildung einer Carnyx, Bronze, Hersteller Stefan Jaroschinski, Frankenberg, Deutschland
Die Carnyx ist ein Blasinstrument, das aufrecht über dem Kopf gehalten
wird. Der Schalltrichter ist in Form eines Wildschweinkopfes gestaltet.
Aus dem geöffneten Maul des Ebers erschallen die Töne. Die Musik
stachelte im Kampf die Krieger an oder begleitete in Heiligtümern die
Kulthandlungen.

Die Kultbezirke von Roseldorf
Am Sandberg liegt die größte keltische Zentralsiedlung Österreichs.
Sieben zeitgleiche quadratische Heiligtümer, verteilt auf drei
Kultbezirke, zeichnen sie vor allem als kultisches Zentrum mit
unterschiedlichen Ritualen aus. Geopfert wurden materielle Güter, vor
allem Kriegsausrüstung wie Waffen, Streitwägen und Pferdegeschirre,
aber auch blutige Opfer von Menschen und Tieren. Vor ihrer Deponierung
im Opfergraben wurden die Opfer meist rituell zerstört und auch
öffentlich zur Schau gestellt.
Opfergaben aus Kultbezirk 2, 3./2. Jhdt. v. Chr., Eisen, Fundort Roseldorf, Niederösterreich
Im Kultbezirk 2 sind hingegen Nabenringe, Felgenklammern, Radbeschläge,
Achsnägel, Zweiknopfstifte, Ösenstifte, Haken und Beschläge von
Streitwägen sowie Ringtrensen, Phaleren aus Eisen und Bronze und
Riementeiler von Pferdegeschirren vorherrschend.
