web steiner
Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen
Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.
+43/2624/54014 - office@websteiner.com
Marchegg
die Storchenstadt im Marchfeld im Weinviertel, Mai 2023
Marchegg ist eine als Storchenstadt bekannte
Stadtgemeinde im Bezirk Gänserndorf und gehört formal zum Weinviertel,
einem der vier Landesteile Niederösterreichs. Marchegg ist das Beispiel
für „Vergangenheit mit der Brücke in die Zukunft“. Die Stadt wurde im
Jahr 1268 von König Przemysl Ottokar an der schon damals natürlichen
Grenze Marchfluss als Bollwerk gegen die Magyaren erbaut. Aktuelle
Forschungsergebnisse beweisen, dass Marchegg im Mittelalter die größte,
geplante Stadt im Osten Österreichs war.
Davon zeugen eine Reihe von gut erhaltenen Sehenswürdigkeiten. Die
Reste der 8 Meter hohen Stadtmauern rund um Marchegg geben einen
Überblick, wie ernst es König Ottokar mit seinen Bestrebungen war, sich
und seine Untertanen gegen Feinde abzusichern – rund zehn Jahre vor der
letzten großen Ritterschlacht auf heute österreichischem Boden (bei
Jedenspeigen). Erhalten sind auch Wiener Tor und Ungartor, ehemals
Wachtürme und Zugänge in die Stadt.

VON DER STADTBURG ZUM WOHNSCHLOSS
Die kastellartige Stadtburg von Marchegg entstand im 13. Jahrhundert
innerhalb der wehrhaften Stadtanlage. Die Burg wurde bis ins 16.
Jahrhundert zu einer Befestigung ausgebaut, wobei die Grafenfamilie
Salm erstmals Wohnräume errichtete. In der Barockzeit diente das
Schloss der Adelsfamilie Pálffy als Lust- und Jagdschloss. Es erhielt
die Merkmale eines fürstlich-barocken Repräsentationsbaus. Nach dem 2.
Weltkrieg erwarb die Stadtgemeinde Marchegg Schloss Marchegg. Wohnungen
und ein Jagdmuseum entstanden. In den Jahren 2020 bis 2022 wurde das
Schloss für die heutige Nutzung generalsaniert.

Schloss Marchegg liegt am Naturreservat Marchauen. Weitläufige
Auwälder, Wiesen und Augewässer sind Heimat von über 500 gefährdeten
Tier- und Pflanzenarten, die hier oft ihr letztes Refugium finden.
Jahrhundertelang wurde das Gebiet intensiv forstwirtschaftlich genutzt.
Nach dem Erwerb durch den WWF und der Ausweisung als Schutzgebiet wurde
diese Nutzung zurückgenommen. Große Waldgebiete können sich seitdem
natürlich entwickeln und altern. In einem intakten Ökosystem stehen
sich Räuber und Beutetiere gegenüber. Weil Beutegreifer wie Wolf oder
Luchs fehlen, greift der Mensch ein, um größere Wildschäden an Wald und
Wiesen zu verhindern.

WEISSSTORCH, STEHEND (ciconia ciconia)
Der Weißstorch ist unverkennbar elegant. Bis auf die schwarzen
Schwungfedern und Teile der schwarzen Flügeloberseiten ist er weiß.
Seine Beine und der lange Schnabel sind auffällig rot. Bei Jungstörchen
sind Beine und Schnäbel noch grau-rosa. Erst mit der Geschlechtsreife
bekommen sie die rote Farbe.

EIN KÖNIG, ADELIGE & FÜRSTEN
Im 13. Jahrhundert errichtete König Ottokar II. Přemysl als Grenzschutz
eine befestigte Burg in Marchegg, die fortan von Adeligen im Dienste
der habsburgischen Herrscher verwaltet wurde. Im 16. Jahrhundert wurde
Schloss Marchegg erstmals von der Adelsfamilie Salm als Wohnsitz
gewählt. 1630 erwarb die ungarische Adelsfamilie Pálffy von Erdöd das
Schloss, die es fortan nur für besondere Gelegenheiten nutzte und erst
nach dem 1. Weltkrieg dort ständig wohnte. In den 1950er Jahren
bewahrte eine Initiative der Marchegger Bevölkerung Schloss Marchegg
vor dem Abriss. Seitdem im Besitz der Stadtgemeinde dient es wieder als
Verwaltungssitz und Veranstaltungsort wie bereits Jahrhunderte zuvor.

1268: KÖNIG OTTOKAR II. PREMYSL
König Ottokar II. Přemysl, dem Franz Grillparzer im Trauerspiel „König
Ottokars Glück und Ende" ein Denkmal setzte, gehört zu den bekanntesten
österreichischen Herrschern. Als Herzog von Österreich konnte er nach
seiner Machtübernahme die einflussreichen Landherren für sich gewinnen
und sein Reich von Böhmen bis zur Adria ausdehnen. Eine geschickte
Finanzpolitik, die Förderung von Städten, Handel und Verkehr ließen
Ottokar zum reichsten Fürsten seiner Zeit werden. 1268 gründete er an
der Reichsgrenze die Stadt Marchegg mit einer dazugehörigen Stadtburg.
Durch die harte Unterdrückung politischer Gegner im eigenen Reich schuf
sich Ottokar persönliche Gegner. Deshalb könnte ein Vergeltungsakt der
Grund für die Ermordung Ottokars in der Schlacht bei Dürnkrut und
Jedenspeigen im Jahr 1278 gewesen sein.
1451: BERNHARD VON MITTERNDORF
Die Habsburger, als neue Landesherren ständig in Geldnot, verpfändeten
die Burg Marchegg bis ins 17. Jahrhundert an treu ergebene
Landesfürsten. So wurde Schloss Marchegg im Laufe der Jahrhunderte an
viele unterschiedliche Verwalter übergeben, die die Burg in Stand
halten mussten. Besonders nach kriegerischen Zerstörungen oder
Naturkatastrophen war dies für den jeweiligen Pfandinhaber eine teure
Angelegenheit, weil die Burg als Grenzsicherung für zukünftige
feindliche Angriffe gerüstet sein musste. 1451 erhielt der königliche
Rat und Kämmerer Bernhard von Mitterndorf und sein Sohn Stephan von
Kaiser Friedrich III. die Herrschaft Marchegg. Es ist überliefert, dass
das Schloss in dieser Zeit „erheblich verbessert" wurde.
1568: NIKLAS III. GRAF ZU SALM
1568 übersiedelte Niklas III. Graf Salm von seinem bisherigen
Hauptwohnsitz Schloss Orth nach Schloss Marchegg. Die Grafen zu Salm
gehörten zu den bedeutendsten Herrschaftsgeschlechtern am
habsburgischen Hof.
Für diese hochadelige Familie mit besten internationalen Verbindungen
musste Schloss Marchegg repräsentativ ausgestattet werden. Deshalb
wurde die mittelalterliche Burg zu einem Wohnschloss mit modernsten
renaissancezeitlichen Architekturformen umgebaut. Eine eigene Treppe
für den Empfang von Gästen, ein Wohntrakt für die Gräfin und ein
Studierzimmer für den Grafen gehörten zur typischen Ausstattung. Dieser
Prunk stand ganz im Gegensatz zu den Untertanen von Graf Salm. Deren
Häuser, Gärten und Äcker waren durch ständige Hochwässer und Kriege
verödet und wurden deshalb von der Adelsfamilie neu gestiftet.
1621-1948: FAMILIE PÁLFFY VON ERDÖD
Mit der Verschreibung als Lehen an die Familie Pálffy von Erdöd, einem
der ältesten ungarischen Adelshäuser, beginnt in Schloss Marchegg eine
neue Ära. Graf Paul IV. Pálffy erhielt im Jahr 1630 die Herrschaft
Marchegg als erbliches Eigentum, womit das Ende des landesfürstlichen
Besitztums besiegelt wurde. Der hohe Wildbestand in den Donau- und
Marchauen ermöglichte die Jagd, weshalb das Schloss im 17. und 18.
Jahrhundert nur für repräsentative Festivitäten als Jagd- und
Lustschloss genutzt wurde. Unter Graf Nikolaus VII. Pálffy, geheimer
Rat und ungarischer Hofkanzler, erhielt Schloss Marchegg mit der großen
Barockfassade sein heutiges Aussehen. Eine Gartenanlage mit Nutzgärten
und Orangerie vervollständigte die typisch barocke Schlossanlage.
Kaiserin Maria Theresia war mehrfach in Marchegg zu Gast. Zu ihrer
Freude wurde im Festsaal 1766 ein Theater eingerichtet, welches bis
1843 bestand. Nach dem 1. Weltkrieg musste die Familie Pálffy ihren
Stammsitz im slowakischen Schloss Malacky verlassen und übersiedelte
ins Schloss Marchegg. Nach drei Jahrhunderten im Besitz der Familie
wurde das Schloss erstmals zu ihrem Hauptwohnsitz. Mit dem Tod von
Fürst Ladislaus Pálffy erlischt die fürstliche Linie und ihre
Herrschaft über Schloss Marchegg.
SEIT 1953: STADTGEMEINDE MARCHEGG
Schloss Marchegg war nach Ende des 2. Weltkriegs schwer beschädigt und
geplündert worden. Die Erbin, Anna Elisabeth Schönauer, wollte das
Schloss veräußern. Als sich kein Käufer fand, stimmte das
Bundesdenkmalamt einem Abriss zu. Dagegen regte sich Widerstand in der
Marchegger Bevölkerung und Pressemeldungen kritisierten diese
Entscheidung. Die Proteste hatten Erfolg: Im Jahr 1957 erwarb die
Stadtgemeinde Marchegg mit Hilfe des Landes Niederösterreich und einer
Spendenaktion das Schloss. Es folgte die Sanierung und der Einbau von
18 Wohnungen, eines Jagdmuseums als Außenstelle des NÖ-Landesmuseums
und kulturhistorischer Ausstellungen.
Nach Schließung des Jagdmuseums wurde es ruhig im Schloss. Erst
anlässlich der NÖ-Landesausstellung 2022 wurde Schloss Marchegg aus dem
Dornröschenschlaf geholt.

BAROCKE JAGD
Die Jagd diente zunächst einzig der Nahrungsversorgung. Mit dem
Aufkommen der Landwirtschaft veränderte sich ihr Stellenwert
grundlegend. Herrschaftliche Repräsentation oder bloßes Vergnügen
rückten zunehmend ins Zentrum. Die Jagd wurde im Mittelalter zum
herrschaftlichen Privileg - weite Teile der Natur entzogen sich einer
Nutzung durch das „gemeine Volk". Im Barock erreichten der Ausbau
dieses Hoheitsrechts und die höfische Jagdkultur ihren Höhepunkt. Dass
sich Reste der Aulandschaft in der Nähe zu Wien bis heute erhalten
haben, ist der adeligen Jagdlust zu verdanken, denn die kaiserlichen
Jagdreviere waren von einer landwirtschaftlichen Nutzung ausgenommen.
Jagdhorn / Krickerl auf Holztrophäenplatten / Rothirschgeweih

TREIBJAGD AUF ROT- UND SCHWARZWILD IN DEN DONAUAUEN
Das Wild wurde von Treibern und Meute verfolgt und in ein mit Tüchern
oder Netzen abgesperrtes Gebiet getrieben. Am Jagdtag wurde es durch
einen Gang, den sogenannten „Lauf", direkt vor die Visiere der
Jagdgesellschaft gehetzt. Um weniger treffsicheren Schützen einen
Erfolg zu garantieren, führte Kaiser Leopold I. aufwendige Wasserjagden
ein, in welchen das Wild durch einen Flusslauf getrieben wurde. Die zur
Jagd verwendeten Steinschlossgewehre waren in der Manipulation behäbig.
Das langsamer vorankommende Wild gab den Schützen mehr Zeit bei
Fehlschüssen nachzuladen oder eine neue Flinte zu nehmen.

MARCHEGGER STADTWAPPEN
Das Stadtwappen von Marchegg beruht auf dem ältesten bekannten Siegel
der Stadt, das die Heilige Margareta mit einem Drachen zeigt. Auch die
Stadtpfarrkirche ist ihr geweiht.

Südwestlicher Rundturm (13. Jahrhundert)
Durch die begleitenden archäologischen Forschungen war es möglich,
einen Großteil der mittelalterlichen Mauern und Türme der Wasserburg im
archäologischen Befund zu erfassen. Die erhaltenen Mauerstrukturen des
südwestlichen Rundturmes konnten vollständig freigelegt werden. Die
beachtlichen Dimensionen des Turmes mit Außendurchmesser von fast 9
Metern und einer Wandstärke von rund 3 Metern kamen erst bei der
Freilegung ans Tageslicht.

Mittelalterliche Chroniken berichten von der Stadtgründung durch den
böhmischen König Ottokar II. Přemysl im Jahr 1268. Es entstand nach
Wien auf 62 Hektar die flächenmäßig größte, mittelalterliche Stadt des
Herzogtums Österreich. Diese außergewöhnliche Ausdehnung wird mit der
Funktion eines im Grenzgebiet zu Ungarn günstig gelegenen Truppen- und
Proviantsammelplatzes erklärt. Über die Jahrhunderte entwickelte sich
die Storchenstadt Marchegg zu einem Ort der historischen Schätze, des
naturnahen Lebensraumes und zu einem touristischen Geheimtipp.
Das störchigste Schloss Österreichs am Rande der Unteren Marchauen
verbindet Natur & Kultur auf ganz besondere Weise und bietet
vielfältige Möglichkeiten für abwechslungsreiche Besuche und Ausflüge.

Die Planungen der Stadt Marchegg begannen in den Jahren um 1260 nach
dem Sieg des Böhmenkönigs Ottokar II. Přemysl über die Ungarn. Als
strategische Befestigungsanlage mit einer Stadtmauer von 3 km Länge und
drei Stadttoren kam dieser Stadt eine große Bedeutung zu. Heute kann
man über den historischen Rundwanderweg die beeindruckenden, bis heute
erhaltenen Anlagen besichtigen, sowie das Schloss Marchegg, welches im
Zuge der Niederösterreichischen Landesausstellung 2022 generalsaniert
wurde.
Das barocke Schloss, welches bis in die 1940er Jahre im Besitz der
Fürstenfamilie Pálffy war, zeugt an zahlreichen Stellen von seiner über
750-jährigen Baugeschichte. Teile aus der mittelalterlichen Burganlage
um 1268 können im Inneren des Schlosses (Zugang über das Storchenhaus)
aus nächster Nähe besichtigt werden.

SCHLOSSPARK
Erst mit der Herrschaft der Familie Pálffy ab Anfang des 17.
Jahrhunderts ist die systematische Anlage von Gartenanlagen um Schloss
Marchegg historisch belegt. Bei Bodenradaruntersuchungen wurde
festgestellt, dass der Schlosspark neben Nutzgärten und einem
Landschaftsgarten im 18. Jahrhundert eine für die damalige Zeit
ungewöhnlich große Orangerie hatte, die heute nicht mehr erhalten ist.

Marchegg war im Mittelalter von einer imposanten Stadtmauer mit Wall
und Stadtgraben umgeben. Drei Tore führten in die Stadt: das um 1900
abgetragene Groißenbrunnertor (Hainburgertor), das Wienertor und das
Ungartor mit seinen gotischen Sitznischen. Die Stadtmauer war mit
Zinnen circa 10m hoch und 2m dick. Über 50.000 Ochsenkarren mit Steinen
mussten herbeigeschafft werden. Die Mauersteine wurden über
Jahrhunderte für Hausfundamente und Straßenbau verwendet.
WIENERTORTURM
Reste des seitlichen Rundturmes des ehemaligen WIENERTORES.
Ursprünglich enthielt die Wehranlage 3 befestigte Stadttore mit
angebauten Rundtürmen und Zugbrücken. Die Rundtürme dienten als
Aufgänge zu den eckigen Tortürmen und als Wohnraum für die Turmwärter.
1802 wurde der letzte Türmer (Brandmelder) entlassen.

HAUPTPLATZ: STÄDTISCHES FLAIR
Mit der Anlage einer Lindenallee und eines Parks am Hauptplatz zu
Beginn des 20. Jahrhunderts und der Aufnahme des gemeindeeigenen
Autobusverkehrs im Jahr 1926 wurde das Ortsbild von Marchegg immer
städtischer.

Am Hauptplatz von Marchegg befindet sich eines der ältesten Denkmale
der Stadt, die Mariensäule. Ursprünglich ein Pranger für die niedere
Gerichtsbarkeit, wurde sie erst Mitte des 19. Jahrhunderts zu einer
Mariensäule umgewandelt.

Der einst größte Hauptplatz Mitteleuropas war wahrscheinlich als
Truppensammelplatz oder/und Warenumschlagplatz konzipiert. Daraus ist
auch die spezielle Lage der Kirche in dessen Ecke erklärbar. Der
Marchegger Heimatforscher Emil Mück vermutete, dass sich bereits vor
der Stadtgründung eine kleine Kirche an diesem Ort befunden haben
könnte.

DAS EHEMALIGE MARCHEGGER RATHAUS
Von 1968 bis 2023 diente das ehemalige Schulgebäude der Stadtgemeinde Marchegg als Amtssitz.

Weitere Sehenswürdigkeiten bieten die Stadtkirche Marchegg zur heiligen
Margareta mit Ihrem frühgotischen Chor, sowie der Hauptplatz mit dem
Ottokar Denkmal. Auf dem Rundweg um die Stadt gelegen befindet sich
zudem ein Reihe an interessanten Naturschauplätzen. Der Pulverturm
umgeben von Tümpelwiesen, welche heute ein strenges Naturschutzgebiet
darstellen, beherbergt wahre Raritäten, wie die Urzeitkrebse, der
Triops oder der Feenkrebs.
Ein ganz besonderes Highlight bieten unsere Störche, welche von März
bis August direkt auf dem Schlossdach sowie im Schlossareal, in der
Stadt Marchegg und auf alten Eichen ihren Nachwuchs großziehen. Die
Marchauen entlang des Gebietes von Marchegg beherbergen die größte auf
Bäumen brütende Weißstorch-Kolonie Mitteleuropas.

JOHANNESSTATUE Hl. Johannes Nepomuk
Im Volksmund früher „Hansl am Weg" genannt, stand dieser BRÜCKENHEILIGE
bis ins 19. Jhdt. bei der Marchüberfuhr (Urfahr). Seit 1271 (König
Ottokar) befand sich an jener Stelle bis zumindest 1584 eine Brücke.
Sockel: Wappen der Palffys und Stadtrichterwappen (leider zerstört).
Die zweistufige Grundplatte liegt jetzt unterhalb der Erde.

HOCHWASSER IN MARCHEGG, 1899
Am sogenannten Hochwasserstein sind die Daten der schwersten Hochwässer in Marchegg vermerkt.
Unsere grössten Hochwässer
Errichtet von der Stadtgemeinde Marchegg 1949
5,41 ... 1.XI.1787
5,21 ... 7.II.1862
5,15 ... 1768
5,01 ... 7.III.1830
4,98 ... 7.III.1838
4,84 ... 19.IX.1899

DENKMAL KÖNIG OTTOKAR II. PŘEMYSL
Anläßlich der 750-Jahre Feier der Stadtgründung von Marchegg wurde im
Jahr 2018 ein Denkmal zu Ehren des Stadtgründers König Ottokar II.
Přemysl errichtet.
REX PRZEMYSL
II OTTAKARVS
CONDITOR
VRBIS MARCHEGG
MCCLXVIII

Freiwillige Feuerwehr Marchegg
mit Abschleppanhänger, Marke/Typ: Humer, Baujahr: 2021

Die Statue der Heiligen Elisabeth wurde 1953 in Marchegg aufgestellt
und 1969 geweiht. Sie war ein Geschenk des Bundesdenkmalamtes. Die
Heilige Elisabeth wurde 1207 als Tochter des ungarischen Königs Andreas
II. und seiner Frau Gertrud von Kärnten geboren und ist eine der
berühmtesten Heiligen des Mittelalters. Sie war schon mit vier Jahren
ausersehen, sich mit dem damals zwölfjährigen Erbprinzen Ludwig zu
verloben und mußte bereits mit vier Jahren ihre Heimat Ungarn
verlassen. Nach dem Tod des Vaters rückte Ludwig nach und trat das Erbe
an. Ludwig liebte Elisabeth und ging mit ihr den Bund der Ehe ein. Das
Fundament für eine wahrhaft herausragende Ehe war gelegt. Für die
Landgräfin Elisabeth galt das Jesuswort: „Was ihr einem meiner
geringsten Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr mir getan.“
(Mt 25, 40)
Die bekannteste Elisabeth-Legende entstand erst im 15. Jahrhundert und
erzählt vom „Rosenwunder“: Als Elisabeth mit einem Korb voll Brot zu
den Armen gehen wollte, kam ihr Mann hinterher – aufgestachelt von
Leuten, die sie als Verschwenderin bezeichnet hatten. Ludwig deckte den
Korb auf, doch dieser war voll blühender Rosen.
Hl. Elisabeth am Kirchenplatz

STADTPFARRKIRCHE ZUR HEILIGEN MARGARETA
Der Kirchenbau wurde wie die Stadt Marchegg von König Ottokar
gegründet. Am 15. August 1268 übergab er dem Johanniterorden von
Mailberg das Patronatsrecht über die Kirche. 1790 erhielt die Kirche
den Zubau des niederen Langhauses und 1856 den Kirchturm und damit ihr
heutiges Erscheinungsbild.
Der sporadische Besucher ist oft etwas irritiert, die Kirche in der
mittelalterlichen Stadt nicht sofort zu entdecken und danach nochmals
wegen ihres nicht alltäglichen Erscheinungsbildes. Ersteres erklärt
sich durch die spätere Verbauung des einst riesigen Hauptplatzes. Die
unterschiedlichen Höhen des Kirchenschiffes werden durch den erst 1790
erfolgten Anbau eines stark verkürzten Langhauses verständlich. Davor
war nur der Chorraum nutzbar und durch eine Brustmauer abgeschlossen.
Die Architektur eines Gotteshauses aus sehr unterschiedlichen Epochen,
wobei der hohe gotische Teil (Chor) als eines der letzten erhaltenen
Bauwerke aus der Marchegger Gründungszeit des 13. Jh. zu bewundern ist.

Die Kirche als zentraler Punkt bei der Stadtplanung
Durch die Erfahrungen bei der siegreichen Schlacht 1260 gegen den
Ungarkönig Bela IV. war der Bau einer befestigten Stadtanlage für
Ottokar II. eine strategische Notwendigkeit. Damals waren Leben und
Glauben ebenso eine Einheit wie Staat und Kirche. Daher ist auch die
Planung der Stadt mit jener der Marchegger Kirche eng verknüpft.
Der Kirchturm (1853-1856) ruht auf 170 Eichenstämmen (Sandboden), da
der vorherige Glockenturm nach wenigen Jahrzehnten einzustürzen drohte.
Bis 1776 waren die Glocken auch die älteste und größte von 1409 - im
Dachreiterturm montiert.
Das Mosaik über dem Kirchentor stellt Christus Pantokrator (= Allherrscher) dar.

Glasmalerei Flügeltüre - Die verglaste Flügeltüre wurde 1929 als Windfang eingebaut.

Im Mittelalter war es bekanntlich üblich, Kirchen nach der aufgehenden
Sonne zu orientieren. (Sonne = Symbol für Christus). Die Ausrichtung
erfolgte in 2 Stufen: Zuerst wurde das Langhaus an einem Wochentag
vermessen (= weltliche Achse), an einem Sonn- oder Feiertag die
Orientierung des Chores (= himmlische, göttliche Achse). Der Knickpunkt
als Grenze zwischen Tod und Auferstehung. E. Reidinger errechnet für
Marchegg die Daten 5. und 8. April. - Ostern 1268. Bedeutung: Während
der Auferstehungsliturgie in den Morgenstunden des Ostersonntags
strahlt die aufgehende Sonne durch das hohe Mittelfenster in den
dunklen Kirchenraum! Christus ist auferstanden!
Beim Blick vom Eingangsbereich in Richtung Hochaltar ist die Abweichung nach links (Kirchenknick) erkennbar.

Der hohe Chor aus den 1260er Jahren zählt kunstgeschichtlich zu den
wichtigsten frühgotischen Bauwerken in Österreich. Die Kirche wurde
etwa gleichzeitig mit der Stadt von Ottokar II. Přemysl gegründet. Das
Vorhaben einer imposanten Kirche könnte auch ein Indiz dafür sein, dass
vielleicht Bischof Bruno von Schauenburg hier eine Kathedrale der
Diözese Olmütz plante. Die befestigte Stadtanlage samt Kirche ist die
einzige des Böhmenkönigs in Österreich und gilt als größte Neugründung
im Mittelalter. Urkundlicher Beleg für den Kirchenbau ist folgender
Passus in der Patronatsurkunde von 1268: „...deshalb haben wir das
Patronatsrecht der Kirche zu Marchegg (apud Marchek), das uns aus dem
Titel der Gründung der Kirche zusteht..."

Die Kreuzwegbilder stammen von Josef Kessler, einem Schüler Leopold Kupelwiesers aus der Zeit um 1850.

Nordseitige Fenster im Langhaus: Hl. Notburga

Südseitige Fenster im Langhaus: Hl. Paul vom Kreuz

Beim Betreten der Kirche ist man durch das schmucklose, niedrige
Langhaus nicht sehr beeindruckt, umso mehr aber beim Gang nach vorne.
Der schlanke, hoch aufragende gotische Chorraum lässt sofort erahnen,
welch monumentale Kathedrale hier entstehen sollte! Die
lichtdurchflutete, dem Himmel zustrebende Architektur der frühen Gotik
eine überwältigende emotionale Erfahrung bei den Menschen der damaligen
Zeit. Größe und Form ist mit jener des Wr. Neustädter Domes identisch -
der weitere Ausbau der Kirche kam aber nach dem Tod des Böhmenkönigs
ins Stocken. Das gotische Presbyterium wurde erst um 1330 von den
Habsburgern fertiggestellt. Rudolf I. hat bekanntlich 1278 nach der
Rettung aus Todesgefahr den künftigen Schutz über die Marchegger Kirche
gelobt.
Die Altarnische (Apsis) wird von 5 Seiten eines Achtecks begrenzt. Das
Kreuzrippengewölbe endet in einer Höhe von über 14 m. Die Schlusssteine
zeigen die hl. Margareta, das Lamm Gottes, ein Blattornament und eine
Blattmaske. Von besonderer Wertigkeit auch die beiden erhaltenen
Fresken, die den hl. Petrus und den hl. Johannes den Täufer darstellen.
Die Mauern und Säulen stammen noch aus dem 13. Jh., das Gewölbe wurde
erst im frühen Folgejahrhundert aufgesetzt.
Der mächtige barocke Hochaltar aus dem Jahr 1688 weist eine imposante
Höhe auf. Das Schwert des hl. Michael berührt sogar das Deckengewölbe
und stützt damit auch die Statue. Verblüffend die hohe handwerkliche
Schnitzkunst und alte Maltechnik. Der Eindruck eines steinernen
Aufbaues mit zierendem Marmor ist nur Illusion! Der Hochaltar ruht auf
dem ehemaligen Altartisch, der von einer alten Grabplatte abgedeckt
ist. Inschrift und Herkunft sind leider noch nicht erforscht.

Kanzel
Dieser Balkon für den Prediger wurde erst Jahre nach dem Hochaltar um
1725 errichtet. Über dem Schalldeckel ist eine eher seltene
Gottvater-Pietà zu sehen -zusammen mit der Taube darunter die
ungewöhnliche Darstellung der Hl. Dreifaltigkeit (Trinität). Am
Kanzelkorb die Attribute der 4 Evangelisten als Zeichen, dass der
Prediger Gottes Wort zu verkünden hat. Löwe (Auferstehung Markus),
Adler (Himmelfahrt, Johannes), Mensch (Menschwerdung, Matthäus), Stier
(Opfertod, Lukas)
Seltener Seitenaltar im Jugendstil
Eine kunsthistorische Rarität ist dieser secessionistische Altar, der
von Pfarrer Franz Groiß 1909 anlässlich seines 25jährigen Jubiläums als
Marchegger Pfarrer errichtet wurde. Gebaut von Hans Prutscher, einem
Schüler Otto Wagners. Vergoldete Statuen von Josef und Maria sowie
deren Eltern Anna und Joachim. Die Christusstatue stammt vom ehemaligen
Herz-Jesu-Altar. Neben Gotik und Barock ist als dritte Kunstrichtung
damit auch der Wiener Jugendstil in der Kirche vertreten.

Oratorium
Dieser Gebetsraum entstand 1790 im Zuge der Errichtung des Langhauses
unter Karl Graf Pàlffy ab Erdöd (ab 1807 Fürst). Da die Adelsfamilie
nur nach besonderer Genehmigung Messen in der Schlosskapelle feiern
durfte, baute man diesen komfortablen Nebenraum, der sogar beheizt
werden konnte. (Umgekehrt wurden bei Hochwasser Gemeindemessen im
Schloss gefeiert - legendär Kaplan Schwartz als Prediger hinter einem
Paravent auf einer Holzkiste!)
Für die Ausstattung des Oratoriums wurden auch Teile eines
aufgelassenen Altares verwendet. Samtbezogene Kniebänke sind noch
erhalten, ebenso die Abzugsöffnung für das Rauchrohr. Bis in die
Nachkriegszeit war der untere Bereich noch offen (hl. Grab)
möglicherweise befand sich in diesem höheren Kirchenanbau ursprünglich
eine in alten Schriften erwähnte St. Petri-Kapelle.

Auch an den gotischen Spitzbogenfenstern ist eine Bauunterbrechung
erkennbar. Die schlichte Fensterform stammt aus dem 13. Jh., während
die Maßwerke aus späterer Zeit stammen. (Sphärische Dreipässe tauchen
erst im 14. Jh. auf!) Die ursprüngliche Glasmalerei ist nicht mehr
erhalten, die Fenster wurden in den letzten Kriegstagen zerstört. Nur
die farbprächtigen Scheiben in den oberen Maßwerken stammen noch aus
älterer Zeit. Die nördlichen Fenster waren für längere Zeit vermauert,
die Glasmalerei von 1890 ist als einzige erhalten. Die späte Öffnung
des Spitzbogenfensters ist an den hier kreisförmigen Dreipässen
erkennbar. Das Mittelfenster wurde nach Errichtung des Hochaltares
vermauert.
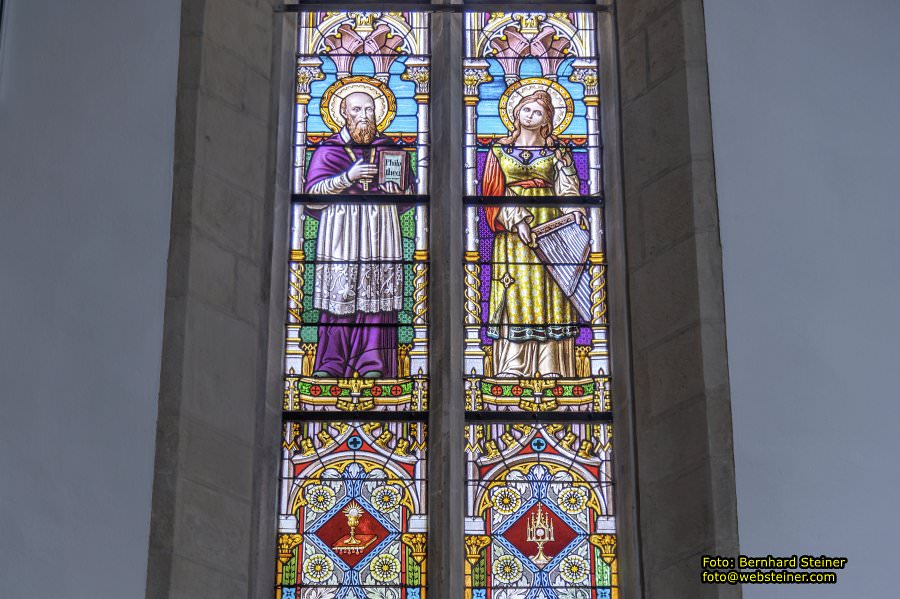
Das dominierende Altarbild der hl. Margareta stammt von Karl Wurzinger,
einem Schüler des bekannten österreichischen Malers Leopold
Kupelwieser, und stammt aus dem Jahre 1855. Davor befand sich an dieser
Stelle das Bild „Erlöser am Kreuze". Bei der Errichtung des Hochaltares
1688, in der Ära des Grafen Johann Pàlffy ab Erdöd, wurde auch oberhalb
des Altarbildes das Pálffy-Wappen montiert. Das ovale Marienbild wurde
erst später hier angebracht und hing früher an der nördlichen
Seitenwand.
An den Seiten links: Hl. Florian, rechts: Hl. Johannes der Täufer

Langhaus
Der schmucklose und niedrige Zubau von 1790 ist kunsthistorisch kaum
beachtenswert und ist aus rein praktischen Gründen entstanden. An der
Südseite, gegenüber dem Seiteneingang, befand sich früher ein
Seitenaltar mit den Heiligen Leonhard und Wendelin (Schutzpatrone für
Bauern und Vieh), der wahrscheinlich aus einer der Seitenkapellen
stammte. Altarteile wurden 2009 bei der Glockenreparatur im Turm
entdeckt und gesichert. Das ehemalige Altarbild hängt heute im
Eingangsbereich der Kirche.
Die einmanualige Orgel ist klangmäßig der Frühromantik zuzuordnen. Sie
ist ausgestattet mit pneumatischer Kegellade, 10 Registern und über
vierhundert Pfeifen aus Holz sowie Metall mit unterschiedlichen
Anteilen an Blei. Dokumentiert ist der Umbau des Instrumentes im Jahre
1890 durch den Orgelbauer Johann Drabek (Slowakei, damals Ungarn). 1970
war die Orgel nicht mehr bespielbar. Wieder in Betrieb erst ab 2018,
nach einer Generalreinigung durch Matthias Müller (D). Unter Mitarbeit
freiwilliger Helfer wurden dafür hunderte Arbeitsstunden aufgewendet.

Hl. Petrus / Lamm Gottes / Hl. Johannes der Täufer

Die hl. Margareta als Kirchenpatronin
Für die Bestimmung der Kirchenheiligen können 3 Gründe maßgebend gewesen sein:
a) Margareta von Babenberg, die erste Ehefrau Ottokars und Schwester
Friedrichs II., da zwischen ihnen auch noch nach deren Trennung eine
gute Beziehung bestanden haben soll.
b) Sehr wahrscheinlich ist die Danksagung für den glorreichen Sieg
Ottokars gegen den ungarischen König Bela IV. im Jahre 1260. Vereinbart
war der damals sehr wichtige Margaretentag, der im Prager Bistum am 13.
Juli gefeiert wurde. Für den Ungarkönig war es aber der 12. Juli des
Passauer Bistums, wodurch sein verfrühter Angriff den Böhmenkönig
anfangs in große Bedrängnis brachte.
c) Möglich auch die Entscheidung für die hl. Margareta als
Schutzpatronin für Landwirtschaft und Fruchtbarkeit, da das umliegende
Gebiet noch urbar gemacht werden musste.
Die Heilige wird zumeist dargestellt mit einem Drachen oder einer
großen Schlange zu ihren Füßen als Symbol für die Versuchung durch den
Teufel sowie einem Kreuz als Zeichen ihrer Standhaftigkeit. Manchmal
sind die Attribute auch Fackel und Kamm (Folterwerkzeuge).

Ausrichtung der Kirche
Zum Verständnis muss man sich wieder bewusst machen, dass es ein
zentrales Anliegen der Menschen im 13. Jh. war, Bauwerke sichtbar in
die göttliche Ordnung der Schöpfung einzubetten. Darum wurden Kirchen
in dieser Zeit vorzugsweise Richtung Osten orientiert („Orientierung"
von „Orient" im Osten), weil dort nach den Schriften das himmlische
Jerusalem oder das Paradies liegen sollte. Der Sonnenaufgang als Symbol
für die Auferstehung Christi bietet ebenfalls eine einleuchtende und
nachvollziehbare Erklärung für die Anordnung des Altarraumes an der
Ostseite der Kirche.
Die Fragen nach dem „Wie" und „Wann" sind recht bald geklärt: Der
Zeitpunkt der Absteckung des Grundrisses lässt sich mit etwas
Rechenaufwand genau nachvollziehen: Am Gründonnerstag 1268 wurde die
Längsachse des Langhauses (weltliche Achse für Laien und
Pfarrgemeinde), am Ostersonntag jene des Chorraumes (göttliche Achse
Altar, Klerus) bestimmt. Bei Sonnenaufgang wurde ein Pflock in den
Boden geschlagen, dessen Schatten die Richtung vorgab. (Bei bedecktem
Himmel wurde ein Kompass verwendet.)
Für die Ausrichtung wurde ein besonderer Termin (Tag des
Kirchenheiligen, besonderer Festtag) gewählt, in Marchegg war es sogar
das kirchliche Hochfest der Auferstehung des Herrn! Rein praktische, ja
profane Gründe sprechen für die Vermessung im Frühjahr, da die
Bausaison normalerweise nach dem Winter ihren Anfang nahm.
Warum der Chorraum erst drei Tage später abgesteckt wurde, wird ein
Geheimnis bleiben! Überliefert ist nur, dass die Vermessung des
Presbyteriums grundsätzlich in Anwesenheit eines kirchlichen
Würdenträgers stattfand. Der dadurch entstandene Knick in der
Kirchenachse ist nichts Einmaliges bei Gründungen in dieser Zeit - eine
theologische Begründung ist bislang aber nicht bekannt.

UNGARTOR, erbaut um 1268
Das einzige Stadttor, bei dem der Rundturm LINKS angebaut wurde.
Beachtenswert das zierliche Spitzbogenfenster an der Innenseite, die
gotischen Nischen an der Außenseite sowie die Steinfuge für das
Fallgitter.

Mit den üppigen Auwäldern, nordwestlich der Stadt gelegen und der March
als Grenzfluss zur Slowakei, bietet die Stadt Marchegg mit nur 30 km
zur Stadtgrenze Wien oder Bratislava ein kulturelles Ausflugsziel sowie
ein Naturparadies mit hohem Naherholungswert. Die neu eröffneten Fuß-
und Fahrradbrücke bietet die Möglichkeit die March zu überqueren und in
das Nachbarland, die Slowakei zu gelangen. Hier kommt die March als
Grenzfluss, eingebettet in die Auenlandschaft als verbindendes Element
besonders gut zur Geltung. Um die Region Marchfeld kennen zu lernen,
ist die Stadt Marchegg, mit der Anbindung an Rad- und Fußwege ein
idealer Ausgangspunkt.

Das Zollwachedenkmal - „Der Adler" - weist auf die Bedeutung der March
als Grenzfluss hin. Einst war die Flussmitte die Grenze zu Ungarn,
heute ist sie Staatsgrenze zur Slowakei. Über Jahrhunderte ermöglichte
an dieser Stelle eine Überfuhr regen Handel. Der zweite Weltkrieg
brachte eine hermetische Abriegelung der Grenze, 1989 wurde die March
wieder eine grüne, unbewachte Grenze.
Zur Erinnerung an den 125. Jahrestag der Gründung der Österreichischen Zollwache, 1830-1955

Die March ist eine der ältesten natürlichen Grenzen Mitteleuropas und
Österreichs einziger naturnaher Tieflandfluss pannonischer Prägung. Bis
ihr Flusslauf reguliert wurde, floss sie in weiten Mäandern durch eine
Landschaft aus Auwäldern und Wiesen. Diese natürliche Flussdynamik wird
nun wiederhergestellt: Wie einst soll sie sich Richtung Donau
schlängeln, gesäumt von Auen, Wiesen und Feldern, die oft für viele
Wochen überflutet sind. Die periodischen Hochwässer sind für das
Funktionieren der Marchauen mit ihrer außerordentlich vielfältigen
Tier- und Pflanzenwelt (über-)lebensnotwendig.

Die Stadt liegt an der March, die die Grenze zur Slowakei bildet, und
somit am Ostrand des Marchfeldes. In die Slowakei führen eine
Bahnbrücke der Ostbahn (Marchegger Ast) und eine kombinierte
Fahrrad-Fußgängerbrücke. Eine Straßenbrücke besteht nicht. Die weiten
Marchauen, bei Hochwasser überschwemmt, sind wegen ihrer Flora und
Fauna geschützt.

Österreich fungierte Anfang der 1970er Jahre als Transitland für
auswandernde jüdische Sowjetbürger. Die Auswandererzüge erreichten
Österreich an der Grenzstation Marchegg. Hier fand am 28. September
1973 der erste Terrorakt von Palästinensern in Österreich statt. Aus
einem Zug mit jüdischen Emigranten wurden vier Geiseln (drei Emigranten
und ein österreichischer Zollbeamter) entführt und zum Flughafen Wien
gebracht. Nach Zusicherung der Bundesregierung zur Auflösung des
Transitlagers in Schloss Schönau wurden die Terroristen am 29.
September 1973 ausgeflogen.

Die Bedeutung des Ortes
König Ottokar II. ist nachweislich der Gründer von Marchegg und dass er
gerade hier eine Stadt anlegen ließ, hat sicher strategisch-politische
Gründe. Welche Bedeutung aber das Gründen einer Stadt für die Menschen
dieser Zeit darüber hinaus hatte, kann man nur erahnen, wenn man sich
bewusst macht, dass Kirche und Gesellschaft - anders als in anderen
Epochen eine unauflösliche Einheit bildeten.
Ob jemand gläubig oder ungläubig, religiös war oder nicht, entsprang
keiner persönlichen Entscheidung, sondern es galt allgemein als
absolute Sicherheit, dass das Leben im Himmel oder in der Hölle endete.
Gott war der Schöpfer von Raum und Zeit und wer diese bemessen konnte,
konnte sie auch beherrschen.
Wer also ein so großes Gebiet wie König Ottokar in Marchegg vermessen
und abstecken konnte, gründete seinen Machtanspruch nicht nur auf rein
irdische Argumente, sondern zeigte sich auch in der Lage, die Schöpfung
selbst zu beherrschen. Mit seiner Anlage schuf er einen neuen Ort der
Sicherheit in einem gefährlichen Umfeld, denn Gottes Schöpfung war -
für alle klar sichtbar - auf Gegensätzen aufgebaut: Er schuf die Erde
und die Gestirne. Diese Polarität setzt sich fort im Oben, dem ewigen
Gottesreich, und im Unten, wo die Menschen in ihrer Vergänglichkeit
lebten. Zentrum und Peripherie, geistig und fleischlich, männlich und
weiblich - die logische Fortsetzung dieser als Naturgesetze
verstandenen Gegensätze.
Auf die Landschaft übertragen bedeutete das: Die Stadt mit ihrer Mauer
ist das positive Gegenstück zur davor liegenden Wildnis, dem Wald und
der Au mit seinen wilden Tieren und vielen anderen Gefahren. Die Kirche
bildete dabei den Mittelpunkt der Stadt und wehrte ihrerseits alles
Böse durch monströse steinerne Wächter an der Fassade ab (die in
Marchegg leider nicht realisiert wurden). In ihrem Schatten drängen
sich die schutzbedürftigen Häuser. Vor diesem geistigen Hintergrund
wird klar, warum trotz aufwändiger Rekonstruktionsversuche viele Fragen
zur Wahl des Ortes, der Lage der Kirche usw. ein Geheimnis bleiben
dürften, denn sie sind sicher nicht zufällig gewählt. Neben den Fragen
nach dem „Was" und „Wann" bleibt auch die Frage: „Was war zuerst?"

Marchegg gilt als erste geplante mittelalterliche Stadtanlage
Österreichs. In Zeiten der Superlative, wo es aus marketingtechnischer
Sicht immer wichtiger wird, in irgendeiner Form größer, älter, stärker
oder sonst wie besser sein zu müssen als alles andere, hat diese Stadt
also einen gewissen Wettbewerbsvorteil gegenüber allen anderen Städten
im Land. Worin aber besteht das „Besondere" für die Besucherinnen und
Besucher dieses Präzedenzfalles von Stadtentwicklung, wenn man - wie
man zugeben muss - von dieser Einmaligkeit auf den ersten Blick nur
wenig bis gar nichts sieht?
Dem unbefangenen Blick eines Gastes bietet sich ein dörflich anmutendes
Städtchen mit einer nicht vollständig erhaltenen Stadtmauer, einer im
18. Jh. zum Barockschloss umgestalteten Burg und einer Pfarrkirche,
deren Äußeres im ersten Moment auch kein einmaliges Kulturjuwel
vermuten lässt. Und trotzdem - oder gerade deswegen - kann uns dieser
Ort Einblicke in das Leben und Denken einer Kultur geben, die von
vielen rückständig, altertümlich, rätselhaft oder - mit anderen Worten
- eben als mittelalterlich bezeichnet wird.
Dieses Mittelalter beginnt mit dem Ende der Antike mit ihrer römischen
Hochkultur und endet zuerst im Italien des 15. Jh. mit der Renaissance,
die sich künstlerisch auf antike Vorbilder bezieht und diese noch zu
übertreffen versucht. Erst die Menschen dieser späteren Kultur drückten
dem Mittelalter den Stempel des kulturell Mittelmäßigen auf. Einigen
Geheimnissen dieser oft zu Unrecht als „dunkles Zeitalter" bezeichneten
Epoche können wir beim Besuch der wenigen steinernen Zeugen in Marchegg
- allen voran der Pfarrkirche - auf die Spur kommen.

Wem der viele Text zu lange war und lieber Bewegtbilder mit Musik mag,
kann sich gerne dieses Video antun: