web steiner
Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen
Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.
+43/2624/54014 - office@websteiner.com
Basilika Mariazell
Mariazellerbahn: Ötscherbär & Himmelstreppe, Mai 2023
Die römisch-katholische Basilika Mariazell mit dem
Patrozinium Mariä Geburt im steirischen Mariazell ist der bedeutendste
Wallfahrtsort in Österreich, einer der wichtigsten Europas und der
einzige mit dem Titel eines Nationalheiligtums im deutschsprachigen
Raum. In dem im 12. Jahrhundert gegründeten Gnadenort wird ein
hölzernes Mariengnadenbild verehrt.
* * *
Die Mariazellerbahn, auch abgekürzt mit MzB, ist eine elektrifizierte
Schmalspurbahn mit einer Spurweite von 760 Millimeter (bosnische
Spurweite) in Österreich. Die Gebirgsbahn verbindet die
niederösterreichische Landeshauptstadt St. Pölten mit dem steirischen
Wallfahrtsort Mariazell. Eigentümer und Betreiber sind seit Dezember
2010 die NÖVOG, die sie seit 2019 unter der Dachmarke Niederösterreich
Bahnen betreibt. Die Mariazellerbahn ist Teil des Verkehrsverbundes
Ost-Region. Die Mariazellerbahn ist mit ihren 85 km die längste
Schmalspurbahn Österreichs. Die Strecke verläuft von der
Landeshauptstadt St. Pölten durch das malerische Dirndltal, vorbei am
Naturpark Ötscher-Tormäuer bis zum Wallfahrtsort Mariazell.
Der Fahrbetrieb auf der Stammstrecke wurde bis 27. Oktober 2013 noch
hauptsächlich von den fast einhundert Jahre alten Elektrolokomotiven
der Reihe 1099 zusammen mit den praktisch gleich alten Reisezugwagen
bewältigt. Die 1099 war somit die älteste elektrische Lokomotive der
Welt, die bis dahin noch im täglichen Einsatz auf jener Strecke stand,
für die sie ursprünglich gebaut wurde. Ab 2013 wurden sie durch die
Elektrotriebwagen der zweiten Generation ersetzt, nur die Loks 7, 10,
11, 13 und 14 verblieben bei der NÖVOG. Um eine passende Garnitur für
den gleichnamigen Markenzug der Mariazellerbahn zu haben, wurden 2007
elf Personenwagen, zwei Fahrradtransportwagen und drei
Elektrolokomotiven der Baureihe 1099 in das Ötscherbär-Design
umlackiert.

Die Basilika Mariazell ist das einzige Nationalheiligtum im deutschen
Sprachraum und dominiert das Ortsbild. Sie beherbergt die Gnadenmutter,
eine Marienstatue aus Lindenholz, die seit dem 12. Jahrhundert ein
wichtiger Bezugspunkt für Pilger aus aller Welt ist. Ein Blickfang sind
auch die historischen Häuser rund um den Hauptplatz. Im Sommer laden
zahlreiche Gastgärten zum Verweilen ein. Bei einem Stadtspaziergang
erfährt man mehr über die Geschichte des berühmten Wallfahrtsortes.
Das Bauwerk entstand im 14. Jahrhundert als gotische Kirche mit einem
Spitzbogenportal und dem heutigen Mittelturm (Höhe 90 Meter) und wurde
im 17. Jahrhundert erweitert und barockisiert: Neben dem gotischen Turm
wurde links und rechts je ein barocker Turm errichtet; das Langhaus
wurde verlängert und verbreitert und im Norden und Süden mit je sechs
Seitenkapellen versehen. Bis heute gehört der Wallfahrtsort zum
steirischen Stift St. Lambrecht.

Im Tympanon über dem Hauptportal befnden sich zwei Reliefs, die zu den
besten Arbeiten der spätgotischen Bauplastik in Österreich zählen. Im
Bogenfeld ist eine eindrucksvolle Kreuzigungsszene zu sehen, gefertigt
im frühen 15. Jh., darunter ein um 1435-40 entstandenes Relief, auf dem
wichtige Ereignisse aus der Wallfahrtsgeschichte gezeigt werden: Links
der thronenden Schutzmantelmadonna, die Hilfe suchenden Pilgern Schutz
gewährt, knien Abt Heinrich Moyker, in dessen Zeit das Relief
geschaffen wurde, daneben Markgraf Heinrich von Mähren und seine Frau,
die vom hl. Wenzel nach Mariazell gewiesen werden. Der im Schutz des
Mantels kniende König ist Herzog Albrecht V., König von Böhmen,
dahinter seine Gemahlin Elisabeth. Vermutlich waren sie die Votanten
der Relieftafel.
Außerhalb des Mantels kniet König Ludwig I. von Ungarn, welcher der
Gnadenmutter das „Schatzkammerbild" überreicht, rechts davon die
legendäre „Türkenschlacht", ganz rechts eine Teufelsaustreibung an
einer Frau, die ihr neugeborenes Kind geköpft haben soll. Die drei
Wappenschilde in der Reliefmitte zeigen die Allianzwappen Albrechts V.
von Österreich und dessen Gemahlin Elisabeth, sowie das auf König
Ludwig I. von Ungarn Bezug nehmende ungarische Doppelkreuz.
Die überlebensgroßen barocken Bleistatuen von Balthasar Moll seitlich
des Hauptportals erinnern an die beiden Stifter, Markgraf Heinrich von
Mähren und König Ludwig I. von Ungarn. Sie wurden anlässlich der
600-Jahr-Feier 1757 geschaffen.

Das überlieferte Gründungsjahr von Mariazell 1157 lässt sich historisch
nicht eindeutig belegen, aber eine päpstliche Urkunde weist in diese
Zeit. Die erste schriftliche Erwähnung unter dem Namen „Cella" im Jahr
1243 deutet bereits auf ein größeres Gotteshaus hin. Eine
selbstständige Pfarre ist ab 1269 urkundlich dokumentiert. Im Jahre
1330 bezeugt eine Ablassurkunde des Salzburger Erzbischofs Friedrich
III. Mariazell als viel besuchten Gnadenort. Die wachsende
Anziehungskraft bedingte die Vergrößerung der bestehenden romanischen
Kirche zu einem großen dreischiffigen gotischen Gotteshaus. Bereits
sehr früh sind auch schon zahlreiche Gewerbetreibende in Mariazell
nachweisbar, darunter die ersten Krämer entlang der Kirchhofmauer.

Die im Laufe der Jahrhunderte mehrfach umgestaltete Gnadenkapelle steht
noch heute an der Stelle der ursprünglichen „Zelle" im Zentrum der
Basilika. Der heutige trapezförmige Grundriss stammt von 1690, ältere
Teile aus dem 14. Jahrhundert wurden in diesen Bau integriert. Das
Steinrelief über dem Eingang, aus der Zeit um 1369, soll die
Porträtbüsten König Ludwigs I. von Ungarn und seiner Gemahlin Elisabeth
als Stifter der gotischen Kapelle darstellen.
Im Jahre 1756 stifteten Kaiser Franz I. und Kaiserin Maria Theresia
anlässlich des 600-jährigen Bestehens der Wallfahrtskirche 1757 das
wertvolle, von den Wiener Goldschmieden Joseph Würth und Joseph Moser
gefertigte Silbergitter. Bewegte Statuen des heiligen Josef sowie der
Eltern Mariens - Joachim und Anna - bekrönen die Gnadenkapelle. Die
Figuren sind Werke von Lorenzo Mattielli aus dem Jahr 1734.

Der heutige Aufsatz des Gnadenaltares wurde 1726 von Abt Kilian Werlein
von St. Lambrecht in Auftrag gegeben. Der Entwurf stammt von Joseph
Emanuel Fischer von Erlach, dem Sohn von Johann Bernhard Fischers von
Erlach. Die Silberschmiedearbeiten wurden von Philipp Jakob Drentwett
in Augsburg ausgeführt.

Die Geschichte der Wallfahrt nach Mariazell ist eng mit der
Baugeschichte des Gotteshauses verbunden. Auffallend ist, dass alle
Erweiterungsphasen auf den Standort des Gnadenaltars Rücksicht nahmen,
sodass sich die Mariazeller Gnadenstatue vermutlich noch heute an ihrer
ursprünglichen Stelle befindet.
Nach der ersten hölzernen „Zelle" wurde, laut Tympanoninschrift am
Hauptportal, im Jahre 1200 mit dem Bau einer romanischen Kirche
begonnen. Stiftschronist Johannes Menestarfer berichtet, dass der
Markgraf von Mähren und seine Gattin, von einer Krankheit geheilt, aus
Dankbarkeit die Mittel zur Erbauung dieser Kirche nach Zell sandten.

Ab 1340 stellten Päpste, Kardinäle und Bischöfe Ablassurkunden aus, die
die Wallfahrt nach Mariazell förderten. Der wachsende Zustrom der
Pilger erforderte die Vergrößerung der romanischen Kirche, vermutlich
vorerst durch den Anbau eines gotischen Chores, danach durch den Neubau
eines dreischiffigen Langhauses.
Die Kirche hatte im Osten, im Anschluss an die gotische Vierung, eine
polygonale Chorkapelle, welche vermutlich König Ludwig I. (1342-1382)
von Ungarn gespendet hat. Das steile Satteldach des Langhauses ist an
der dem Chor zugewandten Seite von einem kleinen Dachreiter bekrönt.
Ein hoher gotischer Mittelturm sowie viergeschossige Treppentürmchen
befanden sich am westlichen Ende des Langhauses.

Die Muttergottes auf der Frauensäule wird ebenfalls als Gnadenbild
verehrt. Die spätgotische Holzstatue von 1520/30 steht auf einer 1682
errichteten fünf Meter hohen Marmorsäule im barocken Erweiterungsbau
hinter der Gnadenkapelle. Am Sockel der Frauensäule wurden von alters
her Kerzenopfer und Votivgaben aus Wachs dargebracht. Hier fanden auch
Bußandachten und Bußübungen, die Palmweihe, die Fußwaschung und das
fastenzeitliche Rosenkranzgebet statt.
Die überlebensgroße Marienfgur mit dem Kind auf dem rechten Arm ist als
Himmelskönigin dargestellt. In der linken Hand trägt Maria ein Zepter,
während das Kind die Sphaira hält und seine rechte Hand segnend erhoben
hat. Maria und das Christuskind sind mit Metallkronen, eine Stiftung
von Baron Nemet, vor einem 1709 gefertigten Strahlenkranz dargestellt.
Nicht ganz klar ist, wo die Marienstatue vor dem Erweiterungsbau der
Kirche aufgestellt war.

Die Gründung von Mariazell wird auf den Benediktinermönch Magnus zurück
geführt, der von seinem Mutterkloster St. Lambrecht im Jahre 1157 als
Seelsorger für die Hirten in die Umgebung des heutigen Ortes Mariazell
ausgesandt wurde. Hier angekommen soll er die mitgebrachte Marienstatue
auf einen Baumstumpf gestellt haben und darüber eine einfache
Holzkapelle errichtet sowie für sich selbst eine cella als Unterkunft
gebaut haben. Maria in der Zelle gab also diesem Ort seinen
Namen. Schon bald - so wird berichtet - kam es hier zu
Gebetserhörungen und Mariazell wurde zum Ziel zahlreicher
hilfesuchender Menschen.
Am Beginn der Geschichte von Mariazell steht eine einfache Marienstatue
aus Lindenholz um die eine Zelle gebaut wurde. In 850 Jahren wurde
daraus ein bedeutendes Zentrum des Glaubens und ein kunsthistorisch
unvergleichlicher Raum des Gebetes und des Gottesdienstes. Die
Mariazeller Gnadenstatue ist 48 cm hoch und aus Lindenholz geschnitzt.
Die frühgotische thronende Marienfigur hält an ihrer rechten Seite das
auf ihrem Schoß sitzende Jesuskind. Das Kind hält einen Apfel, mit der
linken Hand greift es nach einer Frucht, die ihm Maria reicht. Die
beiden Früchte sind Symbole für die Erlösung vom Sündenfall. Seit dem
16. Jahrhundert war es üblich, Gnadenbilder mit kostbaren gestickten
Gewändern zu schmücken. Nur an zwei Tagen ist die Gnadenstatue ohne
sogenanntes Liebfrauenkleid zu sehen nämlich am Gründungstag von
Mariazell, dem 21. Dezember und am Tag des Patroziniums der Basilika,
zu Maria Geburt am 8. September. Über 1,5 Millionen Gläubige pilgern
pro Jahr aus nah und fern zur Mariazeller Gnadenstatue, die auch unter
den Namen Magna Mater Austriae, „Große Mutter Österreichs",
sowie als Magna Domina Hungarorum, „Großherrin der Ungarn" und Mater
Gentium Slavorum, „Mutter der slawischen Völker" angerufen wird.

Der kostbare Hochaltar bildet den östlichen Abschluss der Kirche. Im
Jahre 1692 beauftragte Abt Franz von Kaltenhausen den berühmten
Baukünstler Johann Bernhard Fischer von Erlach mit dem Entwurf dieses
imposanten Werkes. Geweiht wurde der Altar 1704.
Der Mariazeller Hochaltar zählt zu den Initialwerken hochbarocker
Inszenierungskunst. Er ist nicht nur für unser Empfinden eine
beeindruckende künstlerische Darstellung der göttlichen Dreifaltigkeit,
sondern wurde bereits unmittelbar nach seiner Entstehung bewundert und
Fischer selbst nannte ihn nicht ohne Stolz „..... ein Werk dergleichen
wenig zu sehen sein...".

Im Kuppelraum wurde eine neue Chororgel die sog. Mariazeller Orgel, von
dem schweizer Orgelbauer Hermann Mathis im Jahre 2000 mit 29 Registern
auf 2 Manualen und Pedal erbaut. Das Architektenteam Wolfgang Feyferlik
/ Susi Fritzer entwarf einen plastisch betonten Hauptprospekt mit der
weichen Linienführung horizontaler, farbig lasierter Schalbretter aus
Fichtenholz. Dem Hauptprospekt wurde die schlichte Grundgeometrie des
12m hoch aufragenden, schlanken Körpers mit der Verkleidung in Form
eines Strichcode-Musters aus schmalen Eichenleisten gegenübergestellt.
Gefasst werden der Längsquader und der gefaltete Querkörper in ihrer
doch sehr unterschiedlichen Gestaltung durch die Nordwand des
Kuppelraumes. Das Klangkonzept dieser Orgel ist inspiriert vom
österreichischen Orgeltypus des ausgehenden 18. Jahrhunderts, der in
seiner Farbigkeit und dynamischen Breite von der stillen Andacht bis
zum brausenden Jubel die Messen begleiten kann. Chororgel und
Hauptorgel können nicht nur selbstständig mechanisch gespielt werden,
sondern auch gemeinsam von einem Zentralspieltisch aus, was mittels
einer integrierten Doppeltraktur in beiden Orgeln ermöglicht wird.

Über der aus einem Block geschaffenen Altarmensa schwebt der Tabernakel
als silberne Weltkugel, umwunden von einer Schlange als Sinnbild der
Sünde. Darüber erhebt sich eine überlebensgroße Gnadenstuhlszene. Die
Figuren von Gottvater und Christus entstanden nach Modellen von Lorenzo
Mattielli und wurden vom Wiener Goldschmied Johann Kanischbauer aus
Silber getrieben. Maria, Johannes sowie die adorierenden Engel
entstammen nicht mehr der Entstehungszeit des Altares, da sie 1806
einer Silberablieferung zur Finanzierung der Franzosenkriege zum Opfer
fielen und durch versilberte Holzstatuen ersetzt wurden. Die gesamte
Szene wird von einem monumentalen Triumphbogen eingefasst. Darüber
erhebt sich die himmlische Engelsglorie mit der Heilig-Geist-Taube.

Nach der spätmittelalterlichen Blütezeit erlitt das Wallfahrtswesen
während der Reformation einen starken Rückgang. Für die katholischen
Landesfürsten und Betreiber der Gegenreformation wurde aber gerade
Mariazell als Heiligtum der Gottesmutter zum Symbol ihrer religiösen
Ideale. Der Zustrom der Wallfahrer nahm daher im 17. Jahrhundert durch
den wieder erstarkten Katholizismus rasch zu. Dies machte einen
gänzlichen Um- und Neubau der alten Kirche notwendig, der mit
Unterstützung Kaiser Ferdinands III. realisiert wurde.
Der barocke Erweiterungsbau entstand ab 1644 nach Plänen des St.
Lambrechter Stiftsbaumeisters Domenico Sciassia und dauerte insgesamt
fast 40 Jahre. Zu Beginn wurde das dreischiffge Langhaus barockisiert.
Die gotischen Pfeiler wurden ummantelt und die Gewölbe mit barockem
Stuck und Deckenmalerei versehen. Anschließend wurden Seitenkapellen
mit darüber liegenden Emporen angefügt. Zuletzt wurde der gotische Chor
abgebrochen und durch eine barocke Raumfolge erweitert, deren Höhepunkt
die längsovale Hochkuppel ist. Wandgliederungen, Deckengemälde und
Stuckaturen lassen alle Bauteile auf den ersten Blick wie aus einem
Guss erscheinen und verschleifen die Grenzen zwischen erneuertem Altbau
und barocker Erweiterung. Baumeister Sciassia ist es gelungen, einen
großzügigen und architektonisch beispielgebenden Raum zu schaffen, der
bis heute den vielfältigen Anforderungen der zahlreichen
Wallfahrergruppen entspricht.
Diese zur Zeit der Errichtung größte Kuppel nördlich der Alpen (10 x 15
x 50m) entstand nachdem Baumeister Sciassia mit seinem Auftraggeber Abt
Kaltenhausen nach Rom gereist war, um dort die neuesten Kirchenbauten
zu studieren und zeichnerisch zu erfassen. Ein weiteres Vorbild für die
den Ostteil der Kirche dominierende Ovalkuppel dürfte die auf den
Berechnungen Keplers basierende Kuppel des Grazer Mausoleums gewesen
sein. Wie in der Barockzeit beliebt, sind unter der Kuppel in
Dreieckkartuschen die Allegorien der vier damals bekannten Weltteile in
Form von weiblichen Figuren dargestellt: hier Amerika mit einem Papagei
und Europa mit einem Rind. Im Hintergrund jedes Bildes ist die
Mariazeller Gnadenmutter und der Schriftzug „Salve Maria Cellensis" zu
sehen. Darunter befnden sich die Stuckfguren des Markgrafen Heinrich
von Mähren und seiner Gattin. Die Fresken im Zentrum zeigen das an
Gicht erkrankte Paar im Bett liegend. Rechts schräg gegenüber ist im
Presbyterium in Freskotechnik die Ankunft von Mönch Magnus mit der
Gnadenstatue in Mariazell dargestellt.

Im 15. Jahrhundert war der Wallfahrtsort bereits international so
bekannt und beliebt, dass sich Könige und Kaiser veranlasst sahen, zum
Schutz der Wallfahrer Geleitbriefe auszustellen. Pilger aus dem Gebiet
des heutigen Bayern, Böhmen, Frankreich, Oberitalien, Kroatien, Polen,
Deutschland und der Schweiz, vor allem aber aus Österreich und Ungarn,
suchten die Hilfe der Mariazeller Gnadenmutter.
Mariazell ist seit dieser Zeit der zentrale Wallfahrtsort der
Donauländer. Seit dem Fall des Eisernen Vorhanges 1989 ist es auch den
Pilgern aus den östlichen und südöstlichen Staaten Europas wieder
ungehindert möglich, Mariazell aufzusuchen. Zunehmend kommen aber auch
Gruppen aus anderen Erdteilen. Pro Jahr besuchen etwa 1,5 bis 2
Millionen Pilger den Gnadenort, der damit zu den größten
Wallfahrtszentren Mitteleuropas zählt. Fußwallfahrten aus Österreich
und den Nachbarländern nehmen dabei stark zu. Immer mehr Gläubige
kommen aber auch per Fahrrad, mit dem Motorrad oder sogar zu Pferd
hierher.

Geschenke und Drucke aus neuerer Zeit können die Pilger bereits fertig
an einem der Devotionalienstände erwerben. Durch die Widmung an die
Gnadenmutter, das Anbringen einer persönlichen Inschrift oder das
versteckte Einschieben eines Briefes werden diese Gegenstände zu
Votivgaben und gehören somit zum Schatz von Mariazell.

Die neue Orgel im Barocktrakt wurde im September 2000 geweiht. Sie
stammt aus der Werkstätte des Schweizer Orgelbauers Hermann Mathis, die
Schauseite wurde von den Grazer Architekten Wolfgang Feyferlik und Susi
Fritzer gestaltet. Erst durch diese Orgel ist es möglich geworden, den
Hochaltarraum für große Messen ausreichend zu beschallen. Von einem
Generalspieltisch aus können alle vier Orgeln angesteuert und somit die
gesamte Basilika mit festlichem Klang erfüllt werden. Dies ist
besonders wichtig bei großen Wallfahrten, an denen mehrere tausend
Pilger teilnehmen.
Die Neukonzeption des Liturgiebezirkes erfolgte durch
Feyferlik/Fritzer, die Gestaltung des aus einem Stück gezogenen Altars
aus Anröchter Dolomit ist ein Werk des deutschen Bildhauers Ulrich
Rückriem.


Die Basilika Mariazell bewahrt derzeit etwa 2500 Votivbilder und somit
die größte und bedeutendste derartige Sammlung in Österreich.
Votivgemälde dokumentieren eindrucksvoll die individuellen Beweggründe
der Pilger für ihre Wallfahrt. Während der Blüte in der Barockzeit,
also zwischen 1600 und 1780. wurden tausende Bilder nach Mariazell
gebracht. Da sie jedoch keinen hohen materiellen Wert darstellten,
wurden sie in der Vergangenheit nicht restauriert, sondern es wurden
verschmutzte oder beschädigte Bilder weggegeben. So stammt der
überwiegende Teil der Mariazeller Votivgemälde aus der Zeit nach dem
Josephinismus und dem großen Brand von Mariazell im Jahre 1827. Auf
Ihrem Weg durch die Emporen sehen Sie diese Bilder in chronologischer
Reihenfolge und nach Themenschwerpunkten geordnet.

An der gegenüber liegenden Wand unter der Kuppel stellen theatralisch
inszenierte Stuckfguren den ungarischen Herrscher König Ludwig I. und
seine Gattin Elisabeth dar. Die umgebenden Fresken schildern Szenen aus
der Ludwigslegende.
Der Überlieferung nach betete König Ludwig in der Nacht vor einer
entscheidenden Schlacht im Kriegszelt vor seinem kostbaren
Madonnenbild. Am nächsten Morgen erwachte er mit dem Bild auf seiner
Brust, kämpfte im Namen Mariens gegen das zahlenmäßig überlegene,
feindliche Heer und blieb siegreich. Als Dank dafür pilgerte er nach
Mariazell, opferte das wundertätige Gemälde und lies eine Kapelle
erbauen. Unterhalb der Kuppel in den Kartuschen sind zwei
personifzierte Erdteile erkennbar: Afrika mit einem Kamel und Asien mit
einem Elefanten.
Über dem südlichen Sakristeieingang und der Stiege erkennbar sind seit
Jahrhunderten einige der größten und ältesten Votivbilder der Basilika
positioniert: so das von Fürst Paul Esterházy im Jahr 1689 gestiftete
Gemälde und jenes der Stadtbewohner von Pressburg aus dem Jahr 1852.


Pilgerkapelle

Die Beziehung der Habsburger zum Wallfahrtsort Mariazell beginnt im 14.
Jh. als Albrecht II. 1342 einen Altar stiftete und dem Ort das
Marktrecht verlieh. Um 1438 stiftete Albrecht V. vermutlich das
Tympanonrelief. Karl II. und seine Gattin Maria von Bayern suchten 1572
die Wallfahrtskirche Mariazell auf und begründeten damit eine
Familientradition. Im Zuge der Rekatholisierung entwickelte sich
Mariazell dann zum Nationalheiligtum des Hauses Habsburg, welches die
barocke Erweiterung mit hohen Summen unterstützte. Eine besondere
Verehrerin der „Magna Mater Austriae" war Kaiserin Maria Theresia, die
wiederholt in Mariazell den Schutz Mariens sowohl für ihre Familie als
auch für ihr Reich erbat.

Der steirische Maler Markus Weiß schuf ab 1622 die großformatigen
Gemälde über den Emporendurchgängen. Sie stellen die Entstehung und
Entwicklung des Wallfahrtsortes Mariazell dar sowie eine Reihe von
wunderbaren Begebenheiten von der Zeit der Gründung bis zum Anfang des
17. Jahrhunderts. Solche Mirakelzyklen wurden in allen Wallfahrtsorten
in Auftrag gegeben, um den Ruf des Ortes zu mehren und die zahlreichen
Gebetserhörungen öffentlich darzustellen.

Die Muttergottes auf der Frauensäule wird ebenfalls als
Gnadenbild verehrt. Die bemerkenswerte Statue mit einer Höhe von fast
zwei Metern entstand um 1520 und steht seit der Vollendung des barocken
Kirchenbaues auf einer fünf Meter hohen Marmorsäule. Der Strahlenkranz
wurde erst 1709 hinzugefügt. Die Madonna ist als gekrönte
Himmelskönigin dargestellt und trägt auf dem rechten Arm das segnende
Jesuskind. In der Linken hält sie ein Zepter. Früher war diese
Marienstatue, die auch den Namen „Pilgermadonna" trägt, das Zentrum
vielfältiger Bußrituale, heute werden bei ihr Andachtsgegenstände
gesegnet.

Unter ihrem Sohn Kaiser Josef II. folgten schwere Zeiten für den
Gnadenort. Besonderen Unwillen in der Bevölkerung bewirkte das Verbot
von
Wallfahrten zwischen 1786 und 1792. Ein schwerer Schlag war auch die
Aufhebung des Mutterklosters St. Lambrecht in den Jahren 1786 bis 1802,
eines von insgesamt 40 aufgehobenen Klöstern in der Steiermark, deren
Besitz versteigert und für Neuordnungen im kirchlichen Bereich
verwendet wurde. Ein Teil der Reformen Josefs II. wurde zwar nach
seinem Tod wieder aufgehoben, die Folgen für Mariazell waren dennoch
schwerwiegend. Im Unterschied zu den meisten anderen Klöstern hat das
Stift St. Lambrecht den zu Mariazell gehörigen Grundstücks- und
Kirchenbesitz nie wieder zurückerhalten. Bis heute ist Mariazell daher
auf die Gaben der Pilger angewiesen.



Das Prager Jesulein
(tschechisch Pražské Jezulátko), auch Prager Jesuskind genannt, ist
weltweit eines der bekanntesten Gnadenbilder Jesu. Es gilt als
wundertätig und befindet sich in der Kirche Maria vom Siege (Kostel
Panny Marie Vítězné) im Karmelitenkloster in Prag. Die 47 cm große
bekleidete Figur stellt das Jesuskind im Alter von etwa drei Jahren
dar. Es trägt eine Krone und hat die rechte Hand zum Segensgestus
erhoben, während es in der linken den Reichsapfel als Symbol der
Weltherrschaft hält. Die Holzfigur eines unbekannten Künstlers im Stil
der Renaissance stammt aus dem 16. Jahrhundert und ist mit einer
farbigen Wachsschicht überzogen. Sein Gesichtsausdruck und die lockigen
Haare weisen auf die Herkunft aus Spanien und den von dort eingeführten
Jesuskind-Kult hin, der aus der Mystik der spanischen Karmeliten
hervorging.


Die Hauptorgel hat ihre eigene aufregende Geschichte: Umbauten,
Neubauten, Vergrößerungen bis zum Einbau eines Fernwerkes hinter dem
Hochaltar kennzeichnen die Orgelgeschichte seit 1509. Das Orgelwerk
wurde in den Jahren 1740, 1912 und 1929 umgebaut und 2003 erneuert.
Dazu kam die großzügige Spende der Stadt Wien, so dass die Schweizer
Orgelbaufirma Mathis unter Verwendung des barocken Orgelgehäuses und
der Prospektpfeifen der Orgel des Johann Gottfried Sonnholz aus dem
Jahr 1739, ein neues Orgelwerk mit 54 Registern auf drei Manualen und
Pedal schaffen konnte. Auch das 1868 abgetragene Rückpositiv wurde
rekonstruiert und schmückt nun wieder in der ursprünglich vorgesehenen
Konzeption die prächtige Orgelempore.
Nach dem Entwurf des Architekten Wolfgang Feyferlik und Susi Fritzer
kamen die größten Pfeifen direkt hinter der Orgel frei auf einem
geschweiften Architrav zu stehen. Die Pfeifen des Prinzipals 16'
befinden sich auf beiden Seiten der außergewöhnlichen, 11,5 m langen
Windlade. Der Westempore zugewandte Teil der Orgel sollte nicht bloß
eine Rückseite sein, denn schließlich ist er ebenso funktioneller Teil
des Instruments als auch ein großes raumbestimmendes Element der
Westempore; deshalb wurde dieser Orgelteil architektonisch besonders
gestaltet. Holzpfeifen (Fichte) mit unterschiedlichen Längen und
Querschnitten stehen auf einem geschwungenen Eichenbalken, der über dem
Zugang zum kirchenschiffseitigen Teil der Westempore zu schweben
scheint.


Die Basilika Mariazell bewahrt derzeit etwa 2500 Votivbilder und somit
die größte und bedeutendste derartige Sammlung in Österreich.
Votivgemälde dokumentieren eindrucksvoll die individuellen Beweggründe
der Pilger für ihre Wallfahrt. Während der Blüte in der Barockzeit,
also zwischen 1600 und 1780, wurden tausende Bilder nach Mariazell
gebracht. Da sie jedoch keinen hohen materiellen Wert darstellten,
wurden sie in der Vergangenheit nicht restauriert, sondern es wurden
verschmutzte oder beschädigte Bilder weggegeben. So stammt der
überwiegende Teil der Mariazeller Votivgemälde aus der Zeit nach dem
Josephinismus und dem großen Brand von Mariazellim Jahre 1827. Auf
Ihrem Weg durch die Emporen sehen Sie diese Bilder in chronologischer
Reihenfolge und nach Themenschwerpunkten geordnet.

Der steirische Maler Markus Weiss schuf ab 1622 die großformatigen
Gemälde über den Emporendurchgängen. Sie stellen die Entstehung und
Entwicklung des Wallfahrtsortes Mariazell sowie eine Reihe von
wunderbaren Begebenheiten aus der Zeit der Gründung bis zum Anfang des
17. Jahrhunderts dar. Solche Mirakelzyklen wurden in allen bedeutenden
Wallfahrtsorten in Auftrag gegeben, um die zahlreichen Gebetserhörungen
öffentlich darzustellen und den Ruf des Ortes zu mehren. Unter diesen
Gemälden erkennbar ist auch die siegreiche Schlacht König Ludwigs I.
von Ungarn gegen die Türken" und seine Dankwallfahrt nach Mariazell.
Aber auch die zahlreichen kleinformatigen Deckenfresken auf beiden
Emporen erzählen Mirakelgeschichten, in denen die Fürsprache der
Gottesmutter Maria den Menschen geholfen hat. Im ersten Joch ist die
Muttergottes als Beschützerin einer in Gefahr geratenen
Wallfahrergruppe und die Datierung 1640 zu erkennen, dem gegenüber die
Heilung eines Mannes mit Schussverletzungen; an der Deckenmitte wird
eine an Händen und Füßen gelähmte Frau wieder gesund; rechts davon
bleibt ein vom Pferd abgeworfener Mann unversehrt.


Die ältesten Votivbilder von Mariazell stammen aus der Barockzeit. Die
noch älteren gotischen Tafelbilder, der kleine Mariazeller Wunderaltar
von 1512 und der große Mariazeller Wunderaltar von 1520, befinden sich
im Landesmuseum Joanneum in Graz. Das älteste hier erhaltene Bild
stammt aus 1633. Jakob Schirich von Eberstorff stiftete es aus Dank für
die Heilung seiner an den Fraisen erkrankten Tochter.
Grundsätzlich war die Barockzeit die Blütezeit vieler
Wallfahrtsbräuche, wie auch dem, des Stiftens von Votivbildern und
Votivgaben und man kann davon ausgehen, dass in dieser Zeit unzählige
Votivtafeln nach Mariazell gebracht wurden. Dass heute
bedauerlicherweise nur mehr knapp 20 Votivbilder des 17. und 18. Jhs.
erhalten sind, ist vor allem den Verboten Kaiser Josephs II.
(1780-1790) zuzuschreiben. Zwischen 1797 und 1809 beeinträchtigten dann
die ..Franzosenkriege" das Wallfahrtswesen und in der Nacht des 1.
November 1827 fiel schließlich fast der gesamte Ort Mariazell den
Flammen zum Opfer, wobei auch die Basilika schwer beschädigt wurde.

Die mächtige Kanzel aus rotem und schwarzem Marmor wurde 1689-1691 vom
Türnitzer Bildhauer Andreas Grabmayr gefertigt. Am Kanzelkorb befnden
sich die Statuen der vier Evangelisten, über dem Aufgangsportal die
Figur des hl. Paulus.
Die Basilika besitzt seit der barocken Erweiterung an der Nord- und
Südsseite je sechs Seitenkapellen. Diese Kapellen wurden zwischen 1650
und 1680 vermutlich nach Entwürfen des Baumeisters Sciassia mit
einheitlichen Altären aus rotem Marmor ausgestattet, als Steinbildhauer
ist Carlo Gianollo bekannt. Die Kapellennischen werden zum Langhaus hin
durch bemerkenswerte, kunstvoll gearbeitete Schmiedeeisengitter
abgeschlossen. Sie sind um 1675 entstanden und stammen wohl von Blasius
Lackner, der auch in St. Lambrecht tätig war.

Kollektive Verlöbnisse von ganzen Städten beziehen sich meist auf
Epidemien, wie die Pest, auf kriegerische Auseinandersetzungen oder auf
Naturereignisse, wie zum Beispiel das Erdbeben in Györ im Jahre 1763.
Zu den größten Gefahren für die Kommunen gehörten aber Brände. Der
große Brand von Eisenerz im Jahr 1807 beispielsweise war Anlass für
eine noch heute praktizierte Gemeindewallfahrt nach Mariazell.
Diese Gemälde stellen ein wichtiges stadthistorisches Quellenmaterial
dar, handelt es sich doch oft um die ältesten genauen und zeitlich
exakt datierbaren stadttopografischen Darstellungen. Waren die Maler
der kleinformatigen, von einzelnen Votanten gestifteten Votivbilder
auch oft wenig bedeutende Künstler, so konnten es sich die
Stadtgemeinden leisten, bei bekannten und anerkannten Künstlern Werke
in Auftrag zu geben. So beauftragte beispielsweise die Stadt Eisenerz
den bekannten Künstler der Biedermeierzeit und Kammermaler des
Erzherzogs Johann, Johann Tendler, und die Gemeinde Mariazell den
verschiedentlich in der Basilika beschäftigten Michael Stattin.

Die häufgsten Darstellungen auf Votivbildern schildern die Heilung von
Krankheiten. Die Anzahl der Gemälde mit der Bitte um Gesundheit
übertrifft naturgemäß alle anderen Anliegen bei weitem. Votivgemälde
sind meist nach einem dreiteiligen Schema aufgebaut: Der Bildteil
stellt in diesem Fall die Krankheitsszene dar. Die gesellschaftliche
Stellung der Spender ist an der Kleidung und an der Ausstattung der
Räume sehr gut ablesbar. Darunter befndet sich eine Inschrift mit der
namentlichen Nennung des Überbringers, also des Votanten, und dem Dank
an Maria für die Erhörung der Bitten. Über der Szene schwebt eine
Abbildung der Gottesmutter. Hier muss es sich jedoch nicht immer um die
Mariazeller Gnadenstatue handeln. Es sind manchmal auch andere
Mariengnadenbilder bzw. Heilige abgebildet.
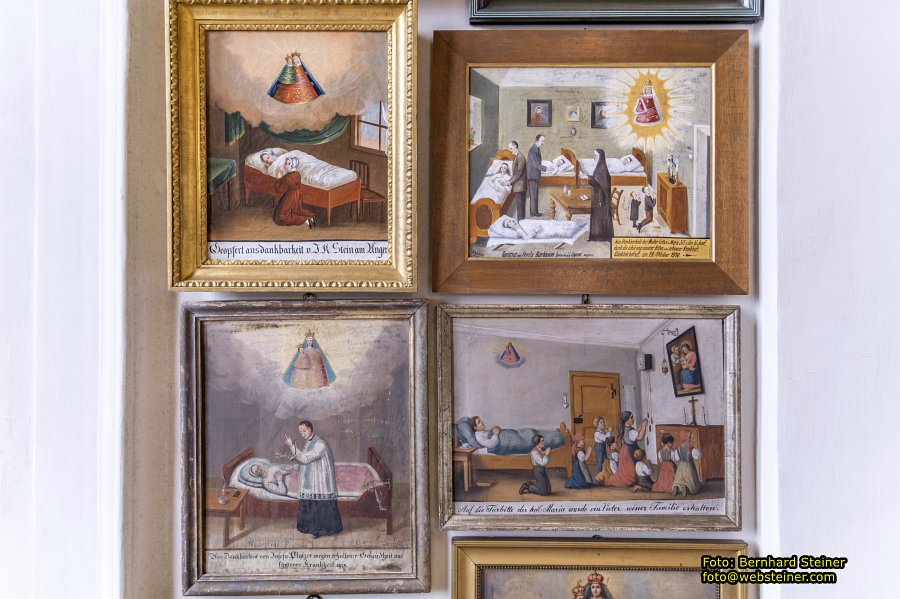

Die Schilderung von Unfällen ist das zweithäufgste Thema von
Votivgemälden. Es begegnen uns teilweise dramatische Darstellungen von
Verkehrsunfällen aller Art, etwa Kutschenunfälle wegen gebrochener
Wagenräder. Die große Bedeutung der Flussschifffahrt im 19. Jahrhundert
spiegelt sich in Bildern von Schiffsunglücken wider. Kinder in
gefährlichen Situationen nehmen einen weiteren wichtigen Platz unter
den Unfalldarstellungen ein. Die detailreichen Darstellungen geben guten Einblick in technische
Entwicklungen auf dem Sektor des Personenverkehrs, in verschiedene
Handwerkstechniken und Gefahren in Zusammenhang mit dem Ausüben
unterschiedlicher Berufe.
Technisch ist der Großteil der Mariazeller Votivbilder, im Unterschied
zu süddeutschen und italienischen Wallfahrtsorten, auf Leinwand gemalt.
Die zweitgrößte Gruppe machen die auf Eisenblech, teilweise verzinktem
Blech, gemalten Bilder aus, wobei diese Technik vor allem bei den
kleinformatigen Bildern des 19. Jhs. anzutreffen ist und durch die
naheliegenden Walzwerke bedingt ist. Die teurere Technik Öl auf Kupfer
kommt, außer bei einigen wenigen Schatzkammerstücken, nicht vor.


Im Gegensatz zu vielen anderen Wallfahrtsorten Europas, die ihre
Entstehung einem besonderen Ereignis verdanken, tritt Mariazell erst
allmählich als Gnadenstätte in Erscheinung. Die mit dem Gnadenort
verbundenen Legenden spielten dabei eine wichtige Rolle. In dem um 1622
vom Abt des Stiftes St. Lambrecht beauftragten Mirakelzyklus des Malers
Markus Weiss werden diese Legenden in umfassender und detailgenauer
Darstellung abgebildet. Der Bilderzyklus befand sich vorerst im
Kirchenraum an den Säulen des gotischen Längsschiffes, seit der
barocken Erweiterung auf den Emporen.
Der hier abgebildete Markgraf Heinrich von Mähren und seine Gemahlin
waren die ersten bekannten Pilger, welche entsprechend den Berichten zu
der abgelegenen Mönchszelle pilgerten. Der Überlieferung entsprechend
litten sie an schwerer, von den Ärzten als unheilbar bezeichneten
Gicht. Im Traum erschien ihnen der hl. Wenzel, der die Heilung durch
Gottes Hilfe zusagte und eine Wallfahrt nach Mariazell empfahl. Auf dem
Weg dahin soll Markgraf Heinrich durch den Heiligen selbst geführt
worden sein. So schwer verifzierbar diese Legende im Detail auch ist,
sie belegt, dass im Laufe des 13. Jhs. der Ruf Mariazells die lokalen
Grenzen zu sprengen begann.

Gegenüber, oberhalb der Ladislaus-Kapelle und dem Seiteneingang sehen
Sie großformatige Stuckplastiken mit allegorischer Darstellungen der
christlichen Tugenden: „Der Glaube" mit Kelch und Kreuz; „Die Hoffnung"
mit Anker; „Die Gerechtigkeit" mit verbundenen Augen und Waage, sowie
„Die Wahrheit" mit Spiegel und Schlange.
An der Wand daneben befnden sich in Nischen über den Durchgängen die
aus Holz gefertigten monumentalen Kirchenväter: der hl. Augustinus mit
einem kleinem Kind der hl. Ambrosius mit einem Bienenkorb und über den
Emporen der Hl. Gregor mit einer Taube. Im Zentrum des stuckierten
Vierungsgewölbes sind in Freskotechnik die Himmelfahrt Mariens umgeben
von musizierenden Engeln und seitlich in kreuzförmigen Kartuschen die
zwölf Aposteln dargestellt.

Die Zusammenstellung von verschiedenen plastischen Gegenständen zu
Kastenbildern zeigt die Votivanliegen sehr direkt. Die Menschen
stellten Kränze, Schleier, Haarteile, Trockenblumen, ein Stück eines
Knochens, einen eingetretenen Nagel und ähnliches in Form einer Collage
in einem individuell gestalteten Bildkasten aus.
Besonders beliebt war um 1900 die Opferung von Brautschleiern,
verbunden mit der Bitte um eine glückliche Ehe. Häufg stifteten
dankbare Frauen aus bäuerlicher Herkunft sogar ihren Haarzopf, also
ihren kostbarsten und persönlichsten Schmuck. Dies in einer Zeit, als
man sich ein Leben lang das Haar wachsen ließ und vor allem in
ländlichen Gesellschaften langes Haar bei Frauen eine festgesetzte Norm
darstellte.



Gegenüber, oberhalb der Benedikt-Kapelle sind großformatige
Stuckplastiken mit allegorischen Darstellungen der christlichen
Tugenden zu sehen: „die Mäßigung" mit zwei Krügen, ..die Tapferkeit" in
der Ausrüstung eines Kriegers neben einer Säule,..die Liebe" ein Kind
stillend und „die Sanftmut" mit dem Schaf.
Über den Emporen stehen die monumentalen Holzskulpturen der
Kirchenväter: der hl. Hieronymus mit dem Löwen und rechts in einer
Nische der hl. Augustinus mit dem Kind. Im Zentrum des stuckierten
Vierungsgewölbes ist in Freskotechnik die Himmelfahrt Mariens umgeben
von musizierenden Engeln und den Aposteln dargestellt.

Die Form des Schatzkammeraltars im Zentrum der Kapelle erinnert an das
Kriegszelt König Ludwigs von Ungarn, wie es auch auf dem Gemälde über
der Eingangstüre zu sehen ist. Das silberne Antependium war
ursprünglich eine Gabe von Kaiserin Maria Theresia aus dem Jahre 1769.
Es zeigte den Stammbaum des Hauses Habsburg-Lothringen mit
Porträtmedaillons. Im Zuge einer staatlich verordneten
Silberablieferung zur Finanzierung der Franzosenkriege wurde das
Antependium 1794 eingeschmolzen. 9 Jahre später vom Wiener Goldschmied
Joseph Würth im Auftrag von Königin Maria Carolina von Neapel-Sizilien,
einer Tochter Maria Theresias, nach dem alten Vorbild erneuert. Dem
Stammbaum wurden die Medaillons der königlich-neapolitanischen Dynastie
hinzugefügt. Ganz aus Silber gefertigt waren ursprünglich auch der
Tabernakel und der Baldachin über dem Schatzkammerbild.

Das Schatzkammerbild ist eines der kostbarsten Kunstobjekte und
gleichzeitig neben der Gnadenstatue das zweite Gnadenbild von
Mariazell. Es ist mit Eitempera auf Holz gemalt und zeigt Maria mit dem
Jesuskind. König Ludwig der Erste von Ungarn stiftete es aus
Dankbarkeit für den Sieg in einer entscheidenden Schlacht.
Das Bild wurde 1360 von Andrea Vanni aus Siena geschaffen. Der aus
Silber und Email gefertigte Rahmen stammt von einem Goldschmied aus
Neapel. Die Wappen nehmen Bezug auf Ludwig als König von Polen und
Ungarn. Die Bildtafel selbst ist mit vier dunkelblau emaillierten
Silberblechen mit den goldenen heraldischen Lilien von Anjou
verkleidet. Väterlicherseits entstammte König Ludwig der
neapolitanischen Linie des Hauses Anjou. Die dreireihige Perlenkette
wurde von Luise Gräfin Batthyani an ihrem Hochzeitstag im Jahr 1861
gestiftet. Das Gnadenbild ist hinter Glas mit einem spätbarocken
Strahlenkranz mit Engeln montiert, der 1764 zum 400-jährigen Jubiläum
der Ludwigsschlacht angefertigt wurde.

Über der Sakristei und der Sakramentskapelle befnden sich die beiden
Schatzkammern der Wallfahrtskirche. Hier sind die wertvollsten
Votivgaben, welche der Gottesmutter im Laufe der Jahrhunderte von den
Gläubigen dargebracht wurden, aufbewahrt. Zum „Schatz" werden diese
Opfergaben jedoch nicht durch ihre materielle, künstlerische oder
historische Bedeutung, vielmehr sind sie „Glaubensschatz", öffentlich
gezeigte Gottesverehrung und Dankbarkeit der Menschen.

Die heutige Sammlung besteht aus ca. 3200 plastischen Votivgaben. Diese
stellen dennoch nur einen Bruchteil dessen dar, was im Laufe der
Jahrhunderte gespendet wurde, denn auf staatliche Anordnung mussten
immer wieder wertvolle Stücke eingeschmolzen werden. Selbstverständlich
bleiben die Gaben heute unangetastet. Sie werden hier sorgfältig
verwahrt, nach Möglichkeit den Besuchern gezeigt und dürfen nicht
veräußert werden.

Enkolpion, Geschenk von Erzbischof Michael Staikos, Metropolit von Austria 1998

Anlässlich des 400-Jahr-Jubiläums des Schatzkammerbildes im Jahr 1764
wurde beim Aufgang zur Schatzkammer an der Nordseite des Kuppelraums
ein hölzerner Triumphbogen errichtet. Dieser wurde später in etwas
veränderter Form hier am Eingang der Nordschatzkammer aufgestellt und
ist dadurch noch erhalten. Über den Schöpfer des Entwurfs sind keine
Angaben überliefert, aber stilistische Untersuchungen verweisen auf den
Künstler Theodor Vallery.
Über dem Eingangsbogen ist das Wappen des Stiftes St. Lambrecht
erkennbar, am Giebel das Wappen Ungarns, mit zwei auf Türken stehenden
Kriegern als Wappenhalter. Darüber im Hintergrund sind, als Hinweis auf
die Ludwigslegende, gegen Türken kämpfende Soldaten in ungarischer
Uniform dargestellt, einer von ihnen trägt eine Fahne mit dem
Schatzkammerbild. Die Inschrift, die als Chronogramm die Jahreszahl
1864 zeigt, wurde zum 500-Jahr-Jubiläum angebracht.
Die Stuckaturen der Schatzkammer von 1666 stammen von Giovanni Rocco
Bertoletti. Die aus der selben Zeit stammenden Deckenfresken schuf
Giovanni Battista Colomba. Sie zeigen Szenen aus dem Leben Mariens.



Die beiden großen Reliquienschreine gehören zu den bemerkenswertesten
Exponaten der Mariazeller Schatzkammer. Im Jahre 1650 machte Papst
Innozenz X. die Gebeine der römischen Katakombenheiligen Cyrillus und
Eleutherius dem damaligen Abt von St. Lambrecht, Benedikt Pierin, zum
Geschenk. Um den Wert dieser besonderen Gabe zu unterstreichen, wurde
jeder einzelne Knochen mit feinster Seide umhüllt und anschließend mit,
bereits in der Mariazeller Schatzkammer befindlichem, Schmuck gefasst.
Es handelt sich um Renaissance-Emailschmuck, wie er zu jener Zeit auf
kostbare Gewänder aufgenäht getragen wurde. Insgesamt sind durch diese
Zweitverwendung eine Viertelmillion Süßwasserperlen aus
österreichischen Flüssen und mehr als tausend kunstvolle Schmuckstücke
erhalten geblieben. Die Schreine selbst stammen aus der Barockzeit.

In der Basilika werden neben der Gnadenstatue auch noch andere
Marienbilder verehrt: das wichtigste unter ihnen ist das von König
Ludwig I. von Ungarn geschenkte „Schatzkammerbild", welches sich
während des 15. Jahrhunderts zum zweiten Gnadenbild von Mariazell
entwickelte. Es befindet sich auf einem eigenen Altar in der
Nordschatzkammer.
Seit 1358 ist eine Verbindung von König Ludwig I. von Ungarn
(1342-1382) mit dem Gnadenort belegt. Er hat wahrscheinlich die
gotische Chorkapelle von Mariazell nach dem Vorbild des Aachener Chores
erbauen lassen. Von der großzügigen, durch seinen Biographen bezeugten
Ausstattung dieser Kapelle, hat sich in Mariazell aber nur das
Schatzkammerbild erhalten. Die Stiftung kann als eine diplomatische
Geste gegenüber den Habsburgern gedeutet werden, mit denen Ludwig
zeitweise durch Bündnisse und verwandtschaftliche Beziehungen verbunden
war. Der mit den Herrscherwappen geschmückte Rahmen und der mit Anjou-Lilien
verzierte Emaillebeschlag des Schatzkammerbildes weisen darauf hin,
dass dieses Bild der Machtrepräsentation des Königs diente, um seine
Stellung im Reich zu dokumentieren. Der König schenkte mehrmals
Mariendarstellungen als Bildreliquien, Kopien der vom Evanglisten Lukas
„gemalten" Bilder.



Die Legenden und die Fülle der wunderbaren Gebetserhörungen in
Mariazell wurden hier, wie auch an anderen Wallfahrtsorten, in Form von
Bilderserien, so genannten „Mirakelzyklen" dargestellt. Zur Förderung
des Rufes als Gnadenort wurden diese Serien ab dem 16. Jahrhundert in
gedruckter Form verbreitet. Hier zu sehen ist die Reproduktion eines
Holzschnittzyklus aus dem Jahr 1520.
Dargestellt sind die wichtigsten auf das Gebet zur Gnadenmutter
zurückführbaren ..Wunderheilungen" sowie Errettungen aus großer Gefahr
bis zu dieser Zeit. Durch die Vielfalt der Sorgen und Nöte einfacher
Bürger, des Klerus und des Adels ist ein tiefer Einblick in das Leben
und die Vorstellungswelt der Zeit vor 500 Jahren möglich. In den Wunderdarstellungen dominiert fast ausnahmslos das irrationale
Geschehen, das von Menschen nicht nachvollzogen werden kann. Ursache
und Wirkung werden in verkürzter Form dargestellt. Viele mögliche
psychologische Momente und Situationen werden geschildert: zunächst
fast immer Angst, Entsetzen, vielleicht unbestimmte Erwartung, dann
aber schließlich - nach Eintreten des Wunders - Überraschung und Freude.

Die Mariazeller Gnadenstatue ist 48 cm hoch und aus Lindenholz
geschnitzt. Die frühgotische, thronende Marienfgur hält an ihrer
rechten Seite das auf ihrem Schoß sitzende Christuskind. Das Kind hält
in der rechten Hand einen Apfel, mit der linken greift es nach einer
Frucht (Feige?), die ihm Maria reicht. Die Früchte symbolisieren die
Erlösung vom Sündenfall.
Seit dem 16. Jahrhundert war es üblich, Gnadenbilder mit kostbaren
gestickten Gewändern zu schmücken. Nur an zwei Tagen im Jahr ist die
Gnadenstatue ohne so genanntes Liebfrauenkleid zu sehen, nämlich am
Gründungstag von Mariazell, dem 21. Dezember, und am Tag des
Patroziniums der Basilika, zu Maria Geburt, am 8. September. Über 1,5
Millionen Gläubige pilgern derzeit pro Jahr zur Mariazeller
Gnadenstatue, die auch unter den Namen Magna Mater Austriae „Große
Mutter Österreichs", Magna Domina Hungarorum „Große Herrin der Ungarn"
und Mater Gentium Slavorum „Mutter der slawischen Völker" angerufen
wird.

Die „Mahlerische Reise von Wien nach Mariazell" stellt die wichtigsten
Stationen der mehrtägigen Fußwallfahrt entlang der „via sacra" von Wien
nach Mariazell dar. Bis heute folgen die Pilger diesem Weg. Dieser aus
40 Aquarellen bestehende Bilderzyklus des Wiener Malers Eduard Gurk
entstand im Anschluss an eine Wallfahrt von König Ferdinand V. von
Ungarn im Jahr 1833.
Es handelt sich um eine historisch sehr wertvolle, äußerst
detailgetreue und exakte Darstellungen der Landschaft, der Gebäude und
der Pilger auf der Strecke von der „Spinnerin am Kreuz" am Rande Wiens
bis zur Ankunft in Mariazell. Die Basilika, die Kirchenausstattung aber
auch die Schatzkammer zu Beginn des 19. Jahrhunderts sind darauf in
allen Einzelheiten zu erkennen. Die Originalaquarelle befnden sich im
Niederösterreichischen Landesmuseum in St. Pölten.



Im Jahre 1752 wurden auf den seitlichen Emporen in Höhe des
Gnadenaltars zwei gleich gestaltete Seitenorgeln errichtet. Mit diesen
beiden Seitenorgeln war nun gemeinsam mit dem Rückpositiv der
Hauptorgel jenes Spiel an drei Orgeln möglich, wie es vor allem für das
18. Jahrhundert überliefert ist. Dafür gab es einige Kompositionen, wie
z. B. jene Pastorella eines unbekannten Meisters, welche am
Dreikönigstag gespielt werden konnte.
Das neue Orgelkonzept von 2003 sah die Wiedererrichtung von klanglich
eigenständigen Werken in den Seitenorgeln vor. Die nördliche
Seitenorgel bekam ein völlig neues Werk der Vorarlberger Orgelbaufirma
Pflüger aus Feldkirch, die südliche Orgel wurde mit dem restaurierten
Pfeifenwerk des 18. Jahrhunderts bestückt. Beide Seitenorgeln wurden in
die restaurierten Gehäuse von 1752 eingebaut.
Die nördliche Seitenorgel mit 9 Registern auf 1 Manuale und Pedal ist
eine Stiftung der Freunde des Raiffeisen-Generalanwaltes Dr. Christian
Konrad und trägt nun den Namen Konrad-Orgel.
Die südliche Seitenorgel mit 6 Registern auf 1 Manuale mit dem alten
Pfeifenwerk wurde von der Österreichischen Nationalbank gestiftet und
trägt den Namen Marien-Orgel.

In der Südschatzkammer sind die von Königen und Fürsten gestifteten,
besonders kostbaren und wertvollen Gaben zu sehen. Die wertvollsten
unter ihnen stammen aus dem eng mit Mariazell verbundenen Hause
Habsburg, wie eine Ewiglichtampel von Ferdinand III. aus dem Jahr 1652,
das Kokosnussziborium und Altarleuchter aus Bergkristall als Votivgabe
von Kaiser Leopold I., die Leuchtergarnitur von Karl VI. und eine Ampel
der Kaiserin Maria Theresia.
Die südliche Schatzkammer ist Maria als Himmelskönigin gewidmet. Die
Stuckaturen (nach 1665) stammen von Giovanni Rocco Bertoletti. Zur
selben Zeit schuf Giovanni Battista Colomba die Deckenfresken. Es
begegnen uns Szenen aus dem Leben Mariens: die Verkündigung an Anna,
die Geburt Mariens, die Verkündigung an Maria, die Geburt Christi, die
Anbetung der Heiligen Drei Könige, die Darstellung im Tempel und die
Flucht nach Ägypten. Die Schubladen der geschnitzten barocken Kästen
bergen wertvolle Messgewänder, die teilweise auch heute noch in
liturgischer Verwendung sind.



Marienkleider, auch Liebfrauenkleider genannt, dienen ebenso wie die
Kronen seit um 1500 dem Schmuck der Gnadenstatue. Die Kleider wurden
meist von adeligen Damen gestiftet und in einigen Fällen auch von ihren
Stifterinnen eigenhändig aus kostbarem Material angefertigt, oft sogar
unter Verwendung des eigenen Brautkleides. Der heutige Bestand stammt
überwiegend aus dem 19. und 20. Jahrhundert, da unter Kaiser Joseph II.
ab 1786 ein Bekleidungsverbot für die Gnadenstatue verfügt und der
Verkauf von mehr als 50 Kleidern und der Kronen erzwungen wurde. Erst
1797 erreichte Hofrat Franz von Zwerenz von Kaiser Franz II. die
Erlaubnis, die Statue wieder einzukleiden und mit Kronen zu schmücken.
150 Liebfrauenkleider und die dazugehörigen Baldachine werden in der
Mariazeller Schatzkammer aufbewahrt. Sie werden in regelmäßigen
Abständen - den Farben des liturgischen Jahres entsprechend - vom
Mesner ausgewechselt.


Der Brauch der Bekrönung von Marienstatuen reicht bis in das
Mittelalter zurück, als Könige und Königinnen an großen Festen neu
gekrönt wurden. Neben den Liebfrauenkleidern sind Kronen und Schmuck
Ausdruck der Verehrung und ein Zeichen der besonderen Stellung der
Gottesmutter als Königin des Himmels. Im Zuge der Einschränkungen der
Wallfahrt unter Joseph II. wurde 1786 die Krönung des Gnadenbildes
untersagt und die 17 vorhandenen barocken Kronen eingeschmolzen. Die
heute in der Schatzkammer aufbewahrten, aus Gold oder Silber
gefertigten und mit Edelsteinen und Perlen geschmückten Krönchen
entstammen dem 19. und 20. Jahrhundert.




Büste der Kaiserin Elisabeth (geb. 24. Dezember 1837 in München,
ermordet am 10. September 1898 in Genf). Sie pilgerte oftmals nach
Mariazell und brachte Gaben in die Schatzkammer. Die Büste wurde 1903
von der Wiener Männerwallfahrt gewidmet und 1902 als Denkmalentwurf vom
Wiener Bildhauer Robert Weigl geschaffen.

Zugang und Rückseite der Hauptorgel




Ursprünglich entwarf der bedeutende Baumeister Domenico Sciassia eine
barocke Dreiturmfassade, welche eine völlige Umgestaltung des gotischen
Mittelturmes vorsah. Aus Rücksicht auf die Bedeutung Mariazells für die
Ungarn, deren König Ludwig I. der Überlieferung zufolge den gotischen
Turm errichten ließ, wurde dieser Plan jedoch verworfen. Es entstand
die charakteristische Dreiturmfassade der Mariazeller Basilika, aus
heutiger Sicht ein unverwechselbares Wahrzeichen.
Domenico Sciassia starb 1679, nach 40 Jahre Wirken für das Stift
St.
Lambrecht und vier Jahre vor der Vollendung seines Werkes in Mariazell.
Seine Gruft befndet sich im südlichen Seitenschiff der Basilika. Mit
einer Gesamtlänge von 84 Metern und einer Breite von 30 Metern ist
die Basilika Mariazell die größte Kirche der Steiermark und somit der
Diözese Graz-Seckau.

Der Wallfahrtsort Mariazell war im 19. Jahrhundert einer der am
stärksten besuchten Fremdenverkehrsorte Österreich-Ungarns.
Überlegungen zur Errichtung einer Bahn von St. Pölten nach Mariazell
gab es daher schon seit Eröffnung der Westbahn im Jahr 1858. Mehrere
Varianten als Verlängerung einer der normalspurigen Strecken im
niederösterreichischen Alpenvorland wurden in den folgenden Jahrzehnten
ins Auge gefasst. Wegen des schwierigen Terrains sollte die Bahn als
Schmalspurbahn zur Ausführung gelangen. Die Spurweite von 760
Millimetern war, wie bei allen Schmalspurbahnprojekten in der
Donaumonarchie von der Militärverwaltung vorgegeben, da bei Bedarf
Fahrzeuge zum Kriegsdienst auf den Bahnen in Bosnien-Herzegowina
eingezogen werden sollten.
Für die Erneuerung der Mariazellerbahn wurden durch das Land
Niederösterreich ab Dezember 2012 neun neue Gelenktriebwagen (NÖVOG
ET1–ET9) angeschafft, die unter dem Namen Himmelstreppe bekannt wurden.

Wem der viele Text zu lange war und lieber Bewegtbilder mit Musik mag,
kann sich gerne dieses Video antun: