web steiner
Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen
Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.
+43/2624/54014 - office@websteiner.com
Münster
in Westfalen, September 2024
Die kreisfreie Stadt Münster in Westfalen ist Sitz
des nach ihr benannten Regierungsbezirks in Nordrhein-Westfalen. Von
1815 bis 1946 war Münster Hauptstadt der preußischen Provinz Westfalen.
Die Stadt an der Münsterschen Aa liegt zwischen dem Ruhrgebiet und
Osnabrück im Zentrum des Münsterlandes.
1534 begann die dramatische Episode des Täuferreichs von Münster.
Sie gipfelte in der Proklamation des Königreichs Zion im September 1534
durch Jan van Leiden mit sich selbst als König. Dieses Königreich hatte
jedoch nur bis zum 24. Juni 1535 Bestand, als Truppen des Bischofs
Franz von Waldeck die belagerte Stadt einnahmen. Die gefolterten und
hingerichteten Anführer der Täufer wurden anschließend in drei eisernen
Körben an der Lambertikirche zur Abschreckung aufgehängt. Die Originale
der Körbe aus dem Jahre 1535 hängen dort noch immer.
1648 fand in Münster und Osnabrück ein Ereignis von europäischem Rang statt. Der Westfälische Friede
wurde geschlossen, mit dem der Dreißigjährige Krieg und der
Achtzigjährige Krieg beendet wurden. Als „Stätte des Westfälischen
Friedens“ wurde das Rathaus in Münster neben dem in Osnabrück Mitte
2015 von der Europäischen Kommission mit dem Europäischen
Kulturerbe-Siegel ausgezeichnet.
Erbdrostenhof - Private Villa
aus den 1750er‑Jahren, entworfen von dem bekannten Barockarchitekten
Johann Conrad Schlaun. Der Erbdrostenhof ist ein barockes Adelspalais
in Münster, gelegen an der Salzstraße 38. Er wurde nach Plänen von
Johann Conrad Schlaun für den münsterschen Erbdrosten Adolf Heidenreich
Freiherr Droste zu Vischering von 1753 bis 1757 erbaut. Bemerkenswert
ist der dreiflügelige Bau durch seine hoch repräsentative Gestaltung
auf sehr beengter Grundfläche.

Clemenskirche, leider geschlossen

Die Dominikanerkirche war Teil einer Klosteranlage, von der als Ruine
nur noch eine Wand erhalten ist, die an die Sandsteinfassade der Kirche
angrenzt. Im Zuge der Säkularisation wurde das Dominikanerkloster 1811
aufgehoben. Die Klosteranlage ging in staatlichen (preußischen) Besitz
über, die Kirche wurde ab 1826 für militärische Zwecke genutzt.
Tomitaro Nachi Windspiele vor der Dominikanerkirche

Das Foucaultsche Pendel in Münster befindet sich in der
Dominikanerkirche. Die Installation mit dem Titel „Zwei Graue
Doppelspiegel für ein Pendel“ wurde von dem Künstler Gerhard Richter
geschaffen und 2018 der Stadt Münster übergeben. Sie ist in der
profanierten barocken Kirche unter der Vierungskuppel installiert und
zeigt die Erdrotation auf eindrucksvolle Weise.
Details zur Installation
Pendelkugel: 48 kg schwere Messingkugel mit 22 cm Durchmesser
Seillänge: 28,75 Meter langes Edelstahlseil
Bodenplatte: 5,6 Meter Durchmesser, aus 380 Millionen Jahre altem
Grauwacke-Sedimentgestein
Magnetfeldantrieb: Sorgt für die kontinuierliche Bewegung des
Pendels
Bewegung: Die Schwingungsebene des Pendels dreht sich innerhalb
von etwa 30 Stunden einmal vollständig um 360 Grad, was die Erdrotation
sichtbar macht

St. Lamberti ist eine römisch-katholische Pfarrkirche im Stadtkern von
Münster (Westfalen). Sie wurde zwischen 1375 und 1525 als Markt- und
Bürgerkirche erbaut und bildet den nördlichen Abschluss des
Prinzipalmarktes; örtliche Kaufleute finanzierten den Bau. St. Lamberti
ist das bedeutendste sakrale Gebäude der westfälischen Spätgotik.
Namensgeber ist der heilige Lambert von Lüttich.
St. Lamberti - Für ihren gotischen Turm mit 3 Eisenkörben über der Uhr berühmte Kirche.

Eine Besonderheit sind drei am Turm befestigte Eisenkörbe. In ihnen
wurden 1536 die Leichname der drei Anführer des Täuferreichs von
Münster Jan van Leiden, Bernd Krechting und Bernd Knipperdolling zur
Schau gestellt, nachdem sie auf dem Platz vor der Kirche öffentlich
gefoltert und hingerichtet worden waren.
Nach ihrer Verurteilung am 16. Januar 1536 erfolgte zu Füßen der
Lambertikirche am 22. Januar des gleichen Jahres die öffentliche
Marterung und Hinrichtung der drei verbliebenen Anführer des
Täuferreichs von Münster, Jan van Leiden, Bernd Krechting und Bernd
Knipperdolling. Die Leichen wurden am Turm der Kirche in drei eisernen
Körben aufgehängt, „daß sie allen unruhigen Geistern zur Warnung und
zum Schrecken dienten, daß sie nicht etwas Ähnliches in Zukunft
versuchten oder wagten“. Im oberen der im Dreieck angebrachten Körbe
befand sich der Leichnam von Jan van Leiden, im linken von
Knipperdolling und im rechten von Krechting. Noch 50 Jahre lang sollen
Knochenreste in den Körben zu sehen gewesen sein.

Die Lambertikirche steht am Kreuzungspunkt alter Straßen: Sie markiert
das nördliche Ende des Prinzipalmarkts, weiter schließt sich nahtlos
der Roggenmarkt an. In direkter Nachbarschaft der Kirche befand sich,
inmitten des Roggenmarktes, bis Anfang des 20. Jahrhunderts die
Häuseransammlung des Drubbels. Nach Osten liegen der Alte Fischmarkt
und die Salzstraße.
St. Lamberti, die »Wurzel Jesse« (Stammbaum Jesu) über dem Südportal
Über dem Hauptportal an der Südseite ist im Hochrelief die »Wurzel
Jesse« zu sehen, also jene in der Schrift erwähnte Gruppe leiblicher
und symbolisch zu verstehender Vorgänger Jesu Christi.

Das Innere der Lamberti-Kirche ist überwältigend schön. Die
hochragenden Säulen tragen das kunstvoll gestaltete Gewölbe – ein
Abbild des Himmels. Da das mittlere Schiff und die beiden Seitenschiffe
gleich hoch sind, nennt man den Raum „Gotische Hallenkirche“. Die
zahlreichen Fenster lassen am Tag das Licht hereinfluten. Darum wird es
dem Besucher „leicht um das Herz“, so dass es ihn – wenn er glaubt –
zum Beten drängt. Nicht wenige Menschen suchen die Stille und Weite des
Raumes auf, setzen sich oder knien in den Bänken und finden im Getriebe
des Alltags hier ihre Ruhe, wenn sie ihr Leben Gott hinhalten und in
seiner unsichtbaren Gegenwart verweilen. Sie wissen dann: Gott schaut
mich in seiner Liebe voller Sehnsucht an und will mein Innerstes mit
sich selbst reich machen.
Am zweiten Pfeiler auf der linken Seite des Kirchenraumes steht die
sogenannte „Kanzel“, versehen mit einem Schalldeckel. Hier wurde früher
die Predigt gehalten, als es noch keine Mikrophonanlagen gab. Von hier
aus hat auch der bekannte Bischof von Galen öffentlich gesprochen, als
er während der nationalsozialistischen Zeit die Vernichtung der geistig
und körperlich Behinderten unter Hitler verurteilt hat. Sein Bronzebild
hängt auf der Außenwand der Kirche zur Südseite hin.

Die farblich und als Bilder gestalteten 3 Fenster in der Achse des
Hochchores zeigen in der Mitte den gekreuzigten Jesus Christus. Unter
dem Kreuz stehen Maria und der Evangelist Johannes, der in der Bibel
des Neuen Testamentes das kostbare Johannes-Evangelium geschrieben hat.
Er hat die Worte Jesu festgehalten: „Ich bin gekommen, damit sie das
Leben haben und es in Fülle haben“. Und: „Wenn ich am Kreuz erhöht bin,
werde ich alle an mich ziehen“. Denn das Kreuz lässt den, der glaubt,
erkennen: Gott ist die Liebe. Und in seiner Liebe rettet er uns, obwohl
wir Sünder und endliche, sterbliche Menschen sind. – Das linke Fenster
erinnert an die Auferstehung Jesu zu Ostern. Das rechte Fenster
erinnert an die Himmelfahrt Jesu, der in die unsichtbare Herrlichkeit
des himmlischen Vaters heimgekehrt ist und den Menschen – überall auf
der Erde – nun noch näher gekommen ist, da er in der Kraft seines
Geistes in das menschliche Herz kommen will.
Ebenfalls in der Achse der Kirche steht am Übergang des Hochchores der
steinerne Altar. Dorthin werden im Gottesdienst die Gaben von Brot und
Wein gebracht, über die der Priester die Worte Jesu aus dem letzten
Mahl Jesu mit seinen Jüngern spricht: „Das ist mein Leib, der für euch
hingegeben wird“. „Das ist mein Blut zur Vergebung der Sünden“. Wenn
die Gläubigen diese Gaben empfangen, kommt Jesus Christus mit seiner
ganzen Liebe und Hingabe zu den Gläubigen, um mit ihnen eins zu werden,
aber auch, um sie miteinander eins zu machen. So werden sie zur
Gemeinschaft der Kirche.

Die Orgel schwebt leicht wie ein Vogelnest am Ende des Westwerkes im
Kirchenraum. Die Klangmöglichkeiten der Orgel sind so reichhaltig, dass
diese zu den berühmtesten Instrumenten in der Stadt zählt. Mit ihrer
Musik will sie Glanz in den Gottesdienst bringen, da Gott nicht nur mit
dem menschlichen Herzen gelobt werden kann, sondern auch mit all den
Klängen, die Gott in seine Schöpfung hineingelegt hat. Vor allem
unterstützt die Orgel den Gesang der Gemeinde.
Die große Orgel von der Berliner Orgelbaufirma Karl Schuke wurde 1989
ohne Empore und Bodenstütze gleichsam schwebend in den Mittelraum des
Turmjochs eingehängt. Der gesamte Orgelkörper ist aus Eiche, wobei die
beiden tragenden Arme mit den beiden Emporen verbunden sind. Sie bilden
die Brücke zwischen Emporen und der Orgel,
über welche manin das Innere der Orgel gelangt, wo sich der Spieltisch
befindet. Die Disposition des 53-Register-Werks, verteilt auf 3
Manuale/Pedal, schuf Prof. Ludwig Doerr, Freiburg/Brsg.

Auf der dem Altar gegenüberliegenden Seite zum Westwerk hin steht unter
der Orgel der Taufbrunnen. Hier werden alle mit Wasser getauft, die zum
Glauben an Jesus Christus gekommen sind, und damit in seine
Gemeinschaft und die der Kirche eintreten. Man kann nur einmal getauft
werden. Bei der Kindertaufe übernehmen die Eltern und Paten
stellvertretend das Taufbekenntnis. (Wenn die Kinder etwa 10 Jahre alt
sind, bekennen sie selbst und öffentlich vor der Gemeinde den Glauben.)

St. Lamberti, Flügelaltar mit Szenen aus dem Leben Mariens, um 1500
Das Landesmuseum hat den um 1500 im Schlesischen Raum entstandenen
Flügelaltar an der Stirnwand des nördlichen Seitenschiffes der Kirche
als Leihgabe überlassen. Im Mittelfeld ist die Madonna mit dem Kind
dargestellt, welche auf der linken Seite Maria Magdalena, erkennbar an
der Salbendose, und auf der rechten Seite die hl. Barbara, erkennbar an
dem kleinen Turm, als Begleiterinnen hat. Die Seitentafeln zeigen von
links nach rechts in den oberen Feldern die Verkündigung und die
Begegnung mit ihrer Base Elisabeth und in den unteren Feldern die
Geburt und die Anbetung der Könige. Die Rückseiten der Tafeln sind noch
nicht ausgemalt.

Im vorderen Teil der Kirche gibt es am Ende des rechten Seitenschiffs
einen kleinen Raum. Dort brennt in einer Ampel ein rotes Licht. Es hat
seinen Platz über dem „Tabernakel“, einem in Gold gefassten kleinen
Häuschen, einem Tresor, in dem die Gaben des Brotes aufbewahrt werden,
in dem Jesus den Menschen nahe bleiben will. Die Beter kommen an diesen
Ort, um in einer „Privataudienz“ ihr Herz Jesus zu schenken, ihre
Sorgen zu sagen, aber auch Jesus anzubeten, weil er – so glauben
katholische Christen – „wahrer Gott“ ist.
St. Lamberti, Silberexpositorium im Chor, 1782
Aus dem wohlverwahrten Kirchenschatz, dem Gerät, das bei feierlichen Gottesdiensten Verwendung fand und auch
noch findet, sei ein in gotisierenden Formen gearbeitetes,
silbervergoldetes Turmziborium mit plastischen Figürchen der Apostel an
der Kuppe und einem Doppelkruzifix auf der Spitze (15. Jh.?) erwähnt,
eine barocke Sonnenmonstranz Augsburger Herkunft (um 1730) sowie
mehrere barocke Messgewänder aus dem 17. und 18. Jh. Das wertvolle
klassizistische Silberexpositorium, nach einem Entwurf des
münsterischen Baumeisters und
Schlaunnachfolgers Wilhelm Ferdinand Lipper 1782 gearbeitet, eigentlich
nur zum Gebet vor dem Altarsakrament auf den alten Hochaltar gestellt,
steht heute im Scheitelpunkt des Hochchores.

Im Jahr 2022 wurde die sogenannte Himmelsleiter der österreichischen
Künstlerin Billi Thanner in zwei Teilen über dem Taufstein im Innenraum
der Kirche und am Maßwerk des Lambertikirchturms befestigt.
Die Wiener Künstlerin Billi Thanner hat während der Corona-Pandemie am
Stephansdom eine Himmelsleiter installiert, die ein Zeichen der
Hoffnung und des Lichtes für die Stadt Wien in dieser Zeit war. Danach
ist dieses Kunstwerk der Hoffnung auf und in der Lambertikirche in
Münster gezeigt worden. Die innere Leiter ist noch heute durch eine
großzügige Spende der Kaufmannschaft zu sehen.

Der Prinzipalmarkt ist ein Straßenzug in Münster. Der Name bedeutet
Hauptmarkt, im Unterschied zum Roggenmarkt und Fischmarkt, die im
weiteren Verlauf der Straße folgen. Der Prinzipalmarkt dokumentiert mit
seinem Grundriss und der Bebauung die geschichtliche und bauliche
Entwicklung des wirtschaftlichen und politischen Zentrums von Münster.
Als Denkmalbereich hat der Prinzipalmarkt objektübergreifenden
Ensembleschutz. Er wird auch als „gute Stube“ Münsters bezeichnet.

Der Stadthausturm im westfälischen Münster ist der einzige noch
erhaltene Teil des ehemaligen Stadthauses. Er befindet sich am
südlichen Ende des Prinzipalmarkts. Das Haus und somit auch der Turm
wurden in den Jahren von 1902 bis 1907 durch Alfred Hensen im Stil der
Neorenaissance entworfen.

Kirschensäule - Auf dem Harsewinkelplatz wurde 1987 im Rahmen der
Skulptur Projekte Münster mit der Kirschensäule von Thomas Schütte
eines der bekanntesten Kunstwerke aus Münsters Innenstadt aufgestellt.
Die sechs Meter hohe Skulptur besteht aus einer Säule, die aus einem
Sockel und Schaft aus Sandstein besteht und von zwei großen, rot
lackierten Aluminiumkirschen gekrönt wird. Die Kirschensäule wurde 1987
von der Stadt angekauft und blieb dem Stadtbild damit bis heute
erhalten.

St. Ludgeri - 1180 im Stil der Romanik erbaute Kirche mit 1383 erweiterten gotischen Etagen und Glocke aus dem Jahr 1493.

Das Mittelschiff von St. Ludgeri besteht aus zwei Jochen, denen auf
westlicher Seite ein quadratisches Halbjoch vorgelagert ist. Auf
östlicher Seite schließt sich das Vierungsquadrat an, dem außen der
Vierungsturm aufgesetzt ist. Die Deckenkonstruktion besteht hier aus
einem abgeflachten Kuppelgewölbe. Zu beiden Seiten des Mittelschiffes
befinden sich Seitenschiffe. Aufgrund ihrer Höhe erlauben sie keine
zusätzlichen Fenster im Mittelschiff (Bautypus der dreischiffigen
spätromanischen Hallenkirche westfälischer Prägung).
Dem auf Höhe der Querschiffe angeordneten Vierungsquadrat folgten beim
ursprünglichen Bau drei Apsiden. Die mittlere war größer als die beiden
äußeren, da sie den Altar und das Chorgestühl aufnehmen musste. Nach
dem Stadtbrand von 1383 wurden die Apsiden abgetragen und durch einen
großen Chor im Stile der Gotik ersetzt, der zusammen mit dem Chor von
St. Lamberti zu den bedeutendsten Werken der Gotik im Münsterland
zählt. Neben den Fenstern mit eigenwilliger Farbgebung aus dem Jahre
1961 von Vincenz Pieper lässt die besondere Architektur ihn größer
erscheinen, als er eigentlich ist. Während der im Westen eine Breite
von 9,64 m aufweist, beträgt sie im Osten 10,15 m und erweckt so den
Eindruck, als ob die perspektivische Verengung aufgehoben wird. Dem
Chor schließt sich die nach dem Stadtbrand neu geschaffene Apsis an,
deren Form aus sieben Kanten eines Zehnecks besteht.

In den sieben Wänden des Chors befinden sich die Fenster von Vincenz
Pieper. In der Gesamtbetrachtung vereinen sie sich zu einem Gesamtbild,
in dem die Pfeiler zwischen den einzelnen Fenstern zu verschwinden
scheinen. Im mittleren, direkt nach Osten gerichteten Fenster wird der
Heilsweg Jesu Christi aufgezeigt, das heißt seine Geburt, sein Leiden
und Sterben, seine Auferstehung und Himmelfahrt sowie seine
Wiedergeburt. In den beiden sich direkt anschließenden Fenstern sind
die Zeugen des Herrn zu sehen.
Im Zentrum der Apsis befindet sich seit 1998 ein gegen Ende des 15.
Jahrhunderts in Tirol gefertigter Flügelaltar, in dessen Mitte die
Anbetung des Jesuskindes durch die Heiligen drei Könige dargestellt
ist. Im linken Flügel sind die heilige Margareta sowie Laurentius
abgebildet, im rechten Flügel Katharina von Alexandrien und der
Evangelist Johannes. Die Außenseite des Altars zeigt Paulus, Petrus,
Urbanus und Bartholomäus.

Die Orgel befindet sich an der Ostwand des nördlichen Seitenschiffes.
Das Instrument steht ebenerdig. Das barocke Orgelgehäuse wurde 1750 von
einem anonymen Meister für die Marienkirche in Warendorf erbaut. Es
befindet sich erst seit 1966 in der St. Ludgeri-Kirche. Das Orgelwerk
wurde 1966 von dem Orgelbauer Matthias Kreienbrink in Osnabrück erbaut.
Das Schleifladen-Instrument hat 24 Register auf zwei Manualen und
Pedal. Die Spiel- und Registertrakturen sind mechanisch.

Auf der Westseite ist ein handgeschnitztes Bildnis des gekreuzigten
Jesus Christus angebracht, das 1929 vom Bildhauer Heinrich Bäumer
gefertigt und bei einem Bombenangriff 1944 beschädigt wurde. Auf
Beschluss der Kirchengemeinde blieb das Werk nach Ende des Zweiten
Weltkrieges in dieser beschädigten Form, bei der der Figur beide Arme
fehlen. An der Stelle, wo sich zuvor die Arme befanden, ist nun eine
Inschrift mit den Worten „ICH HABE KEINE ANDEREN HAENDE ALS DIE EUEREN“
angebracht. Direkt unter dem Kreuz hängen die Medaillons zweier
Persönlichkeiten, die in besonderen Beziehungen zur Kirchengemeinde St.
Ludgeri stehen. Dabei handelt es sich um Niels Stensen und Edith Stein.

Marienplatz in Münster, Deutschland

Für seine Skulptur '100 Arme der Guan-yin'
in Münster ließ sich Huang Yong Ping (1954-2019) sowohl von Duchamps
ikonischem Werk, dem Flaschentrockner (1914), als auch von der
Christusfigur in der Kirche St. Ludgeri, die bei einem Bombenangriff im
Zweiten Weltkrieg die Arme verlor, inspirieren. Der sechs Meter hohe
Flaschentrockner ist anstelle von Flaschen mit 50 modellierten Armen
bestückt, die wiederum auf die buddhistische Göttin Guanyin verweisen.2
Während in den 1000 Händen der Göttin religiöse Gegenstände liegen,
versieht Huang Yong Ping seine Hände mit Alltagsgegenständen, die einem
europäischen Publikum geläufig sind.
100 Arme der Guanyin, 1997
Stahlgerüst in Form eines Flaschentrockners, 50 modellierte Abgüsse von 3 Armformen, Höhe 6 m

Historisches Rathaus Münster - Symbolträchtiges Rathaus aus dem 14.
Jh., berühmt für seinen aufragenden kunstvollen gotischen Giebel.

Münsters Rathaus, ein gotischer Bau aus der Mitte des 14. Jahrhunderts
mit seinem hohen Giebel, sucht in Deutschland seinesgleichen. Das
charakteristische Bogenhaus wurde in den fünfziger Jahren
originalgetreu wieder aufgebaut. Als "Stätte des Westfälischen
Friedens" wurde das Rathaus am 15. April 2015 mit dem Europäischen
Kulturerbe-Siegel ausgezeichnet.
1927, anlässlich des Besuchs des Hansischen Geschäftsvereins, schenkte
der 1835 gegründete Verein der Kaufmannschaft dem Rat der Stadt das
Modell eines alten Hanseschiffes. Es soll im Rathaus an Münsters
400-jährige Zugehörigkeit zur Hanse erinnern. Das Modell zeigt eine
Kraweel (mndt. von portug. = Caravela), im Lübecker Schifferhaus nach
dortigem Vorbild angefertigt. Im ausgehenden Mittelalter wurde sie zum
bekanntesten Schiffstyp Nordeuropas und löste mit ihren nebeneinander
liegenden Planken die Hansekogge ab, die im Klinkerbau überlappende
Planken hatte. Die Kraweel, die bereits im alten Ägypten bekannt war,
ermöglichte größere Rümpfe für bis zu 400 Tonnen Ladung und sorgte
durch die glatte Oberfläche und mit sechs bis acht Segelflächen auch
für mehr Wendigkeit und höhere Geschwindigkeiten.
Bürgerhalle mit dem Schiffsmodell und der Replik des Sendschwertes

Der Friedenssaal war 1648 Schauplatz der Beschwörung des
Spanisch-Niederländischen Friedens, der Teil des Westfälischen Friedens
war. Anfang 2003 wurde der Saal komplett restauriert.
Die Ratskammer, seit dem 18. Jahrhundert auch als Friedenssaal bekannt,
ist ein knapp 10 m × 15 m großer Saal, der rundherum in Holz im Stile
der Renaissance getäfelt ist. Der Boden ist als Kontrast zum warmen
Holz grau gefliest. Die Vertäfelungen an den Längsseiten des Saals, d.
h. die Westwand sowie die östliche Fensterwand, entstanden im Jahre
1577, ersichtlich an einer Füllung an der Eingangstür zum Saal.
Unter der Decke des Saals befindet sich aufgehängt ein massiver Kronleuchter,
der von flämischen Kunstschmieden geschaffen wurde. Er ruht auf dem
Geweih eines ungeraden Achtenders und ist mit Jagdszenen und
Tierdarstellungen verziert. Weitere Verzierungen bestehen aus dem
Stadtwappen, einer spätgotischen Madonnenfigur, einer goldenen Krone
sowie zwei goldenen Kugeln und einer geschnitzten Rose, aus der die
Deckenaufhängung entspringt. Der äußere Ring um die geschnitzte Rose
ist mit einer Umschrift aus Goldbuchstaben aus dem „Buch der Weisheit“,
Kapitel 1, Vers 1, versehen. Sie lautet „Diligite iustitiam, qui
iudicatis terram“ und bedeutet in der Übersetzung „Liebet die
Gerechtigkeit, ihr, die ihr über die Erde richtet.“

1648 fand in Münster und Osnabrück ein Ereignis von europäischem Rang
statt. Der Westfälische Friede wurde geschlossen, mit dem der
Dreißigjährige Krieg und der Achtzigjährige Krieg beendet wurden. Als
„Stätte des Westfälischen Friedens“ wurde das Rathaus in Münster neben
dem in Osnabrück Mitte 2015 von der Europäischen Kommission mit dem
Europäischen Kulturerbe-Siegel ausgezeichnet.
Die Nordwand wird maßgeblich
durch eine große Schrankwand dominiert. Vor der Schrankwand befindet
sich ein Richtertisch und die Bürgermeisterbank, auf der die beiden
Bürgermeister, also der Stadtsyndikus und der Stadtschreiber saßen. In
die Schrankwand sind insgesamt 22 kleine Fächer in zwei Reihen
übereinander eingelassen. Diese sind aufgeteilt in zwölf Fächer auf der
linken sowie zehn Fächer auf der rechten Seite und mit Abbildungen
verziert. Vier von ihnen zeigen biblische Szenen, sechs zeigen
Heiligenfiguren als Patrone münsterscher Pfarrkirchen, drei sind mit
heraldischen Abbildungen versehen und sieben mit menschlichen Lastern
verziert. Zwei weitere lassen sich keiner bestimmten Gruppe zuordnen.

Der Westfälische Friede
(Latein: Pax Westphalica) oder der Westfälische Friedensschluss besteht
aus zwei Friedensverträgen, die am 24. Oktober 1648 in Münster und
Osnabrück geschlossen wurden und den Dreißigjährigen Krieg beendeten.
Zusammen mit dem am 15. Mai desselben Jahres ratifizierten Frieden von
Münster, der parallel verhandelt wurde, aber nicht als Teil des
Westfälischen Friedens gilt, fand damit der erste große
Friedenskongress der Neuzeit seinen Abschluss. Beide Verträge wurden
schließlich am selben Tag, dem 24. Oktober 1648, in Münster im Namen
von Kaiser Ferdinand III. und König Ludwig XIV. von Frankreich bzw.
Königin Christina von Schweden unterzeichnet.

An der Südwand befindet sich ein mächtiger Kamin.
Allerdings handelt es sich hierbei nicht um das Original aus dem Jahre
1577, da jener zusammen mit dem Rathaus im Oktober 1944 zerstört wurde.
Stattdessen befindet sich an dieser Stelle nun der Kamin des
Krameramtshauses aus dem Jahre 1621. Dieser zeigt das Gleichnis des
Reichen und des armen Lazaraus (Evangelium nach Lukas, Kapitel 16,
Verse 19–31). Der Kamin besitzt im oberen Teil einen großen Giebel, der
mit der Person der Justitia mit Schwert und Waage verziert wurde.

Vor dem Kunstmuseum Pablo Picasso Münster befindet sich der
Picassoplatz. Zentrales Element und zugleich die Besonderheit des
Platzes ist ein überlebensgroßes Konterfei von Pablo Picasso aus
Pflastersteinen, das sich ausgehend vom Graphikmuseum quer über die
Königstraße und den Platz erstreckt. Für die Pflasterung wurde roter
Granit aus Vietnam, Basalt aus der Eifel sowie Betonstein aus Münster
selbst verwendet. Sämtliche verwendeten Steine weisen dieselbe Größe
von 23,9 × 23,9 cm auf.

Die Errichtung der Münsteraner Weltzeituhr
an der Rothenburg geht auf die Initiative des Uhrmachermeisters Wilhelm
Nonhoff zurück. Bei dem Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg wollte
er endlich die mehr als zwanzig Jahre alte Idee realisieren, an der
Fassade seines Geschäftshauses eine große Außenuhr zu installieren.
Die Hauptuhr ist von insgesamt zehn weiteren Zeitanzeigen umgeben: Ganz
oben sieht man die azurblaue Mondscheibe, die sowohl die Stellung des
Mondes im Monatslauf als auch einige Sternbilder wiedergibt. In sie
eingefügt sind die beiden Erdhalbkugeln. Im Ziffernkranz der Normaluhr
befinden sich drei weitere Anzeigen. Links die Monatsscheibe: Sie
besteht aus drei Abschnitten, die zunächst die Anzahl der Tage eines
Monats, dann ein Monatssymbol entsprechend der Jahreszeit und
schließlich den Monatsnamen selbst zeigen. inks und rechts neben der
Normaluhr zeigen sechs kleinere Nebenuhren eine Auswahl verschiedener
Erdzeiten. Sie werden durch jeweils eine Stadt mit ihren
charakteristischen Bauwerken repräsentiert. Über der eigentlichen
Weltzeituhr sind zwölf Bronzeglocken aufgehängt. Fünf Mal am Tag – um
12:00, 16:00, 17:00, 18:00 und 19:00 Uhr – ertönen zunächst der
Westminsterschlag und dann die jeweiligen Stundenschläge. Danach
erklingt jahreszeitlich wechselnd eine volkstümliche Melodie. Das obere
Drittel der Fassade wird bestimmt von dem steil emporstrebenden
Erkerhaus.
Weltzeituhr mit Glockenspiel an der Rothenburg

St.-Paulus-Dom - Mittelalterliche, romanische Kathedrale mit
bedeutender astronomischer Uhr, die gegen den Uhrzeigersinn läuft - am
Domplatz Münster
Die Kathedrale zu Münster geht auf eine Kirchengründung des Heiligen
Ludgerus aus dem Jahre 792/93 zurück. Ludgerus hat die Kirche dem
Völkerapostel Paulus geweiht. Von dieser Kirche aus wurde den Sachsen
das Evangelium verkündet und das kirchliche Leben geordnet; mit der
Bischofsweihe des Ludgerus in Köln im Jahre 805 wurde sie Mutterkirche
des neuen Bistums Münster. Der spätromanische Kirchenbau ist der dritte
an dieser Stelle und wurde im Jahre 1264 geweiht.

Im Zuge des Wiederaufbaus nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der
Alte Chor komplett zum Westquerschiff hin geöffnet. Neben dem bereits
im 18. Jahrhundert dort befindlichen Taufstein mit dem Taufbecken wurde
der barocke Hochaltar vor die neugestaltete, nunmehr geschlossene
Westwand des Alten Chores, unterhalb der neuen Rundfenster-Rosette
gesetzt.
Blick in den Alten Chor, mit barockem Hochaltar - Barocker Paulusaltar im Westchor

An das Westwerk mit dem Alten Chor, dem Westquerschiff und den Türmen
schließen sich nach Osten das Langhaus, das östliche Querschiff mit
Altarinsel unter der Vierung und der Chor an. Mit einer Gesamtlänge von
108,95 m und einer Breite des westlichen Querschiffes von 44,55 m und
des östlichen Querschiffes von 43,30 m beeindruckt das monumentale
Gotteshaus in seinem hellen Baumberger Sandstein als die größte der
westfälischen Kathedralen. Der Paulusdom ist ein spätromanischer Bau.
Der vordere Teil der Paradiesvorhalle, der Salvatorgiebel sowie die
Fenster des südlichen und nördlichen Seitenschiffes wurden später in
der Epoche der Gotik geschaffen.

Unter der Vierung befindet sich die Altarinsel, die ein wenig westlich
in das Langhaus hineinragt. Sie wurde 1956, zusammen mit dem Chor und
dem Chorhaupt, wo sich der Bischofssitz befindet, von dem Künstler Emil
Stephan (um)gestaltet. Der barocke Hochaltar wurde aus dem Chorhaupt
entfernt. Der heutige Hochaltar ist aus Sandstein gefertigt. Er enthält
Vitrinen, in denen Apostelstatuen des 14. Jahrhunderts aus dem
Reliquienschrein des ehemaligen barocken Hochaltars ausgestellt sind.
Die gesamte, an den Chorraum angrenzende Altarinsel ist durch eine
hölzerne Chorschranke zum Langhaus und durch die beiden Arme des
nördlichen Querhauses abgegrenzt.

In einem Joch zwischen Hochchor und (südlichem) Chorumgang befindet
sich eine astronomische Uhr mit Glockenspiel. Die Uhr aus den Jahren
1540 bis 1542 ist eine der bedeutendsten Monumentaluhren des
deutschsprachigen Raums. Sie zählt zur sogenannten „Familie der
hansischen Uhren“, von denen ansonsten nur noch die Uhren in Danzig,
Rostock, Stralsund und Stendal relativ original erhalten sind (die
Uhren von Lübeck und Wismar wurden 1942 bzw. 1945 zerstört). Sie weist
mit den Uhren dieser Uhrenfamilie eine Reihe von gemeinsamen
Charakteristika auf. Die Uhr ist zudem eine der wenigen noch
existierenden, entgegen dem Uhrzeigersinn drehenden öffentlichen
Großuhren.
Die Schauseite der Uhr weist, wie im Mittelalter nicht unüblich, eine
Dreiteilung auf. Die Dreiteilung in Kalenderteil (unten), Astrolabium
mit weiteren Anzeigen (Mitte) und einer großen Schautafel mit
Figurenumlauf (oben) versinnbildlicht eine Sicht auf die Vorstellungen
des Universums. Die beiden oberen Teile der Uhr sind in ein Bildkonzept
eingebunden, das nach den Himmelsrichtungen am Standort der Uhr im
Südlichen Chorumgang ausgerichtet ist. Im oberen Teil befindet sich
eine Bildtafel im Renaissance-Stil. Im mittleren Bereich der Uhr
befindet sich ein Astrolabium mit der „eigentlichen“ Uhr, das die
Mondphasen und Planetenstellungen anzeigt.
Im unteren Bereich befindet sich ein Kalendarium, das durch ein
spätgotisches Gitter geschützt ist. Es handelt sich dabei um einen
ewigen Kalender, der für die Jahre 1540 bis 2071 eingerichtet ist.
Durch diesen Zeitraum wird eine 532 Jahre umfassende, sogenannte
Dionysische Ära dargestellt, nach deren Ablauf alle Angaben über den
19-jährigen Mond- und 28-jährigen Sonnenzyklus wieder an demselben
Monats- und Wochentag eintreffen, wie im ersten Jahr der 532-jährigen
Periode (1540).

Im Nordarm des Ostquerhauses (Stephanus-Chor) befindet sich das
Grabmonument für den Fürstbischof Friedrich Christian von Plettenberg.
Es wurde erst nach dessen Tod am 5. Mai 1706 in den Jahren 1707–1708
errichtet und von dem Bildhauer Johann Mauritz Gröninger gestaltet. Das
Grabmonument besteht aus einer rückwärtigen Portikusarchitektur,
flankiert durch Figuren der Namenspatrone von Plettenbergs in
bischöflichem Ornat mit Mitra und Hirtenstab. Es handelt sich dabei um
die Bischofsgestalt des hl. Friedrich auf der linken Seite und die
Gestalt des Bischofs Christian. Im Zentrum des Monuments befindet sich
ein Sarkophagsockel, auf dem sich die Gestalt des Fürstbischofs
befindet. Über der Portikusarchitektur ist das von Putten begleitete
Fürstenwappen angebracht. An der Vorderseite des Sarkophages und der
Rückwand sind Titel und Würdigung Plettenbergs eingemeißelt.
Der Fürstbischof auf dem Sarkophag ist in halb sitzender, halb
liegender Position dargestellt, mit leicht emporgerichtetem Haupt. Zu
seinen Füßen steht ein Engel, der ein geöffnetes Buch hält.
Ursprünglich waren auf den Seiten des Buches die Worte „Diligite
iustitiam, qui iudicatis terram…“ („Liebet die Gerechtigkeit, die Ihr
auf Erden richtet“, Weish 1, 1) eingemeißelt. Hinter dem Kardinal steht
ein zweiter himmlischer Assistent, der die Insignien des Fürstbischofs
hält. Im oberen Bereich der rückwärtigen Marmorwand befindet sich eine
große Uhr. Sie wird von einem Spruchband mit den Worten „Consilio et
Constantia“ und seitlichen Tuchdraperien umrahmt. Die Uhr selbst wurde
von dem Uhrmacher Joachim Münnig geschaffen und von dem Maler Wolff
Henrich Schmorck bemalt. Das Monument besteht aus schwarzem und weißem
Marmor. Es stand zunächst im Hochchor, rückwändig zur Astronomischen
Uhr, mit deren Uhrwerk die Uhr des Grabmonuments verbunden werden
sollte. Heute befindet sich das Monument an der Westwand des nördlichen
Ostquerhausarmes.
Grabmal des Fürstbischofs Friedrich Christian von Plettenberg

An der Ostwand des Stephanuschores befindet sich ein Vortragskreuz aus
dem späten 14. Jahrhundert. Es wird als „Pestkreuz“ bezeichnet, weil
angenommen wird, dass sich die Pestnöte der Zeit um 1350 in der
Darstellung des leidvollen Gekreuzigten widerspiegeln. Das hölzerne
Kreuz und der vollplastisch gestaltete Körper des Gekreuzigten wurden
zusammengehörig geschaffen. Das Antlitz des Gekreuzigten ist vergrämt
und zeigt die Züge erlittenen Leids. Seine halbgeöffneten Augen sind
geschwollen, seine Wangen eingefallen, seine Lippen leicht geöffnet.
Der ausgemergelte Körper hängt aufrecht am Kreuz.
Stephanus-Altar

Das „Triumphkreuz“ ist ein monumentales Holzkruzifix, das über dem
Hauptaltar im Hochchor hängt. Es zeigt den Gekreuzigten als den zum
Gericht wiederkehrenden Erlöser, ähnlich dem auferstandenen Christus
gekleidet in eine lange, durch rillenförmige Parallelfalten
gegliederte, gegürtete Ärmeltunika. Die Christusgestalt ist in
hieratischer Symmetrie dargestellt. Kopf, Rumpf, Beine und Füße sind
vertikal gerichtet, die Arme waagerecht ausgebreitet. Die offenen
Handteller sind an das Kreuz genagelt. Die Füße stehen auf einem
Suppedaneum und sind nicht angenagelt.
Die Hauptorgel steht im Ostquerhaus (Johannischor). Das Pfeifenwerk
stammt weitgehend aus der Orgel, die 1956 von Hans Klais erbaut und in
einer Orgelnische über dem Kapitelsaal (T), seitlich des Stephanschores
(nördliches Querschiff) aufgestellt wurde. 1987 hat man das Instrument
abgebaut und mit geringfügig geänderter Disposition in einem neuen
Gehäuse vor dem Südfenster des östlichen Querschiffs aufgestellt. Die
Disposition wurde zuletzt im Jahre 2002 geringfügig geändert.
Blick auf die Orgel im südlichen Ost-Querhaus

Eine wichtige Persönlichkeit, die die Geschichte des Bistums
Münster prägte, war Clemens August Graf von Galen. Er wurde 1933
Bischof von Münster, trat während der Nazizeit ab 1934 für die Freiheit
der Kirche ein und klagte in seinen großen Predigten das
nationalsozialistische Regime an. Als Anerkennung für seine mutige
Haltung wurde er 1946 zum Kardinal ernannt. Er starb wenige Tage nach
seiner Ernennung am 22. März 1946 und wurde im Dom zu Münster
beigesetzt. Eine Porträtbüste aus dem Jahre 1951 und die Grabkapelle
mit Grabplatte erinnern noch heute an ihn. 2005 wurde Bischof Clemens
August Kardinal von Galen in Rom selig gesprochen.
Im Inneren des umschlossenen Kreuzganges befindet sich der Friedhof der
Domherren. Der Friedhof wird heute noch für Begräbnisse genutzt.

Die erste Domkirche wurde zur Zeit des Heiligen Liudger um 805
errichtet. Als erster Bischof von Münster verbreitete er das Evangelium
und stellte die erste Domkirche unter den Schutz des Apostels Paulus.
Die Lebensgeschichte des Apostels ist auf dem ehemaligen Hochaltar, der
von dem Bildhauer Gerhard Gröninger und dem Maler Adrian van den Bogart
um 1619/22 gestaltet wurde, zu sehen. Im Jahre 1225 wurde der
Grundstein für den heutigen, dritten Dom gelegt. Der vorherige Dom
wurde größtenteils abgerissen. Nur der Westbau mit den beiden Türmen
aus dem Jahre 1190 wurde in den Neubau einbezogen. Schon nach weniger
als 40 Jahren Bauzeit wurde am 30. September 1264 der neue Dom
eingeweiht.
Marienkapelle mit Gemmenkreuz, 2. Viertel des 13. Jh. und Epitaph des
Weihbischofs Johann Bischopinck (+1543), von Johann Brabender, 1537/43

Nördlich des Doms liegt der Kreuzgang, der durch die Türen der
nördlichen Querhausarme erreicht werden kann. Der Kreuzgang entstand in
den Jahren 1390–1395. Vom Kreuzgang aus erreicht man die Sakristei, die
Marienkapelle, die angebaute Domkammer und den Gartensaal.
Große Zerstörungen richteten 1534/35 die Täufer an. Diese Sekte, die in
Münster einen Gottesstaat gründen wollte, rief zu einem „Bildersturm”
auf. Einige beschädigte Bildnisse aus Sandstein, wie das der adeligen
Dame und die Epitaphien (Grabdenkmäler) im Kreuzgang, erinnern an jene
Zeit.

Nördlich des Doms, auf dem Horsteberg, an der Rückwand der Domkammer,
befindet sich seit 2004 eine neue bronzene Kreuzigungsgruppe, die von
dem Künstler Bert Gerresheim (Düsseldorf) geschaffen wurde. Anders als
bei üblichen Darstellungen des Golgatha-Geschehens finden sich unter
dem Kreuz nicht Darstellungen der Gottesmutter Maria und des Johannes,
sondern Gestalten der älteren und jüngeren Geschichte. Dargestellt sind
insbesondere die selige Anna Katharina Emmerick, die selige Schwester
Maria Euthymia und ihnen gegenüber Kardinal von Galen, der in seinen
Händen die Predigtaufzeichnungen „Wachrufe in einer politisch
gefährlichen Welt“ hält. Am Fuß des Kreuzes befindet sich ein Stein mit
dem Ordenssiegel des Karmels, als ein Verweis auf die heilige Edith
Stein. Zudem sieht man eine sitzende Figur, die den „König“ des
Täuferreichs von Münster Jan van Leiden darstellt, so wie zahlreiche
zerbrochene Zeichen und Embleme (u. a. das Hakenkreuz, den Judenstern,
das Hammer- und Sichel-Emblem des Weltkommunismus), die auf dunkle
Zeiten der Menschheitsgeschichte hinweisen sollen.

Kiepenkerl-Denkmal am Spiekerhof - Der Kiepenkerl ist die Darstellung
eines Kiepenkerls als bronzenes Denkmal in Münster (Westfalen).
Der Verschönerungsverein der Stadt Münster beauftragte Ende des 19.
Jahrhunderts den Bildhauer August Schmiemann zur Schaffung eines
Kiepenkerl-Denkmals. Für den Betrag von 2960 Mark schuf Schmiemann eine
1,75 m hohe Statue aus Gips mit Galvanoüberzug, die am 16. Oktober 1896
feierlich eingeweiht wurde. Es zeigt einen wandernden Handelsmann im
Münsterland mit seiner Rückentrage, der so genannten Kiepe, in
typischer Montur mit Leinenkittel, Halstuch, Mütze, Knotenstock und
Pfeife.

Buddenturm - Restaurierter, ca. 30 m hoher Wehrturm aus dem 12. Jh.,
der einst auch als Gefängnis, Wasser- und Pulverturm diente.

Büste Annette-von-Droste-Hülshoff
Annette von Droste-Hülshoff (1797-1848) war eine deutsche
Schriftstellerin und Komponistin. Unter den deutschsprachigen
Dichterinnen und Dichtern des 19. Jahrhunderts ist sie eine der
bedeutendsten.

Nicole Eisenman, Sketch for a Fountain [Skizze für einen Brunnen]
Das Werk der New Yorker Künstlerin Nicole Eisenman war Teil der
Skulptur Projekte 2017. Im September 2021 wurde es am alten Standort
dauerhaft installiert. Dass aus der provisorischen "Skizze" (sketch)
eine dauerhafte Installation wurde, ist dem Verein "Dein Brunnen für
Münster" zu verdanken, der über mehrere Jahre Spenden für Anschaffung
und Betrieb des Kunstwerks gesammelt hatte. Die fünf nackten Figuren
aus Gips und Bronze, die nicht eindeutig einem Geschlecht zuzuordnen
sind und sich zwanglos und entspannt um den Brunnen gruppieren, hatten
2017 viel Publikum angezogen – und es polarisiert.

Liebfrauen-Überwasserkirche - Restaurierte gotische Kirche aus dem 14.
Jahrhundert mit hohem Schiff, Bodenfliesen und einer Orgel.

Neben dem Paulusdom ist die Liebfrauen-Überwasser Kirche die älteste
Kirche der Stadt Münster. Grabungen haben ergeben, dass an diesem Ort
schon in der 2. Hälfte des 9. Jahrhunderts wahrscheinlich eine kleine
Kirche gestanden haben wird, da sich in unmittelbarer Nähe der heutigen
Kirche Grabstellen aus dieser Zeit nachweisen lassen.

Die Überwasserkirche, auch Liebfrauenkirche oder Liebfrauen-Überwasser
genannt, ist eine gotische Hallenkirche mit einem 64,5 Meter hohen Turm
in der westlichen Innenstadt von Münster in Westfalen. Ihr Name leitet
sich von „Über dem Wasser“ ab, da sie westlich des St.-Paulus-Doms auf
der gegenüberliegenden Seite der Aa liegt.

Die jetzige Kirche wurde seit dem Jahr 1340 errichtet, belegt durch
eine Inschrift über dem Westportal. Die Bauzeit des Turms zog sich von
1363 bis wahrscheinlich zum Beginn des 15. Jahrhunderts hin.

Am 20. Juli 1941 hielt der damalige Bischof von Münster, Clemens August
Graf von Galen, in der Überwasserkirche eine seiner berühmt gewordenen
Predigten gegen den Nationalsozialismus. Die Neugestaltung von
Buntglasfenstern im Chor und den Ostwänden der Seitenschiffe 1972–1975
übernahm der Glasmaler Valentin Peter Feuerstein.

Schwester-Laudeberta-Weg an der Münsterschen Aa
Benannt nach Schwester Laudeberta (1887-1971), eine Ordensschwester der
Clemensschwestern in Münster. Seit 1910 arbeitete sie als
Krankenschwester in der Provinzialheilanstalt Marienthal (heute
LWL-Klinik Münster).
In der NS-Zeit waren dort rund 1.000 Menschen mit Krankheiten und
Behinderungen untergebracht. Für die Nationalsozialisten galten diese
Menschen als „lebensunwert". Hitler selbst ordnete deshalb 1939 ihre
Ermordung im Rahmen der „Aktion T 4" an. Das war Massenmord per
Giftgas.
Im Juli 1941 erfuhr Schwester Laudeberta die Namen von Patienten, die
aus Marienthal in Tötungsanstalten deportiert werden sollten. Sofort
sprach sie Angehörige an und legte ihnen nahe, die Patienten nach Hause
zu holen. Parallel dazu informierte sie persönlich unter hohem Risiko
den münsterschen Bischof Clemens August Graf von Galen. Ins
Bischofspalais gelangte sie über den Weg entlang der Aa, der heute
ihren Namen trägt.
Für den Bischof war ihr Besuch ein entscheidender Anstoß zu seiner
berühmten Predigt vom 3. August 1941, die zum Stopp der Aktion T4
beitrug.

St. Petri, auch Petrikirche, ist eine katholische Kirche in Münster.
Als Kirche des ehemaligen Jesuitenkollegs ist die Petrikirche Keimzelle
der Universität Münster. Sie liegt unweit des Doms im
Universitäts-Gelände zwischen Fürstenberghaus, juristischer und
katholisch-theologischer Fakultät an der Aa und dient heute als Kirche
der Katholischen Studierenden- und Hochschulgemeinde Münster (KSHG)
sowie als Schulkirche des Gymnasiums Paulinum. Wegen der guten Akustik
gilt die Kirche als bevorzugter Raum für geistliche Konzerte; außerdem
wird die Petrikirche als Hochzeitskirche sehr geschätzt.

Die Petrikirche entstand zwischen 1590 und 1597 als Kirche des
Münsterschen Jesuitenkollegs. Sie war die erste Jesuitenkirche der
Rheinischen Ordensprovinz. Architekt und Bauleiter war Johann Roßkott.
Die Kirche ist der einzige Teil des Kollegs, der heute noch besteht.
...Und leider geschlossen.

Rudolf Breilmann: Johannes Nepomuk, 1993, Bronze - Münster, Altstadt, Aabrücke Bispinghof

Geomuseum der Universität Münster, Eintritt kostenfrei
Leider war ich erst 4 Minuten vor Schließung vor Ort. Schade.

Stadtmuseum Münster - Museum der Geschichte von Münster mit einzigartigen interaktiven Ausstellungen
Die Haager Landkriegsordnungen
sahen im Kriegsfall eine Weiterbezahlung des Solds der gefangenen
Soldaten ebenso wie eine Entlohnung für deren Arbeitseinsätze in der
Landwirtschaft, der Industrie oder in Zechen vor, so dass bankähnliche
Einrichtungen (Bankabteilungen) zur Verwaltung dieser enormen Summen
notwendig wurden.
1915 führte man auf Erlass des preußischen Kriegsministeriums eigene Geldscheine und Münzen in Form von sogenanntem Lagergeld
ein, die außerhalb der Lager keine Gültigkeit besaßen. Auf diese Weise
war den Gefangenen eine wichtige Grundlage zur Flucht, nämlich die
finanzielle Möglichkeit z. B. Eisenbahnfahrkarten oder Lebensmittel zu
erwerben, entzogen.
In den drei münsterischen Lagern gab es daher jeweils eigenes
Lagergeid, das an das übliche deutsche Währungssystem angepasst war. Es
gab Münzen aus Zink oder Eisen zu 1, 2, 5, 10 und 50 Pfennig sowie
Geldscheine zu 1, 2, 5 und 10 sowie im Lager II sogar zu 20 und 50
Mark. Die oft von Verwandten aus der Heimat in der jeweiligen
Landeswährung per Post oder Paket zugesendeten Geldmittel wurden
umgerechnet und umgetauscht. Bis zu 50 Mark durfte jeder Gefangene an
Bargeld je Monat erhalten oder bei Arbeitseinsätzen pro Tag 50 Pfennig
verdienen, der Rest wurde einem Konto gutgeschrieben. Dieses Geld
sollte nach der Entlassung wieder umgerechnet in die Landeswährung
ausgezahlt werden. In den Lagern gab es Kantinen, in denen z. B.
Lebensmittel, Tabak, Süßigkeiten, Schreibwaren, Seife und viele andere
Dinge erworben werden konnten. Nach der Auflösung der Lager Ende 1918
nahmen viele Gefangene Münzen oder Geldscheine zur Erinnerung an die
Lagerzeit mit nach Hause. Die Restbestände des Lagergeldes wurden aber
auch an Notgeldhändler und Sammler verkauft, so dass sie heute in
vielen Sammlungen vorhanden sind.

Modell der St. Lamberti-kirche um 1775
Münster, Lambertikirche am Prinzipalmarkt, Modell, M. 1:100; Münster 1998
Die Hauptpfarrkirche der Stadt ist als Marktpfarrkirche gegründet
worden. Urkundlich erwähnt wird St. Lamberti erstmals im Jahr 1190,
doch muss die Gründung der Pfarrei schon früher, spätestens im 11.
Jahrhundert erfolgt sein. Das Modell zeigt den Zustand der bestehenden
spätgotischen Hallenkirche mit dem alten, 1881 abgebrochenen Turm und
der eng bebauten mittelalterlichen Umgebung.

Altar- und Messstiftungen
Im Leben einer mittelalterlichen Stadt waren christliche Motive und
Intentionen in allen Aspekten des Alltags präsent. Dies galt für das
Individuum genauso wie für die städtische Gesellschaft insgesamt. Was
das mittelalterliche Weltbild vom heutigen grundlegend unterscheidet,
ist die besondere Sorge um die Zeit nach dem Tod, die in verschiedene
Formen der Jenseitsvorsorge umgesetzt wurde. Eine herausragende
Bedeutung nahmen dabei die Messe und das Gebet ein. Mit Hilfe von
Stiftungen verpflichtete der Wohltäter die Lebenden, zu seinem Gedenken
über den Tod hinaus zu beten und Messen abzuhalten, um seine
Leidenszeit im Fegefeuer zu verkürzen. Das Wort Messe (Lateinisch
„missa") dient in der Sprache der christlichen Liturgie seit dem 6.
Jahrhundert als Bezeichnung für die Eucharistiefeier. Basierend auf der
so genannten Römischen Messe hat sich im Laufe des Mittelalters die
Messe als zweiteiliger, in Latein gehaltener Gottesdienst ausgebildet,
bestehend aus Wortgottesdienst und Sakramentsteil. Letzterer umfasst
die Wandlung, die Opferung (Gabenbereitung) und gegebenenfalls die
Gläubigenkommunion. Im Sakramentsteil „wandelt" der Priester Brot und
Wein in Leib und Blut Christi.
Viel zahlreicher als die öffentlichen Messen waren im Mittelalter die
Privatmessen, die dem Seelenheil der Stifterin oder des Stifters nützen
sollten. Um eine Messe halten zu können, waren ein Altar - damit war
der Tisch gemeint, auf dem die Messe zelebriert wurde und das
Altargerät liturgische Bücher und Gewandung, Kelch usw. - notwendig.
Man benötigte einen Priester, der für seine Dienste mit einer Pfründe
entlohnt werden musste. Darüber hinaus war im Spätmittelalter die
Ausstattung des Altars mit einem Retabel Altaraufsatz üblich geworden,
so dass von dem Stifter eines funktionierenden neuen Altars oder sogar
einer gesamten Kapelle eine überaus große Summe aufgebracht werden
musste. Aber sogar die Stiftung von Seelenmessen und einzelnen
liturgischen Geräten konnte sich nur eine Minderheit leisten. Diese
umfangreiche Stiftertätigkeit führte zu einer Förderung der Handwerke.
Es entstanden großformatige Flügelaltäre; das Goldschmiedehandwerk
blühte, und aufwändige Textilien wurden zu liturgischen Gewändern und
Altartüchern verarbeitet.
Altarflügel mit Marien- und Passionsszenen
Öl/Tempera auf Eichenholz von Jan Baegert, 1505-1510, (14 von 16 Tafeln) Stadtmuseum Münster
Diese aus dem Clemenshospital in den Besitz der Stadt gelangten beiden
Flügel eines großen Altarauf-satzes stammen von dem Maler Jan Baegert
aus Wesel. Baegert hat auch für westfälische Auftraggeber gearbeitet.
Der Mittelteil des Flügelaltares ist verschollen. Im geschlossenen
Zustand sieht man den Marienzyklus, der auf dem ersten Bild „Geburt
Mariens" auch die Stifterin - eine Benediktinerin - mit Kerze zeigt.

Reformation in Münster
1525 kam es vor dem Hintergrund des Bauernkrieges in vielen Städten zu
Unruhen. Auch in Münster wurde Kritik an der Geistlichkeit laut. Die
ersten evangelischen Prediger, die in dieser Zeit in der Stadt
aufgetreten waren, wurden bald wieder vertrieben. Im Jahre 1530 begann
Bernhard Rothmann als Kaplan an der Mauritzkirche vor den Toren
Münsters, gegen die Missbräuche der päpstlichen Kirche und im Sinne
lutherischer Lehren zu predigen. Er fand viele Zuhörer. Im Februar 1532
erzwangen seine Anhänger seine Einsetzung als Prediger an St. Lamberti,
der Hauptpfarrkirche der Stadt. Die Bürgerschaft wandte sich mit einer
Bittschrift an den Rat: Man habe Bernhard Rothmanns Lehre als richtig
erkannt und fordere um des Seelenheils willen Freiheit von der
Bevormundung in Glaubensdingen. Die Obrigkeit müsse dafür Sorge tragen,
dass in Münster an allen Pfarrkirchen in der neuen Lehre unterwiesen
werde. Im Sommer gab der Rat dem Drängen der Bürgerschaft nach.
Ab Oktober versuchte der seit Juni amtierende Bischof Franz von
Waldeck, die Rücknahme der Reformation mit wirtschaftlichen
Repressalien zu erreichen. Landgraf Philipp von Hessen, einer der
politischen Führer der Protestanten im Reich, wurde um Vermittlung
gebeten. Den von ihm gesandten Räten gelang ein Kompromiss. Im
„Dülmener Vertrag" vom Februar 1533 gestand der Bischof die
evangelische Predigt in allen Pfarrkirchen der Stadt zu. Der Dom blieb
katholisch. Eine im Zusammenhang des Vertrages geforderte
Kirchenordnung für Münster wurde schließlich von dem hessischen
Theologen Dietrich Fabricius verfasst, da Rothmann sich unterdessen
theologisch von der Kindertaufe distanziert hatte und seine
Abendmahlsauffassung nicht mehr der allgemein verbreiteten
protestantischen Lehrmeinung entsprach. Der Rat aber wollte für Münster
nur reichsrechtlich anerkannte Bestimmungen. Die Kirchenordnung wurde
zwar von großen Teilen der Bürgerschaft angenommen, aber nicht
gedruckt. Stattdessen gab der Rat eine „Zuchtordnung" heraus, um die
Bürger auf ein Leben nach den Geboten Gottes zu verpflichten. Schmähung
der Kindertaufe und Verunglimpfung des Abendmahls wurden mit Strafe
bedroht. Auf dem Titelblatt dokumentierte die Zuchtordnung" mit dem
Stadtwappen und dem protestantischen Motto „VD MIE": Münster ist
evangelisch.

Beginn der Täuferherrschaft
Anfang 1534 begann die Erwachsenentaufe in Münster. Bei der Ratswahl am
23. Februar wurden ausschließlich Täufer und ihnen wohlgesonnene Bürger
gewählt und somit ihre Herrschaft besiegelt. Bereits im März begann die
Belagerung durch Bischof Franz von Waldeck. Der holländische
Täuferführer Jan Matthijs kam mit zahlreichen Anhängern in das in
Münster entstehende „Neue Jerusalem", in dem die Wiederkunft Christi -
u.a. angekündigt durch Himmelserscheinungen - in naher Zukunft erwartet
wurde. Alle Taufunwilligen wurden der Stadt verwiesen, und die
Pflichttaufe wurde eingeführt. In den Kirchen und Klöstern kam es zu
einem Bildersturm, das Ratsarchiv wurde vernichtet und die
Geldwirtschaft abgeschafft. Nach dem Tode Matthijs' setzte Jan van
Leiden als neuer Prophet die Ratsverfassung außer Kraft, ernannte einen
Rat der zwölf Ältesten und führte die Vielfrauenehe ein. Unter seiner
Führung gelang die Abwehr der anstürmenden Truppen des Bischofs.
Das Königreich der Täufer
Anfang September 1534 wurde Jan van Leiden zum König ausgerufen und
umgab sich mit einem prunkvollen Hofstaat. In seinem Selbstverständnis
war er König der gesamten Welt und bereitete die Herrschaft Christi auf
Erden vor. Nach und nach heiratete Jan van Leiden neben der Königin
Diewer von Haarlem 15 Nebenfrauen. Der Belagerungsring um die Stadt
wurde seit Februar 1535 immer enger, Hunger breitete sich aus. Mit der
Eroberung Münsters endete die Täuferherrschaft am 25. Juni 1535. Unter
den etwa 650 Toten auf Seiten der Täufer waren zahlreiche Anführer,
Bernhard Rothmann hingegen gelang die Flucht. Die wichtigsten
Gefangenen, Jan van Leiden, Bernd Knipperdollinck und Bernd Krechtinck,
wurden mehrfach verhört und zum Tode verurteilt. Die Hinrichtung fand
am 22. Januar 1536 auf dem Prinzipalmarkt statt. Die Leichname wurden
zur ewigen Abschreckung in drei eisernen Körben am Turm der
Lambertikirche aufgehängt. Nach der Eroberung enteignete Bischof Franz
von Waldeck allen täuferischen Besitz, der Stadt wurden zahlreiche
Rechte aberkannt und die Gilden aufgelöst. Im Jahr 1541 erhielt Münster
vom Bischof zunächst einige Rechte zurück, die vollständige Restitution
aller Stadtrechte, die Zulassung der Gilden und freier Ratswahlen,
erfolgte 1553.
Jan van Leiden (1509-1536)
Heliogravüre von Erhard Schmidt, 1982, nach dem Kupferstich von
Heinrich Aldegrever, 1536, aus dem Besitz des Stadtmuseums Münster
Staatsrobe, Ringe und Ketten sollen auf den königlichen Rang hinweisen,
der Wahlspruch unten auf seine Überlegenheit gegenüber Erb- und
Wahlfürsten. Buch und Schriftrolle sind Zeichen des Prophetenamtes. Der
Widerspruch zwischen dem Anspruch auf irdische Allmacht und der
bevorstehenden Hinrichtung des Königs macht die Unterschrift deutlich:
„Ich war es nur kurze Zeit."

Bernd Knipperdollinck (um 1490-1536)
Heliogravüre von Erhard Schmidt, 1982, nach dem Kupferstich von
Heinrich Aldegrever, 1536, aus dem Besitz des Stadtmuseums Münster
Als Pendant zu dem Stich des Königs Jan van Leiden schuf Heinrich
Aldegrever 1536 auch das Porträt des Bürgermeisters, „Statthalters" und
„Schwertträgers" der Täufer. Die Angabe, dass Knipperdollinck einer der
im Mai 1535 ernannten zwölf Herzöge gewesen sein soll, ist historisch
falsch. In der rechten oberen Ecke des Blattes erscheint sein Wappen.
Es zeigt in einem Lorbeerkranz eine Hand mit einem Schwert, die aus
einer Wolke hervorragt.

Königskette des Jan van Leiden
Halskette mit einem goldenen Abschlag eines Taler der Täufer unter der
Königsherrschaft des Jan van Leiden, Gold, 16. Jahrhundert Leihgabe aus
Privatbesitz
Bei dieser goldenen Kette soll es sich um jene aus dem Besitz des
Königs Jan van Leiden handeln. Da es sich bei dem Anhänger tatsächlich
um einen goldenen Abschlag von den Originalstempeln aus der Täuferzeit
handelt, ist dies möglich, jedoch nicht einwandfrei zu beweisen. Die
Stempel wurden auch nach der Eroberung der Stadt zur Prägung von
Andenkenmünzen verwendet.

Hinrichtung der Anführer der Täufer
Reproduktion einer Federzeichnung aus der Handschrift von G. Berger,
Contrafractur der Osnabrügkshen Biscöffe, Osnabrück 1607 Original:
Kulturgeschichtliches Museum, Osnabrück
Nach Gefangennahme und Verhören wurden Jan van Leiden, Bernd
Knipperdollinck und Bernd Krechtinck am 6. Januar 1536 zum Tode
verurteilt. Als Aufrührer wurden ihnen nach dem geltenden Strafrecht
mit glühenden Zangen Fleischstücke vom Körper gerissen, bevor sie
erdolcht wurden. Das Urteil wurde am 22. Januar 1536 auf dem
Prinzipalmarkt öffentlich vollstreckt.
Folterzangen
Eisen, 1. Drittel 16. Jahrhundert Stadtmuseum Münster
Am 22. Januar 1536 wurden die drei Täuferanführer auf dem
Prinzipalmarkt mit glühenden Zangen gefoltert und durch einen Dolchstoß
getötet. Es dürfte sich bei den ausgestellten Zangen um die Originale
handeln, da ihr Überlieferungsweg über die Jahrhunderte hinweg
nachvollzogen werden kann. Sie hingen bis etwa 1848 zur Abschreckung
und Erinnerung an die Ereignisse 1535/1536 am Rathaus.

Drei eiserne Körbe
Eisen, Nachbildungen der 1535 entstandenen Originale, angefertigt 1888 Stadtmuseum Münster
Nach der Hinrichtung wurden die Leichen der drei Anführer der Täufer in
eisernen Körben festgebunden und zur Abschreckung am Turm der
Lambertikirche, auf der Seite zum Prinzipalmarkt hin, aufgehängt. Die
Leichen wurden nie bestattet. Noch heute befinden sich dort die
Originalkörbe. Die ursprünglich als Ersatz 1888 angefertigten Kopien
kaufte der Zoogründer Prof. Dr. Hermann Landois und hängte sie neben
seinem Haus im Zoo auf. Nach dem Umzug des Zoos 1977 gelangten die
Körbe 1982 als Geschenk an das Stadtmuseum Münster.

Die Hängung der drei Körbe an der Lambertikirche 1536
Titelseite der Flugschrift „Des Münsterischen Königreichs und Widertauf
an und abgang...", Buchdruck, ohne Ort (Augsburg), ohne Jahr (1536)
Original: Stadtmuseum Münster
Unmittelbar nach der Hinrichtung der drei Anführer der Täufer entstand
diese illustrierte Flugschrift. Der Holzschnitt auf der Titelseite
zeigt die alte Hängung der drei Körbe am Turm der Lambertikirche mit
den festgebundenen Leichnamen. Der Korb mit dem König Jan van Leiden in
der Mitte hängt etwas höher als die seiner beiden Mitstreiter,
angeblich auf eigenen Wunsch.

Die Täufer im Spiegel der Nachwelt
Schon ihre Zeitgenossen hatten großes Interesse an den in Münster
wütenden „Wiedertäufern". Reale oder vermeintliche Hinterlassenschaften
ihrer Herrschaft waren als Souvenirs begehrt. Von den bei der Eroberung
der Stadt 1535 erbeuteten Münzstempeln der täuferischen Taler wurden
über Jahrzehnte hinweg immer wieder neue Abschläge produziert. Als die
alten Stempel verbraucht waren, wurden neue gefertigt und die geprägten
Münzen als Andenken und Sammlerstücke verkauft. Auch das Porträt des
Königs der Täufer zierte zahlreiche Erinnerungsmedaillen. Die Bildnisse
Jan van Leidens und Bernd Knipperdollincks wurden vielfach
nachgestochen und „abgekupfert", ihre Porträts erschienen sogar auf
Kacheln und Fliesen. Bücher zur Geschichte der Täufer fanden über die
Jahrhunderte in vielen Sprachen reißenden Absatz. Oft waren sie mit
erdachten Illustrationen zu den Ereignissen in Münster versehen. Im 19.
Jahrhundert entstanden große Historiengemälde, die vielfach als
Reproduktionen verbreitet wurden.
Schon seit dem 16. Jahrhundert wurden Romane verfasst, welche die
Ereignisse rund um die Täuferherrschaft in Münster thematisierten. Bis
in die Gegenwart sind über 80 derartige Bücher erschienen. Es folgten
Theaterstücke und Opern und schließlich sogar ein zweiteiliger
Fernsehfilm. Die Stadt Münster selbst hatte lange ein zwiespältiges
Verhältnis zur Herrschaft der Täufer. Einerseits wollte man nicht an
die „unrühmliche" Geschichte erinnert werden, andererseits erkannte man
zu Beginn des 20. Jahrhunderts, dass sich die Täuferepisode
werbewirksam für den Tourismus vermarkten ließ. In der
Wiedertäuferstadt" wurden 1921 offiziell Notgeldscheine mit den
Bildnissen der Täufer ausgegeben. Außerdem konnte man
Wiedertäuferschokolade" oder „Wiedertäuferschnaps" erwerben. Eine
damals neu gegründete Karnevalsgesellschaft nannte sich
„Fastnachstkumpanei Die Wiedertäufer am Buddenturm".
Schankgefäße zum Thema Täufer in Münster
Drei Krüge für „Wiederdäuper-Water"
Feinsteinzeug, Stöpsel mit den Köpfen von Jan van Leiden, Bernd
Krechting und Bernd Knipperdollinck, Entwurf Hermann Kissenkötter,
Münster, 1930, Ausführung ab 1931 für die Brennerei Lördemann, Münster,
durch die Kunststeinzeugfabrik Dümler & Breiden, Höhr Leihgabe aus
Privatbesitz
Kanne „Wiedertäufer am Buddenturm"
Irdenware, herausgegeben von der Fastnachstkumpanei „Die Wiedertäufer
am Buddenturm", Töpferei Schäfer, Telgte, um 2000 Stadtmuseum Münster
Kacheln und Fliesen zum Thema Täufer in Münster
Kachel mit dem Porträt des Jan van Leiden
Blattkachel, Irdenware, glasiert, um 1550/1560 Stadtmuseum Münster
Drei Fliesen
Fayence, mit dem Porträt des Jan van Leiden, dem Wappen des Jan van
Leiden und dem Porträt des Bernd Knipperdol-linck, gefertigt 2000 nach
Vorbildern aus dem 17. Jahrhundert Stadtmuseum Münster

Münsteranerin mit „Felken"
Figurine, Nachbildung einer Tracht aus der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts, Ausführung 1998 Stadtmuseum Münster
Diese Tracht einer münsterischen Bürgerin wurde nach einer Zeichnung
von Wenzel Hollar aus den Jahren um 1634 rekonstruiert.
Charakteristisch ist neben der Samtjacke, dem weiten Rock und dem
spitzenbesetzten großen Kragen die „Feileken" genannte ungewöhnliche
Haube, die sowohl dem Sonnen- als auch dem Regenschutz dienen konnte.
Die Bezeichnung leitet sich als Verkleinerungsform vom dem
mittelniederdeutschen Wort „feyle" (auch falie, felie, vele, veile) ab,
das einen Mantel oder Schleier bezeichnet und sich als „Kopfmäntelchen"
übersetzen lässt.

Der Maler Johann Bockhorst
Nur wenige Quellen liefern gesicherte Daten über Leben und Werk von
Johann Bockhorst. Um 1604 geboren, besuchte er das von Jesuiten
geführte Gymnasium Paulinum in Münster. Um 1626 ging er nach Antwerpen
- einem Zentrum der europäischen Barockmalerei -, um Maler zu werden.
Als Schüler von Jacob Jordaens kam er in engen Kontakt zu Peter Paul
Rubens und Anton van Dyck. 1633/1634 wurde er in die Malergilde von
Antwerpen aufgenommen. Auch in seiner Heimatstadt Münster unterhielt
Johann Bockhorst ein Atelier und fertigte mehrere noch heute erhaltene
Altarbilder für münsterische Kirchen an wie etwa das für die
Martinikirche. 1668 starb Johann Bockhorst in Antwerpen als bedeutender
und geschätzter Maler. Bockhorsts Malweise, Bildkomposition und
-inhalte sind stark von Rubens und van Dyck geprägt. Vor wenigen Jahren
noch weitgehend unbekannt, gilt Johann Bockhorst heute als ein
führender Vertreter der flämischen Barockmalerei.
Apollon als Gott von Delphi
Gemälde von Johann Bockhorst, Öl auf Leinwand, unsigniert und undatiert, um 1660/1668 Stadtmuseum Münster
In der Mitte des Bildes steht die Priesterin Apollons, die Pythia, mit
erhobenen Armen. Sie steht vor der Statue des Gottes Apollon, der in
seiner Linken die Lyra, in seiner Rechten den Bogen hält. Hinter ihm
sitzt ein Greif, mit Flügeln, Vogelkopf und dem Körper eines Hundes. Es
sind antike Attribute Apollons. Für das Verständnis des Gemäldes ist
wesentlich, dass es durchgehend spiegelbildlich angelegt ist, da es als
Vorlage für einen Wandteppich dienen sollte. Am auffälligsten ist die
spiegelbildliche Inschrift am Altar.

Die Messe des Hl. Martinus
Gemälde, Öl auf Leinwand, von Johann Bockhorst, um 1654, unsigniert und undatiert Kirchengemeinde St. Martini, Münster
Der Legende nach gab der Hl. Martinus auf dem Weg in seine
Bischofskirche einem Bettler sein Untergewand. Als er danach die Messe
zelebrierte, sahen die Anwesenden über seinem Haupt die Erscheinung
einer feurigen Kugel, die man als göttliches Zeichen deutete. Diese
Legende hat Johann Bockhorst auf dem Altargemälde des früheren
Hochaltars von St. Martini in Münster dargestellt. Der Maler hat sich
vermutlich in dem Kleriker am rechten Bildrand selbst porträtiert.

Arithmetica
Gemälde von Johann Bockhorst, Öl auf Leinwand, unsigniert und undatiert, um 1655 Stadtmuseum Münste
Arithmetica ist hervorgehoben durch ihren leuchtend goldgelben Rock und
ihr durchscheinendes weißes Schultertuch. Sie betrachtet eine
Schiefertafel mit arabischen Ziffern, die sie in ihrer Rechten hält.
Neben ihr ist vermutlich Diophantos von Alexandria dargestellt, der im
3. Jahrhundert n. Chr. ein Lehrbuch der Mathematik schrieb, das bis in
die Neuzeit maßgeblich war. Er deutet auf die 3, weil Arithmetica zur
Dreiergruppe der Sieben Freien Künste, dem Trivium, gehört.

Grammatica
Gemälde von Johann Bockhorst, Öl auf Leinwand, unsigniert und undatiert, um 1655 Stadtmuseum Münster
Die Greisin Grammatica sitzt auf einem Lehrstuhl. Neben ihr sieht man
die Göttin Athena, die hier die Wissenschaft verkörpert. Sie trägt als
Attribut ihren Helm, bekrönt vom goldenen Pegasus. Vor den beiden steht
ein Knabe, der von dem Blatt das in römischen Großbuchstaben
dargestellte ABC liest. In der Darstellung der Henne und ihrer Küken,
die sich unter dem Sessel der Grammatica niedergelassen haben,
wiederholt sich das Bild von Grammatica und dem Knaben.

Rhetorica
Gemälde von Johann Bockhorst, Öl auf Leinwand, unsigniert und undatiert, um 1655 Stadtmuseum Münster
Rhetorica in Frauengestalt thront vor einem Säulenporticus, der von
einem Kreuzgratgewölbe überwölbt ist. Bei dem Gebäude handelt es sich
um eine Laube, etwa eine Gerichtslaube, wie sie auf antiken Foren
anzutreffen waren. Rhetorica hat ihren Mund zur Rede geöffnet, ihre
Rechte ist im Rednergestus ausgestreckt und geöffnet. In ihrer Linken
hält sie das Schwert, Zeichen der Rechtsprechung, bzw. den Caduceus
oder Hermesstab, das Zeichen des Gottes Hermes als Musenführer.

Die Schrecken und der Jammer des Krieges
Die Menschen in den Städten und auf dem Land litten an den Morden,
Plünderungen und Übergriffen durch Truppen und Trupps egal welcher
Kriegspartei oder Konfession. Die Kontrolle und Disziplinierung der
Soldaten wurden durch das System der Eintreibung von Naturalien und
Geld in den besetzten Gebieten sowie die Verteilung der Truppenteile
auf die Winterquartiere erschwert. Auch wenn Heerführer sich bemühten,
die Disziplin der Soldaten aufrechtzuerhalten und Marodeure durch harte
Bestrafung abzuschrecken, blieb die Gefährdung von Leben und Besitz der
Menschen in den von den Truppen heimgesuchten Gebieten immer bestehen.
Das Maß der Verwüstung nahm ab 1635 deutlich zu, als die Kriegsführung
jegliche geregelten Bahnen verließ. Die Zahl der Marodeure, die sich
ganz von ihrer Truppe absetzten und zu Banden zusammenschlossen,
erhöhte sich in den letzten Kriegsjahren immer mehr. Aufgrund
ausbleibenden Solds oder geringer Versorgung mit Lebensmitteln, aber
auch aus reiner Habgier, Zerstörungswut und Mordlust wurden Dörfer
überfallen, Häuser geplündert und gebrandschatzt, Viehherden
weggetrieben, Männer mit grausamer Folter zum Verrat von Geldverstecken
gezwungen und Frauen vergewaltigt.
Zu den Opfern unmittelbarer Gewalttaten durch Söldner kam noch eine
erheblich höhere Zahl von Toten durch Seuchen und Hunger hinzu. Vor
allem die Pest und die Verwüstung ganzer Landstriche führten als
direkte Auswirkungen des Krieges zu hohen Verlusten innerhalb der
Bevölkerung. Man schätzt, dass sich die Bevölkerung in Deutschland
durch den Krieg um 1650 etwa um ein Drittel verringert hatte. Bei
näherer Betrachtung einzelner Regionen ergibt sich dabei ein recht
unterschiedliches Bild: Die am meisten betroffenen Gebiete lagen
entlang einer „Zerstörungsdiagonale" von Nordosten nach Südwesten.
Münster wurde von Zerstörung und Plünderung vollständig verschont,
wodurch es sich als Hauptverhandlungsort des Friedenskongresses empfahl.
30-jähriger Krieg und Friedenskongress
Politische und konfessionelle Auseinandersetzungen überlagerten sich
bei Ausbruch des 30-jährigen Krieges im Jahr 1618. Zunächst auf das
Reich beschränkt, weitete sich der Krieg schnell aus: Die Erfolge der
katholischen Seite unter Führung von Kaiser Ferdinand II. wie etwa bei
der Schlacht von Stadtlohn bewirkten nacheinander das Eingreifen
Dänemarks (1624), Schwedens (1630) und Frankreichs (1635) zugunsten der
Protestanten. Die Heere der Kriegsparteien versorgten sich aus dem
besetzten Land nach der Devise, dass der Krieg den Krieg ernähren soll.
Zudem kämpften Marodeure, herrenlose Soldaten, auf eigene Rechnung. Dem
Krieg folgten Hunger und Seuchen. 1636/1637 begannen erste
Verhandlungen zur Beendigung des Krieges. 1643/1644 trat in Münster und
Osnabrück der Friedenskongress zusammen. Münster, vom Krieg fast
verschont, wurde für die Dauer des Kongresses für neutral erklärt.
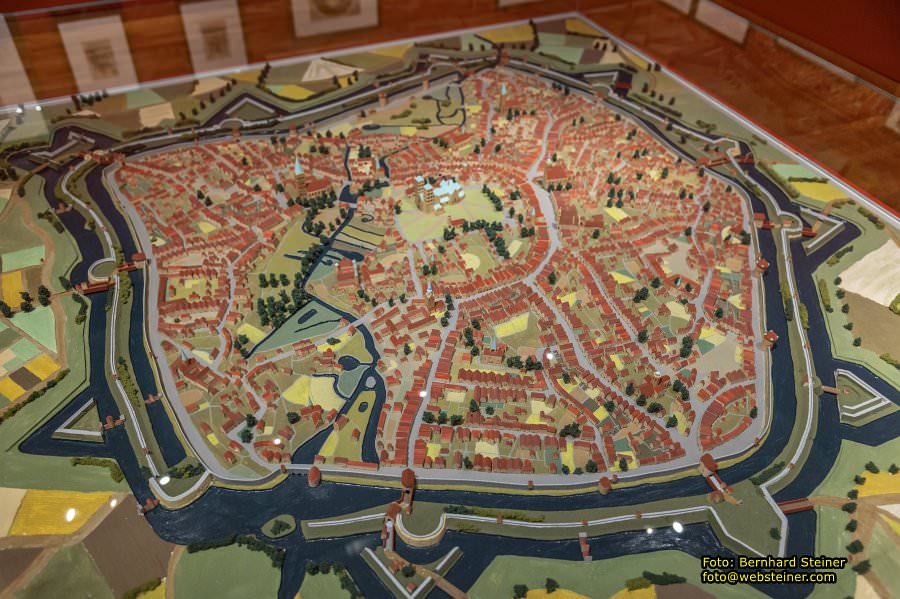
Der Westfälische Frieden
Seit 1643 tagten die Gesandten aus über 150 europäischen Staaten und
Territorien des Reiches in Münster. Zu den Friedensverhandlungen
erschienen auch bedeutende Porträtmaler wie Anselm van Hulle und Gerard
Ter Borch in Münster, die die Diplomaten und wichtige Ereignisse in
Gemälden darstellten. Nach fünfjährigen Verhandlungen wurden die
Verträge 1648 unterzeichnet. Schweden und Frankreich, an einer
Schwächung des Kaisers interessiert, erzwangen die Beschränkung der
kaiserlichen und die Ausweitung der landesfürstlichen Gewalt im Reich
sowie die rechtliche Gleichstellung der Konfessionen. Die Schweiz und
die Niederlande erhielten die Anerkennung ihrer staatlichen
Souveränität. 1649/1650 wurde in Nürnberg die Ausführung der
Friedensbestimmungen geregelt. Nach der langen Kriegszeit war die
Freude über den Frieden groß.
Modell der Stadt Münster 1678
Gips und Holz, 1:1000, Stadtmuseum Münster
Unmittelbar nach der Einnahme Münsters 1661 begann Christoph Bernhard
von Galen im Westen der Stadt mit dem Bau einer modernen Zitadelle, der
„Paulusburg", mit der er ein deutliches Zeichen für die Beendigung des
Selbstständigkeitsstrebens der Stadt setzte. Die Zitadelle sollte
einerseits die Herrschaft des Fürstbischofs in der Stadt sichern,
andererseits Münster auch für auswärtige Feinde uneinnehmbar machen.
Ähnliche Festungen entstanden in Coesfeld ab 1655 und in Vechta ab 1667
gegen die Niederlande, Dänemark und Schweden.

Doppelbureau
Hochpoliertes Furnier aus verschiedenen Hölzern auf Korpus aus
Eichenholz, Kanten und Füße mit Messingdekor, von dem Ebenisten
Tillmans, um 1760/1761 (fertiggestellt 1768?), Stadtmuseum Münster
Das kostbar ausgestattete, überaus seltene Möbelstück ist ein
Schreibtisch für zwei Personen. Es wurde 1760/1761 für einen
rheinischen Prälaten gearbeitet und ist ein Beleg dafür, wie der Bonner
Hof des Kurfürsten Clemens August die kunsthandwerkliche Produktion in
seinen Landen beflügelte und hohe Qualitätsstandards setzte.



Kamin- oder Tischuhr aus dem Palais auf der Engelenschanze
Holzkorpus, vergoldet, mit 14-Tage-Schlagwerk, Wien, um 1780/1790 Stadtmuseum Münster
Die mit antikischen Säulen, Vasen, Lanzettblattfriesen und Ranken
ausgestattete Uhr ist ein schönes Beispiel für frühklassizistische
Formensprache. Der Sonnengott Apollo hinter dem Pendel symbolisiert den
Tag, der schlafende Putto die Nacht.

Kaiser Wilhelm II. (1859-1941, reg. 1888-1918)
Gemälde, Öl auf Leinwand, von Th. Klaas, 1905, signiert und datiert, im Originalrahmen, Stadtmuseum Münster
Für das Dienstzimmer des Oberbürgermeisters im neuen Stadthaus stiftete
der münsterische Kaufmann und Mäzen Joseph Hötte 1905 dieses Bildnis
des Kaisers. Zu dieser Zeit hatte sich das durch den Kulturkampf
belastete Verhältnis zwischen dem preußischen Herrscherhaus und den
katholischen Bevölkerung entspannt. 1902 gestattete der Kaiser die
Gründung einer westfälischen Landesuniversität in Münster.

Annette von Droste-Hülshoff - Zwischen Fügsamkeit und Selbstverwirklichung
Annette von Droste-Hülshoff wurde am 12. Januar 1797 auf Burg Hülshoff
bei Münster geboren. Nach dem Tod des Vaters 1826 lebte sie mit ihrer
Mutter und der Schwester Jenny auf Haus Rüschhaus. Erst als 41-Jährige
wagte sie es 1838 zum ersten Mal, Gedichte zu veröffentlichen. Das Buch
hatte keinen Erfolg. Vor allem von der Familie und in Adelskreisen
wurde es abgelehnt. In dieser Zeit begann ihre enge Freundschaft mit
dem 17 Jahre jüngeren Levin Schücking, der sie in ihrer Arbeit
bestärkte. Als sie im Winter 1841/1842 mit ihm bei ihrer Schwester in
Meersburg am Bodensee weilte, entstanden innerhalb kurzer Zeit viele
ihrer bekanntesten Gedichte. Schücking kümmerte sich auch um die
Veröffentlichung ihrer Werke in dem renommierten Stuttgarter Cotta
Verlag. Hier erschien 1842 die Erzählung „Die Judenbuche", die den
Erfolg der Dichterin begründete. Der zweite Gedichtband der Droste,
1844 ebenfalls bei Cotta erschienen, fand in der literarischen Welt
Beachtung. Die letzten Jahre der Dichterin waren von Krankheit
überschattet. Sie starb am 24. Mai 1848 in Meersburg. Die
Verpflichtungen, die ihr durch Familie und Gesellschaft auferlegt
waren, hat sie immer selbstverständlich auf sich genommen. Ihre
schriftstellerische Arbeit betrieb sie daneben beharrlich, auch wenn
sie sich die Zeit dafür manchmal erlisten und ertrotzen musste.

Münster und Preußen
Durch den Wiener Kongress erhielt Preußen 1815 endgültig Münster und
große Teile des ehemaligen Fürstbistums zugesprochen. 1816 wurde
Münster Hauptstadt der preußischen Provinz Westfalen und damit Sitz
zahlreicher Behörden sowie eines Korpskommandos. Da die führenden
Posten jedoch von auswärtigen Personen, meist Protestanten, eingenommen
wurden, empfand man die preußische Verwaltung als Fremdherrschaft. Das
Streben der Kirche, Einfluss und Unabhängigkeit zu behaupten, führte
1837 zum ersten schweren Konflikt zwischen Kirche und Staat. Die
münsterischen Bürger stellten sich auf die Seite der Kirche in
Opposition zum Staat. 1848 wählten sie den Bischof zum Abgeordneten in
der Frankfurter Nationalversammlung. Im „Kulturkampf" des preußischen
Staates gegen die katholische Kirche (1871-1884) war Münster eine
Hochburg der Zentrumspartei. Erst das Anwachsen der Bevölkerungszahl
und die wirtschaftliche Blüte Münsters ab 1890/1900 milderten die
Distanz zu Preußen. Bei seinem ersten Besuch in Münster wurde der König
von Preußen und Deutsche Kaiser Wilhelm II. 1907 begeistert begrüßt.
Modell der Stadt Münster 1839
Holz und Gips, angefertigt durch die Firma Janka, Ulm, 1984, Maßstab 1:1000, Stadtmuseum Münster
Das Modell zeigt die Stadt Münster im Jahre 1839. Mit gut 18.000 Einwohnern war Münster die größte Stadt der Provinz Westfalen.

Kunst des 19. Jahrhunderts
Entscheidend für die Entwicklung der Kunst im 19. Jahrhundert waren
nicht mehr allein die einzelnen Künstler. Staatliche Lenkung und
bürgerliche Initiative nahmen zunehmend Einfluss auf die künstlerische
Tätigkeit. Stilprägend waren die Akademien, für die münsterischen Maler
vor allem die Düsseldorfer Malerschule. Die Düsseldorfer Akademie
besuchten die münsterischen Landschaftsmaler Alexander Michelis
(1823-1868), Heinrich Deiters (1840-1916) und Otto Modersohn
(1865-1943). Bernhard Pankok (1872-1943) war wie Fritz Grotemeyer
(1864-1947) auch Schüler in Berlin. Überregionale Bedeutung erlangten
vor allem Otto Modersohn und Bernhard Pankok. Sie hielten am Ende des
19. Jahrhunderts die Landschaft in der Umgebung von Münster in Gemälden
fest, die eine Verbindung von Realismus und Impressionismus zeigen.
Fritz Grotemeyer hingegen war ein Vertreter der akademischen
Historienmalerei. Elisabet Ney (1833-1907) war die einzige Bildhauerin
aus Münster, die überregionale Bedeutung erlangte, und darüber hinaus
die einzige Frau im Deutschen Reich, die im 19. Jahrhundert eine
akademische Ausbildung für sich durchsetzen konnte.
„Die Friedensverhandlungen im Rathaussaale zu Münster 1648"
Fritz Grotemeyer (1864-1947) 1895-1902, Öl auf Leinwand Stadtmuseum Münster
Der aus Münster stammende Maler Fritz Grotemeyer fertigte das Gemälde
in den Jahren von 1895 bis 1902 in Berlin an, wo er Meisterschüler des
dortigen Akademiedirektors Anton von Werner war. Das bühnenartig
aufgebaute Gemälde zeigt einen fiktiven Moment der Verhandlungen
zwischen den Gesandten im Friedenssaal. Insgesamt hat Grotemeyer 27
Personen der münsterischen Gesellschaft einschließlich sich selbst in
dem Gemälde als Modelle historischer Gesandter wiedergegeben. Als
Vorbild diente offensichtlich das Gemälde der Friedensbeschwörung von
Gerard ter Borch (1617-1681).

Das Biedermeier
Als nach 1815 demokratische Ideen und Reformansätze zurückgedrängt
wurden, erlosch die Hoffnung des Bürgertums auf politischen Einfluss.
Es zog sich in den privaten, häuslichen Bereich zurück, gründete
Vereine und wandte sich Schöngeistigem zu. Auf diese Haltung bezieht
sich die spöttisch gemeinte Bezeichnung „Biedermeier", die in den
1850er Jahren für die Zeit von 1815 bis 1848 geprägt wurde. Die so
genannten „Biedermeier"-Möbel haben einfache und zweckmäßige Formen und
einen klaren, häufig rechteckigen Aufbau. Auf viel Zierrat wurde zu
Gunsten der natürlichen Holzmaserung verzichtet. Bevorzugt wurden
Hölzer wie Nussbaum, Kirsche, Esche, Buche, Rüster und Mahagoni. Die
Möbel sind auf den häuslich-geselligen Gebrauch zugeschnitten. Den
Mittelpunkt des Zimmers bildeten Tisch, Sofa, leichte Sessel und
Stühle. Die Wände des Wohnzimmers waren mit einer Vielzahl von Bildern
und Bildchen geschmückt. Familienporträts betonen hier im privaten
Bereich das wachsende bürgerliche Selbstbewusstsein. Kleinformatige
Stadtansichten und Landschaftsbilder zeigen die Freude am Sammeln
ebenso wie das Porzellan in dem meist vorhandenen Vitrinenschrank.

Kaiser Wilhelm I. zu Pferde (1797-1888)
Tafelaufsatz aus dem Offiziers-Casino des Westfälischen
Kürassier-Regiments Nr. 4 (von Driesen) in Münster, Silber, gegossen
und ziseliert, J. Wagner & Sohn, Berlin, auf schwarzen Holzsockel,
1892 Stadtmuseum Münster
Der silberne Tafelaufsatz wurde von den ehemaligen Offizieren anläßlich
der Feiern zum 175-jährigen Bestehen des Regiments im Jahre 1892
gestiftet. Wilhelm I. wurde 1861 nach dem Tode seines kinderlosen
Bruders Friedrich Wilhelm IV. König von Preußen. Durch die Politik
seines Ministerpräsidenten Bismarck gelang es ihm 1867 Oberhaupt des
Norddeutschen Bundes und 1871 Deutscher Kaiser zu werden.

Münster wird Großstadt
Nach 1815 errichtete der preußische Staat nahezu alle wichtigen
Regierungs-, Verwaltungs- und Militärbehörden der neu geschaffenen
Provinz in Münster und schuf damit die Grundlage für die bis heute
bestehende Struktur der Stadt als Verwaltungsmetropole. Bis zur ersten
Stadterweiterung von 1875 hatte sich Münster kaum über seine
mittelalterlichen Grenzen hinaus ausgedehnt. In den folgenden
Jahrzehnten verzeichnete die Stadt einen starken Anstieg der
Einwohnerzahl. Im Gegensatz zu den deutschen Wirtschaftszentren war
hierfür nicht die zunehmende Industrialisierung verantwortlich, sondern
der Ausbau Münsters als regionales Oberzentrum. Nicht zuletzt durch den
Bau des Stadthafens in den Jahren 1896-1898 mit Anschluss an den
Dortmund-Ems-Kanal kam es im Südosten zur Ansiedlung von größeren
Handelsunternehmungen und Industriebetrieben. Die Entwicklung in diesem
Gebiet gab dann auch den Anstoß zur zweiten, viel umfangreicheren
Stadterweiterung im Jahr 1903. Das Bevölkerungs- und
Wirtschaftswachstum ging einher mit dem Aufbau umfangreicher kommunaler
Dienstleistungen. Im Kriegsjahr 1916 überschritt die Einwohnerzahl die
Schwelle von 100.000 Personen. Damit war Münster Großstadt.
Modell der Stadt Münster 1903
Holz und Kunststoff, angefertigt durch Modellbau Mosler, Münster, 1989, Maßstab 1:1000, Stadtmuseum Münster
Das Modell zeigt die über den Promenadenring hinausgewachsene Stadt.
Mit ihren zahlreichen zivilen und militärischen Einrichtungen war
Münster regionales Oberzentrum. Rund um den Hafen entstand das erste
Industriegebiet der Stadt.

Karussellpferd
Holz, neue Fassung, deutsch, von linksdrehendem Karussell, um 1910, unsigniert und undatiert
Das traditionelle Karussell ist ohne eine Vielzahl von bunten
Karussellpferden nicht vorstellbar. Es waren hölzerne Pferde, die in
Arbeitsteilung nach vorgegebenen Mustern von Schreinern, Schnitzern und
Malern angefertigt wurden.
Münsters Jahrmarkt: der Send - Sendschwert, Karussellpferd, Sendstandorte, Kaspertheater, Schießhalle
Der Send ist der münsterische
Jahrmarkt, der heute noch dreimal im Jahr abgehalten wird. Die
Bezeichnung „Send" ist abgeleitet von „Synode", der Versammlung von
Geistlichen und Laien des Bistums unter Vorsitz des Bischofs (erstmals
889 erwähnt). Seit dem 11. Jahrhundert schloss sich an die Synode ein
privilegierter Jahrmarkt, ein Freimarkt, an, auf dem auswärtige
Kaufleute ihre Waren anbieten durften. Zeichen der Marktfreiheit und
des von einheimischen und auswärtigen Händlern einzuhaltenden
Marktfriedens war seit 1578 das am Rathaus ausgesteckte Sendschwert.
Eine Kopie dieses Schwertes wird noch heute zu Beginn des Sends am
Rathaus angebracht. In der übrigen Zeit wird dieses Symbol in der
Bürgerhalle des Rathauses gezeigt. Bis in die Mitte des 20.
Jahrhunderts war der Send in erster Linie Verkaufsmarkt. Erst seit dem
Ende des 18. Jahrhunderts sind Karussells, Schießhallen, Schaugeschäfte
und vieles mehr nachweisbar. Heute bestimmen sie neben den vielfältigen
Imbissständen das Bild des münsterischen Sends, der nun weitgehend den
Charakter eines Vergnügungsmarktes hat.

Laden Henke
Der seit dem Ende des 19. Jahrhunderts im Norden der Altstadt
entstandene neue Stadtteil, das Kreuzviertel, benötigte eigene
Einkaufsmöglichkeiten für den täglichen Bedarf. In dem 1907 erbauten
Haus Raesfeldstraße 6 wurde im Erdgeschoss ein Ladenlokal errichtet.
Mieter war die Lebensmittelhandlung Engelhardt und Henke. Nach Ankauf
des Hauses ließ Franz Josef Henke 1911 die Ladeneinrichtung von der
Firma Christenhusz entwerfen und ausführen. 1928 wurde der Laden
umgebaut und vergrößert. Während des Zweiten Weltkrieges verursachten
Bombensplitter leichte Beschädigungen. Abgesehen von diesen
geringfügigen Veränderungen blieb der Laden in seinem Originalzustand
erhalten. Noch bis 1989 konnte man bei der Firma Henke Lebensmittel,
Feinkost und frisch gerösteten Kaffee kaufen. Hier ist die Einrichtung
komplett wiederaufgebaut einschließlich der im Laufe der Jahre
erworbenen technischen Ausstattung wie Kaffeeröstanlage, Kaffeemühle
und Wurstschneidemaschine.

Die Varusschlacht - Angriff der Germanen im Jahre 9 nach Christi

Die Nationalsozialistische Gauhauptstadt - „Machtergreifung", Widerstand, „Gleichschaltung", Totalitärer Staat, Kriegsvorbereitung
Am 30. Januar 1933 ernannte Reichspräsident Paul von Hindenburg den
Führer der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei, Adolf
Hitler, zum Reichskanzler. Bei der Kommunalwahl im März 1933 stieg die
NSDAP mit 40,2% auch in Münster zur stärksten Partei auf. Wie überall
wurden andere Parteien und Verbände „gleichgeschaltet". Der NSDAP
gelang es, ihren Einfluss in alle Bereiche des Lebens auszudehnen.
Münster - als Hauptstadt des Gaus Westfalen-Nord - sollte der neuen
Funktion entprechend durch umfangreiche städtebauliche Maßnahmen
repräsentativ gestaltet werden. Wirklich gebaut wurden nur militärische
Anlagen, die die Kriegsvorbereitungen Hitlers deutlich belegen. Von
1933 bis 1946 war Clemens August Graf von Galen Bischof von Münster.
Schon in seinen Hirtenbriefen 1934 verurteilte er scharf die
nationalsozialistische Rassenlehre. Später wandte er sich öffentlich
gegen die massenhafte Tötung behinderter Menschen („Euthanasie"). Die
demonstrierte Solidarität der Bevölkerung des Bistums schützte ihn vor
Verhaftung und Tod.
Das nationalsozialistische Regime reagierte sofort nach der
Machtübernahme 1933 mit Terror und Gewalt auf jegliche Form von
Widerstand. Einzelpersonen sowie Vertreter von Kirchen, Institutionen
und Organisationen, die nicht bereit waren, systemkonform zu handeln,
waren vielfältigen Repressionen ausgesetzt und bezahlten ihre Haltung
oft mit dem Tod. Die Rassenideologie der Nationalsozialisten führte zu
einer systematischen Diskriminierung, Verfolgung und Vernichtung der
jüdischen Bevölkerung in Deutschland und den nach Kriegsbeginn 1939
besetzten Gebieten. Von den etwa 700 jüdischen Bürgerinnen und Bürgern,
die 1933 in Münster lebten, wurden 274 in Ghettos und
Konzentrationslager deportiert, mindestens 300 flohen ins Exil. Auch
Sinti und Roma sowie Zwangsarbeiter und -arbeiterinnen wurden Opfer von
Terrormaßnahmen. Menschen, die sich den Verhaltens- und Leistungsnormen
der NS-Gesellschaft nicht anpassen wollten oder konnten, gerieten
ebenfalls ins Visier des Regimes. Geistig oder körperlich Behinderte
waren der Vernichtungsmaschinerie hilflos ausgeliefert. Sie wurden
zwangssterilisiert und zum Teil in dazu ausgewählten Anstalten ermordet.
Zum ersten Mal in der Geschichte wurden im Zweiten Weltkrieg die neuen
Luftwaffen intensiv und kriegsbestimmend genutzt. Zunächst wurden sie
als schnelle Angriffsspitze gegen militärische Ziele, gegen
Verkehrsknotenpunkte und gegen feindliche Rüstungsbetriebe eingesetzt.
Sehr bald aber verfolgte man sowohl auf deutscher als auch auf der
Seite der westlichen Alliierten England und Amerika die bereits vor dem
Krieg in Militärkreisen diskutierte Strategie des Luftkrieges gegen die
Zivilbevölkerung: Die systematische Bombardierung von historischen
Stadtkernen und Wohngebieten sollte die Menschen demoralisieren und
dazu bringen, ihre Regierungen unter Druck zu setzen, den Krieg zu
beenden. In Münster wurde die historische Altstadt durch über 100
Luftangriffe zu 92% zerstört. Mehr als 1300 Menschen starben.

Kriegsende und Wiederaufbau
Nach Kriegsende 1945 übte zunächst die britische Militärregierung in
Westfalen die Staatsgewalt aus. Sie setzte deutsche kommunale
Verwaltungen ein. Bald darauf folgte der politische und wirtschaftliche
Neubeginn: die Zulassung politischer Parteien (1945), die Gründung des
Landes Nordrhein-Westfalen (1946), Wahlen für die Stadtvertretung
(1946), die Währungsreform (1948). Münsters zerstörte Innenstadt wurde
nach historischem Vorbild wieder aufgebaut. Mehr und mehr wurde die
politische Verantwortung zurück in deutsche Hände gegeben, so vor allem
mit der Gründung der Bundesrepublik Deutschland (1949), in der in den
frühen 1950er Jahren ein starker wirtschaftlicher Aufschwung - das so
genannte Wirtschaftswunder - einsetzte.
Brezelkäfer - VW Export der Volkswagen AG Wolfsburg, Baujahr 1950
Der VW-Käfer versinnbildlicht wie kein anderes Auto das sogenannte
deutsche Wirtschaftswunder mit seinem schnellen und nachhaltigen
Wirtschaftswachstum in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg. Dieser
Volkswagen wurde wegen seiner ovalen, senkrecht geteilten Heckscheibe
auch als Brezelkäfer bezeichnet. Das ausgestellte Fahrzeug befindet
sich weitgehend im Originalzustand.

Das Café Edwin Müller vom Marienplatz ist ein typisches Ensemble im „New Look" der 1950er Jahre.
Die 1954 von den münsterischen Architekten Kurt Diening und Hans
Rohling entworfene Einrichtung des beliebten Cafés mit seinem markanten
Schaufenster und der geschwungenen Theke wurde in das Stadtmuseum in
weitgehender Rekonstruktion des originalen Zustandes eingebaut. Hierfür
waren aufwändige Restaurierungen erforderlich: So wurden etwa die
ursprüngliche Farbigkeit der Theke freigelegt und die Bezüge der
Sitzmöbel nach alten Vorlagen neu gewebt. Farbe, Glanz und schwungvolle
Gestaltung des Cafés kennzeichnen das neue Lebensgefühl der
Wiederaufbauphase nach dem Zweiten Weltkrieg. Nach der Armut und dem
Schutt der vorhergehenden Jahre sehnte man sich nach Eleganz und
modernen Formen. Das Café Müller ist das einzige Beispiel einer
Ladeneinrichtung der 1950er Jahre, das sich in Münster erhalten hat.

Hans Pape: Wandteller mit Münster-Motiven
Porzellan, Manufaktur August Roloff, gemarkt und bezeichnet, um 1930, Stadtmuseum Münster
Hans Pape (1894-1970) schuf Entwürfe für eine Serie von Wandtellern mit
Motiven aus Münster und Westfalen für die Porzellanmanufaktur August
Roloff in Münster. Sie stehen im Zusammenhang mit den Bemühungen der
münsterischen Künstler um qualitätvolle Reiseandenken.

Prinzipalmarkt mit St. Lamberti

St. Lamberti

Historisches Rathaus Münster

Domplatz Münster mit St.-Paulus-Dom

Domplatz Münster mit Historisches Rathaus Münster via Michaelisplatz

Schloss Münster - Dieses historische Herrenhaus, das ursprünglich als Adelssitz gebaut wurde, ist heute ein Universitätsgebäude.

Der Aasee ist ein Stausee in
Münster, Westfalen. Mit seinen anliegenden Wiesen und Wäldern gilt er
als innerstädtisches Naherholungsgebiet. Der in südwestlicher Richtung
stadtauswärts gelegene See hat eine Fläche von 40,2 Hektar und eine
Länge von etwa 2,3 km. Er ist bis zu zwei Meter tief. Der See wird von
zahlreichen Grünflächen umgeben und ist damit der größte
Naherholungsraum im Stadtgebiet von Münster.

Ludgeristraße in Münster

Ein Frühstück im 1648 CAFÉ ermöglich einen tollen Ausblick auf St. Lamberti und St.-Paulus-Dom.

1534 begann die dramatische Episode des Täuferreichs von Münster. Sie
gipfelte in der Proklamation des Königreichs Zion im September 1534
durch Jan van Leiden mit sich selbst als König. Dieses Königreich hatte
jedoch nur bis zum 24. Juni 1535 Bestand, als Truppen des Bischofs
Franz von Waldeck die belagerte Stadt einnahmen. Die gefolterten und
hingerichteten Anführer der Täufer wurden anschließend in drei eisernen
Körben an der Lambertikirche zur Abschreckung aufgehängt. Die Originale
der Körbe aus dem Jahre 1535 hängen dort noch immer.
St. Lamberti und die drei Körbe im Turm für die Leichen der Wiedertäufer

St.-Paulus-Dom

Schloss Münster ist die ehemalige Residenz der Fürstbischöfe in der
westfälischen Stadt Münster. Die barocke Dreiflügelanlage wurde 1767
bis 1787 im Auftrag von Maximilian Friedrich von Königsegg nach Entwurf
von Johann Conrad Schlaun erbaut. Hervorzuheben waren das Treppenhaus,
der Festsaal und die Hofkapelle. Seit 1954 dient es als Sitz der
Universität Münster.

Schloss Münster - Ansicht von der Stadtseite

Schloss Münster - Ansicht von der Gartenseite

Botanischer Garten der Universität Münster - Jahrhundertealte
botanische Gartenanlage mit alpinem Bereich, Bauerngarten, Arboretum
und Gewächshäusern - vor dem Botanicum der Universität Münster.

Die Tuckesburg liegt auf einem
kleinen Hügel (dem „Weyhesche Hügel“) am Rande des alten Zoos in
Münster zwischen Promenade, Himmelreichallee und Hüfferstraße. Sie war
das 1892 erbaute Wohnhaus von Hermann Landois, in dem er vom 17. März
1892 mit seinem Affen „Lehmann“ bis zu seinem Tod lebte. Er ließ sie
direkt neben dem von ihm gegründeten Zoologischen Garten nach seinen
Vorstellungen erbauen. Dort nannte er sich „Graf Tucks“.

Der Weyhesche Hügel, auf dem die heutige Tuckesburg steht, sind
wahrscheinlich die Reste einer Motte (Turmhügelburg) aus dem
Mittelalter vor den Toren der Stadt. Die Herkunft des Namens
„Tuckesburg“ ist unbekannt. Im Jahr 1967 wurde die Tuckesburg an die
Stadt Münster verkauft, saniert und seitdem als Wohnhaus genutzt.

Dreizehner-Denkmal, 1925
Das Denkmal hinterfragt den Krieg nicht. Es ehrt einseitig die
Gefallenen des Dreizehner-Regimentes als „Helden" und gedenkt nicht der
unschuldigen Kriegsopfer. Der auf sein Schwert gestützte Soldat und der
ruhende Löwe stehen für Stärke, Siegeswillen und den Wunsch nach
Vergeltung für die 1918 erlittene militärische Niederlage. Die
Inschrift „Treue um Treue" verpflichtet auch zukünftige Generationen zu
weiterer kriegerischer Stärke und zur Revanche. Das Dreizehner-Denkmal
diente ab 1963 der Stadtgesellschaft als Ort offiziellen Gedenkens zum
Volkstrauertag. Seit den 1980er Jahren protestierte unter anderem die
Friedensbewegung gegen die Ehrung der Gefallenen als Helden durch das
kriegsverherrlichende Denkmal. Seit 2016 finden die Veranstaltungen zum
Volkstrauertag auf dem Platz des Westfälischen Friedens hinter dem
Rathaus statt.
Zur Geschichte: Ehemalige Offiziere des Infanterie-Regiments Herwarth
von Bitterfeld Nr. 13 gründeten nach der Auflösung des Regimentes 1919
einen Traditionsverein. Dieser stiftete das Denkmal 1925 im Gedenken an
die über zehntausend im Weltkrieg gefallenen Regimentsangehörigen. 1954
weiteten Inschriften das Andenken auf die im Zweiten Weltkrieg
gefallenen Angehörigen des 79. Artillerie-Regiments der Wehrmacht aus.
Es stand in der Nachfolge des Infanterie-Regiments Nr. 13. Das 1813 in
Preußen gegründete Regiment war seit 1816 in einer Kaserne an der
Aegidiistraße stationiert. Zahlreiche Bürger der Stadt und des Umlands
dienten in den Einigungskriegen 1864-1871 und im Ersten Weltkrieg bei
den „Dreizehnern". Die angegebene Gefallenenzahl ist überhöht. Der
Bildhauer Heinrich Bäumer Senior nutzte für das pyramidenförmige
Denkmal Symbole für Krieg und Sieg.

Giant Pool Balls (Claes Oldenburg, 1977)
Material: Installation aus drei Kugeln, bewehrter Beton, Kugeldurchmesser: je 3,5 m
Standort: Aaseeterrassen am nördlichen Ufer des Aasees
Von Claes Oldenburg stammt eines der prägnantesten Zitate zum Thema
Kunst im öffentlichen Raum: „Ich bin für eine Kunst, die etwas anderes
tut, als im Museum auf ihrem Arsch zu sitzen“, soll er 1961 formuliert
haben. Genau das hat er mit seinem Beitrag zu den ersten Skulptur
Projekten in Münster 1977 erreicht. Die „Giant Pool Balls“ sind von
einem der umstrittensten Werke mittlerweile zu einem Wahrzeichen der
Stadt geworden. Entstanden sind sie in Auseinandersetzung mit der
Stadtgeschichte, die durch zahlreiche kriegerische Auseinandersetzungen
geprägt ist. Nicht weit entfernt kann noch heute eine historische
Kanonenkugel in der Stadtmauer besichtigt werden. Zum anderen gaben die
flachen, den Aasee umgebenden Rasenflächen den Anstoß, das Areal als
großen Billiardtisch zu interpretieren, auf dem drei Kugeln in der
einer realen Partie des Künstlers entsprechenden Konstellation liegen
geblieben sind. Obwohl monumental und statisch, geben sie so den
Eindruck eines in Bewegung befindlichen Spiels wieder und verführten
schon manchen Kritiker zu dem vergeblichen Versuch, die Kugeln in den
See zu rollen. So verbleiben sie auf der Aaseewiese als ständiger
Hinweis auf die Relativität der eigenen Maßstäbe und als spielerisch
elegante Aufforderung zu einem zumindest vorübergehenden
Perspektivwechsel.

'Münster für Frieden' am Aegidiitor

Wem der viele Text zu lange war und lieber Bewegtbilder mit Musik mag,
kann sich gerne dieses Video antun:
Stadtmuseum Münster, September 2024: