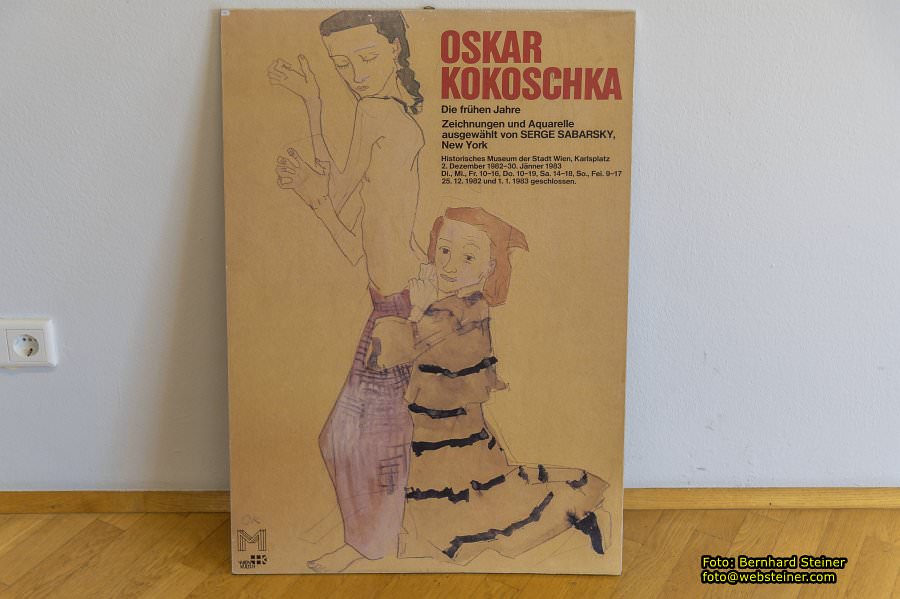web steiner
Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen
Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.
+43/2624/54014 - office@websteiner.com
Pöchlarn
die Nibelungenstadt, Juni 2023
Pöchlarn ist eine Stadtgemeinde im Bezirk Melk in
Niederösterreich (Österreich), liegt im Mostviertel, am rechten
(südlichen) Ufer der Donau direkt an der Mündung der Erlauf, im
Nibelungengau, und wird auch als Nibelungenstadt bezeichnet. Besuchenswert sind die katholische Pfarrkirche Pöchlarn Maria Himmelfahrt, das Geburtshaus von Oskar Kokoschka (Kokoschka-Haus) und das Nibelungendenkmal mit den Wappen der Nibelungenstädte.

Die Pfarrkirche Pöchlarn steht frei eng umstellt vom ehemaligen Karner
und dem Haus Wiener Straße und mit dem Westturm am Haus Kirchenplatz
Nr. 1 anschließend am Standort des ehemaligen römischen Prätoriums am
Kirchplatz und auf engem Raum an der Pfarrgasse in der Stadtgemeinde
Pöchlarn im Bezirk Melk in Niederösterreich. Die auf das Fest Mariä
Himmelfahrt geweihte römisch-katholische Pfarrkirche gehört zum Dekanat
Ybbs in der Diözese St. Pölten.
Das Kirchenäußere zeigt ein hoches breites ungegliedertes Langhaus mit
Rundbogenfenster unter einem Schopfwalmdach, ein Steinquader zeigt die
Ritzung 1496. Die Portalvorhalle mit einem Kreuzgratgewölbe schützt das
schlichte spätgotische Schulterportal. Der mächtige hohe vorgestellte
viergeschoßige Westturm hat eine ausgewogene barocke Gliederung mit
Eckpilaster, Putzfeldschichtung, Rundbogennischen und Rundbogenfenster,
ein zweigeschoßiges Schallhaus mit Uhrengiebeln, er trägt eine stark
eingeschnürten Zwiebelhelm mit hoher Zwiebellaterne.

Das Kircheninnere zeigt eine weite dreischiffige Halle über einer
annähernd quadratischen Grundfläche, das Mittelschiff ist breiter, über
hohen schlanken abgefasten Pfeilern und Halbpfeilern an der Wand mit
Pilastern und Gebälk mit Platzlgewölben auf Gurt- und Scheidbögen. Im
Westjoch befindet sich eine dreischiffige kreuzgratunterwölbte Empore,
der Zugang erfolgt über zwei in der Westwand eingebaute spätgotische
Wendeltreppen, deren Portale sind gefast bzw. haben eine spätgotische
Stabrahmung. Der Triumphbogen ist leicht eingezogen spätgotische
gekehlt und profiliert, im Osten mit 1486. An das quadratische Chorjoch
mit einem Kreuzrippengewölbe schließt ein Fünfachtelschluss an, die
polygonalen und halbrunden Dienste reichen bis zum Boden, um 1486.
Barocke Portale führen in die Choranbauten, im Süden unter einer
barocken Stichkappentonne, im Norden mit einer Tonne mit unregelmäßig
gesetzten Stichkappen um 1500, die Oratorienfenster zeigen geohrte
Rahmungen.
Die beiden Statuen an den Säulen im Kirchenschiff stellen den hl. Mönch
Franz von Assisi und die hl. Nonne Theresia von Avila dar (von Jakob
Schletterer, 1772).

Die Orgel aus 1905 mit 20 Registern stammt von Johann Lachmayr.


Die ornamentalen Glasmalereien zeigen im Polygon Mariä Verkündigung und
Begegnung an der Goldenen Pforte um 1900, im Langhaus Herz Jesu aus
1908, vielfigurige Kreuzigung aus 1911, hl. Monika um 1911, hl.
Antonius um 1911, Christus in der Werkstatt Josefs aus 1911, Herz Mariä
aus 1908, alle von Ostermann und Hartwein.


Die spätbarocke Kanzel an der
nördlichen Seite des Triumphbogens schuf ein unbekannter Künstler im
Jahr 1740; sie wurde 1774 von anderorts in die Kirche übertragen und
1778 mit zusätzlichem spätbarocken Dekor verziert. Ebenfalls 1778
erhielt sie von Tischlermeister Michael Gschwind einen neuen
Schalldeckel mit dem Bildnis des Guten Hirten.

Der Kreuzweg nach Fugel wurde um 1920 vom Maler Hugo Jäckl aus Zell bei Waidhofen an der Ybbs verfertigt.

Der neugotische Hochaltar wurde
von dem Bildhauer Leopold Hofer aus St. Pölten angefertigt und 1903
aufgestellt. Er zeigt im Mittelfeld über dem Tabernakel die
Statuengruppe „Maria, Heil der Kranken", darüber die Heiligste
Dreifaltigkeit, seitwärts die Figuren der hll. Johannes Evangelist und
Josef, darüber die hll. Barbara und Katharina; an der Predella ein
Relief, das die Geburt Christi und die Grablegung darstellt.
Johannes, Apostel und
Evangelist (mit Kelch). Gestorben um das Jahr 100 n. Chr. Sohn des
Fischers Zebedäus und der Salome, jüngerer Bruder des hl. Jakobus d. Ä.
(„Donnersöhne"). Kam über Johannes den Täufer zu Jesus. Ruhte im
Abendmahl an der Brust Jesu; stand unter dem Kreuz neben Maria. Wirkte
zuerst mit Petrus in Jerusalem und Samaria, ging dann nach Ephesus.
Unter Kaiser Domitian (81-96) auf die Insel Patmos verbannt, wo er die
„Geheime Offenbarung" (Apokalypse) schrieb. Kehrte unter Kaiser Nerva
(96-98) nach Ephesus zurück. Er und sein Kreis hinterließen das vierte
Evangelium und drei Johannesbriefe. Sein Gedenktag ist der 27. Dezember.
Barbara, die Fremde
(Nichtgriechin). Gestorben angeblich 306. Nach der Legende ist sie die
Tochter eines Heiden in Nikomedien (Ismid) gewesen, der sie als
Christin angezeigt habe. Martyrium angeblich 306. Ihre Verehrung ist
früh nachweisbar. Gedenktag 4. Dezember.
Das ehem. Hochaltarbild „Maria Himmelfahrt" des großen Malers Martin
Johann Schmidt (Kremser Schmidt) aus dem Jahr 1796 ist heute an der
Nordwand des Chores angebracht.
Mittelfeld des neugotischen Hochaltares von Leopold Hofer aus St.
Pölten, 1903. Statuengruppe „Maria, Heil der Kranken", begleitet von
den Figuren der hll. Johannes Evangelist und Josef, darüber die hll.
Barbara und Katharina.

Die beiden Seitenaltäre mit spätbarocken Aufbauten, die
frühklassizistische Anklänge aufweisen, tragen ebenfalls Ölbilder des
berühmten Martin Johann Schmidt (Kremser Schmidt).
Auf dem rechten Seitenaltarbild
ist der hl. Nepomuk zu sehen. Ein 1753 entstandenes, frühes Gemälde des
Kremser Schmidt, in dem er „zum ersten Mal ein Himmelfahrtsthema
gestaltet. Das Emporschweben wird durch fliegende, stützende und
begleitende Engel glaubhaft gemacht. Licht und Farbe aber sind die
eigentlichen Träger dieser Vision" (Feuchtmüller, Der Kremser Schmidt).

Die beiden Seitenaltäre wurden 1772 aufgestellt und 1912 und 1920 vergrößert.
Auf dem linken Seitenaltar ist
der hl. Sebastian (1773) dargestellt, dem Frauen die Pfeile entfernen
und ihn umsorgen. Die Bildkomposition zieht sich links vorne in den
Raum des Bildes hinein. Die Dramatik des Geschehens wird weniger durch
innere Stimmungen als durch Gesten erzielt.
In der Mitte steht die Statue des hl. Josef, der das Jesuskind und eine
Lilie hält. Nachdem der hl. Bernhard von Clairvaux (t 1153) in seinen
Schriften die Stellung des hl. Josef zu Maria und Jesus ausführlich
dargelegt hatte, setzte die Verehrung des Heiligen im 14. Jh. ein und
wurde besonders von den Bettelorden gefördert. Er wurde Patron der
Kranken und Sterbenden und ist seit 1870 auch der Schutzpatron der
ganzen Kirche. Sein Hochfest wird am 19. März gefeiert.
Zu beiden Seiten stehen die Eltern der Gottesmutter, Joachim und Anna.
Diese Namen der Eltern Mariä und der Großeltern Jesu stammen aus einer
legendären, frühchristlichen Schrift, dem apokryphen Jakobusevangelium.
Die Verehrung der hl. Anna reicht im Osten bis ins 6. Jh. Im Westen
breitete sie sich seit dem 10. Jh. aus. In neuerer Zeit wurde auch der
hl. Joachim verehrt. Der Gedenktag dieser beiden Heiligen wird am 26.
Juli begangen.

Chor. Der spätgotische, überaus breite Chorraum
mit seinem feinen Netzrippengewölbe, dem 5/8-Schluß und den vier
zweiteiligen Fenstern schließt gegen das westlich angebaute dreijochige
Langhaus hin mit einem gotischen, tiefkehlig profilierten Triumphbogen
ab.

Vor der Apsis steht eine vom Schiffmeister Wallnpöck gestiftete
Steinplastik des hl. Johannes Nepomuk (1725) mit verziertem
Rokoko-Sockel.

Beachtlich ist die spätbarocke Gliederung und Dekoration des
viergeschoßigen, 52 m hohen Turmes (1775-1781), mit kräftigen,
bisweilen schon plattenförmigen, übereinandergelegten Putzfaschen, mit
Dreiecksgiebelchen und im Zopfmustergeformten Blindbalustraden. Der
Stil ist genau in den Übergang von Rokoko zum beginnenden Klassizismus,
„Plattenstil", zu datieren.

Manche nennen sie „Nibelungenstadt". Andere die „charmanteste Stadt
zwischen Wien und Linz". Auch Begriffe wie „klein aber fein" und „Perle
an der Donau" kennt man. Pöchlarn hat viele Beinamen und Bezeichnungen.
Und irgendwie wird die Stadtgemeinde auch allen gerecht - ein
attraktiver Ort an der mächtigen Donau mit interessanter Vergangenheit
und spannender Zukunft. Von Arelape zur Römerzeit über Bechelaren im
Mittelalter bis zum Pöchlarn der Neuzeit - mit dem Wechsel der Namen
spannt sich ein Bogen über 2000 Jahre Kulturgeschichte. Die
750-Jahr-Feier der Stadt (2017) markierte den Weg in die Zukunft.
Im 15. und 16. Jahrhundert erlebte Pöchlarn eine Blütezeit durch regen
Handel, vor allem mit Eisen und Eisenwaren aus dem Erzberg. Weil dieses
auf der Donau verschifft wurde, entwickelte sich Pöchlarn zu einem
wichtigen Umschlagplatz. Auch heute ist die Donau ein Garant für die
Weiterentwicklung der Stadt: zur Ansiedlung von Unternehmen und
Menschen, als Touristenmagnet und für Freizeitzwecke der Bewohner. Der
Zugang zum Wasser krönt die optimale Erreichbarkeit der Stadt durch
Anschluss an die Westautobahn (A1), an die Bundesstraße B1, an die
Westbahn sowie den Zugang zum Waldviertel über die Donaubrücke.
Pöchlarn ist mit rund 4000 Einwohnern und ca. 2500 Arbeitsplätzen gut
aufgestellt. Die Wirtschaft strotzt vor Vitalität und Vielseitigkeit.
Aus touristischer Sicht ist die Stadt das Tor zum berühmten Weltnatur-
und Weltkulturerbe Wachau; außerdem ist sie Etappenziel vieler Gäste,
die auf dem Donau-Radweg unterwegs sind. In dem Ort stehen mehrere
Schulen und das Geburtshaus deş berühmten Malers Oskar Kokoschka
(1886-1980), dazu gibt es ein breites Kultur- und Vereinsleben sowie
engagierte Menschen, die positiv nach vorn blicken. Wohnen in Pöchlarn
ist begehrt, weil es eine (Klein-)Stadt mit einer Prise Landromantik
ist. „Pöchlarn zum (Er-)Leben" - so lautet zu Recht das Motto der
Stadt, die auf eine interessante Geschichte zurück- und auf eine
verheißungsvolle Zukunft blickt.

Sowohl im Norden, bei Klein Pöchlarn, als auch im Süden des Pöchlarner
Beckens bei Harlanden siedelten in der Jungsteinzeit, etwa um 4000 vor
Christus, Menschen, welche bereits mit Produkten aus den
Serpentinsteinbrüchen von Klein Pöchlarn Tauschhandel betrieben. Das
heutige Stadtgebiet dagegen war von Donau und Erlauf umflossen und
bildete eine Insel mit einem sehr wichtigen Donauübergang. Die
Siedlungen am Südrand unseres Raumes blieben auch nach der Einwanderung
der Illyrer, um ca. 1800 vor Christus, weiter bestehen. Illyrischer
Herkunft ist auch der Name der Erlauf, Arilapa" (Adlerfluss), der
später abgewandelt als „Arelape" das römische Kastell und die römische
Zivilstadt bezeichnet.
Durch die Eroberung des Königreiches Noricum um 15 v. Chr. drangen die
Römer bis zur Donau vor und sicherten die Donaugrenze, den „Limes", mit
dem Bau von Straßen und Kastellen gegen die im Norden wohnenden
Germanen. Als eines dieser neuen Kastelle entsteht zur Zeit des Kaisers
Tiberius auf der Donauinsel ein kleines Infanterielager, dessen Umrisse
wahrscheinlich den Bereich Thörringplatz, Kirchenplatz,
Weigelspergergasse umfasste. Die Markomannen brachen im Jahre 166 nach
Christus über die Donau nach Süden vor und zerstörten die
Grenzbefestigungen. Kaiser Mark Aurel gelang bis 180 nach Christus die
Rückeroberung und konnte die Markomannen wieder über die Donau
zurücktreiben. Die Donau- bzw. Limesbefestigungen wurden neu und
stärker wiedererrichtet. Die 2. Legion „Italica" wurde an die Donau
verlegt und bezog Quartiere von Schlögen, ÖO., bis Tulln mit dem
Hauptstützpunkt Lorch (Enns-Albing). Das Kastell Arelape wurde nach
Westen erweitert, anstatt der Infanterie garnisonierte nun hier eine
Kavallerieeinheit.
Mit dem Verfall des Römischen Reiches und dem Verlust von Gebieten in
Pannonien wird „Arelape" 395 auch Sitz des Kommandanten der
Donauflottille. Im 5. Jahrhundert wird das Gebiet immer mehr zum
Durchzugsland der verschiedenartigsten germanischen Völker, die von den
Hunnen nach Westen getrieben werden. Um die Mitte des 6. Jahrhunderts
bricht ein neues mongolisches Reitervolk, die Awaren, in unseren Raum
vor. Von Süden und Osten sickern die Slawen in Niederösterreich ein. Um
670 beginnt der Gegenstoß der Bayern von Westen her, sie erreichen die
Erlauf und Melk um ca. 700. Um diese Zeit entsteht wahrscheinlich das
Dorf Ornding als bayerische Siedlung. Als Karl der Große um 800 die
awarische Herrschaft vernichten kann, wird die erste - karolingische -
Ostmark errichtet. Am 6. Oktober 832 schenkte der Enkel Karl des
Großen, König Ludwig der Deutsche, dem Bistum Regensburg (St. Emmeram)
das Gebiet um die,Herilungoburg" die spätere Hofmark Pöchlarn mit den
Orten Pöchlarn, Brunn, Harlanden, Steinwand, Röhrapoint, Knocking,
Ornding und Wörth.

Das 16. Jahrhundert bringt die Blütezeit der Stadt durch regen Handel,
vor allem mit Eisen aus dem Erzberg, das über die „Dreimärktestraße"
Gresten, Scheibbs und Purgstall nach Pöchlarn gelangt und mautfrei auf
dem Land- und Wasserweg weiterbefördert wurde. Auch der Weinhandel
spielt bis ins 19. Jahrhundert für Pöchlarn eine wichtige Rolle. Der
Raum Melk-Ybbs war vom 14. bis ins 19. Jahrhundert ein ergiebiges
Weinbaugebiet. Die Türkeneinfälle von 1529 und 1532 brachten der Stadt
selbst kaum Schäden, wohl aber den umliegenden Orten der Hofmark. Die
Auswirkungen des Dreißigjährigen Krieges auf Pöchlarn waren durch
Truppendurchmärsche, ungeheure Steuerlasten, starken Rückgang des
Handels und einer enormen Geldentwertung gekennzeichnet. 1632 flüchtet
der Regensburger Bischof Albert IV., Graf Thörring zu Stein und
Pertenstein, vor den Schweden in die Hofmark Pöchlarn. Für seine
freundliche Aufnahme lässt er als Dank 1640 den Wolfgangs- und den
Marienbrunnen errichten und die Stadtmauer instand setzen.
Im Spanischen Erbfolgekrieg stellte sich der Regensburger Bischof auf
die Seite der Gegner Österreichs, dadurch wurde die Hofmark 1703 bis
1708 Kriegsbeute des Kaisers. Misswirtschaft der Beschlagnehmer nahm
den Bürgern den Wohlstand fast vollkommen. Hochwässer, Eisstöße und
Brände machten der Stadt arg zu schaffen, so auch der Großbrand 1766,
bei welchem die Stadt, die untere Vorstadt, die Pfarrkirche, der
Karner, das Schloss und die Peterskirche eingeäschert wurden. Die
Bevölkerung hatte Jahre mit dem Wiederaufbau zu kämpfen. 1805 und 1809
wurde Pöchlarn von den Franzosen besetzt, hohe Kriegssteuern und
Plünderungen schädigten die Stadt und ihre Umgebung schwer. 1803 bzw.
1810 endete die fast tausendjährige Herrschaft des Bistums Regensburg
durch den Reichsdeputationshauptschluss. Die Herrschaft Pöchlarn wurde
1811 vom k.u.k Cameralfonds eingezogen und nach unwirtschaftlicher
Verwaltung 1823 an den Baron Bors von Borsod abgegeben, welcher 1900
die Herrschaft an Baron Tinti weiterverkaufte. Durch die Märzrevolution
1848 wurde der Untertanenverband aufgehoben und die Stadt wurde eine
autonome Gemeinde.

Mit der Eröffnung der Westbahn 1858 beginnt ein langsamer
Wiederaufstieg. 1877 wurde die Bahnstrecke Pöchlarn-Kienberg-Gaming in
Betrieb genommen, so wurde Pöchlarn Umschlagplatz für
landwirtschaftliche und industrielle Produkte des Erlauftales. Am 1.
März 1886 erblickt der große Maler Oskar Kokoschka in Pöchlarn das
Licht der Welt. Der 1. Weltkrieg brachte mit dem Zerfall der
Donaumonarchie und dem Verlust des östlichen Wirtschaftsraumes die
erste Republik in eine schlechte Ausgangslage, die eine Krisensituation
heraufbeschwor, welche auch den Aufstieg der Stadt in Grenzen hielt.
Der Anschluss ans „Deutsche Reich" brachte für die Stadt Pöchlarn kaum
Aufschwung, sondern viel Kummer und Leid durch den 2. Weltkrieg. Am 8.
Mai 1945 besetzten russische Truppen Pöchlarn und trafen in Erlauf auf
amerikanische Truppen. Nach 10-jähriger Besatzung war 1955 Österreich
wieder frei und der begonnene Wiederaufbau konnte rascher
voranschreiten. Der wirtschaftliche Aufstieg der Stadt Pöchlarn ging
stetig voran, Gewerbe- und Industriebetriebe siedelten sich im Raum
Pöchlarn an und bauten ihre Kapazitäten rasch aus. Durch den Bau des
Donaukraftwerkes Melk in den Jahren 1979 bis 1981 änderte sich Pöchlarn
enorm und die gefürchteten Überschwemmungskatastrophen werden in
Hinkunft von Pöchlarn ferngehalten werden. Auch die verbesserten
Verkehrsbedingungen durch Bahnunterführungen, Autobahnanschluss und die
im Herbst 2001 freigegebene Donaubrücke werden wesentlich zur steten
Weiterentwicklung Pöchlarns beitragen.

Der Welserturm, ein Wahrzeichen
der Stadt Pöchlarn, war Teil der mittelalterlichen Stadtbefestigung und
wurde im Jahre 1484 vom Regensburger Bischof Heinrich IV. von Absberg
als Wehrturm gebaut. Seit 1999 hat der Turm ein modernes Dach. Das
Stadtmuseum im Welserturm beherbergt die Funde aus dem „Römischen
Pöchlarn".

Der hl. Nepomuk am Donauufer (Nähe Motorfährschiff)
Johannes Nepomuk. Er wurde um
1350 in Pomuk geboren, war seit 1370 Kleriker der Diözese Prag und
später Generalvikar. Als solcher wurde er in
Jurisdiktionsstreitigkeiten mit König Wenzel verwickelt, festgenommen,
gefoltert und 1393 von der Karlsbrücke in die Moldau gestürzt. Er gilt
deshalb als Helfer in Wassernot und bei schuldloser Verdächtigung. Sein
1693 auf der Prager Karlsbrücke errichtetes Standbild fand viele
Nachbildungen. Sein Gedenktag ist der 16. Mai.

Warum Pöchlarn im Nibelungenlied erwähnt wird
Rund 2400 Strophen hat das Nibelungenlied ein Heldenepos aus dem
12./13. Jahrhundert, das Ereignisse und Personen aus dem 5. bis 10.
Jahrhundert reflektiert. In einer Strophe wird Pöchlarn erwähnt - ein
unbezahlbares Geschenk für den Bekanntheitsgrad der Stadt. Doch wie kam
es dazu? Die burgundische Königstochter Kriemhild, die am Hof zu Worm
lebte, machte sich der Sage nach auf den Weg ins Hunnenland (heute
Ungarn), um den dortigen König Etzel zu heiraten. In Pöchlarn, das
damals Bechelaren hieß, wurden sie und ihr Gefolge vom Markgrafen
Rüdiger von Bechelaren freundlich empfangen sowie einige Tage großzügig
beherbergt und bewirtet. Als Dank für die Gastfreundschaft wurde die
Strophe über die Stadt gedichtet.
Das Nibelungendenkmal in Pöchlarn verdeutlicht mit 16 Mosaikwappen die
Handlungsorte aus dem Heldenepos. Entlang des Donaudammes stehen
außerdem vier Figuren aus der Nibelungensage, die ihre Geschichte
erzählen und in die Stadt einladen. Im Nibelungenlied wird die
Gastfreundschaft Pöchlarns beschrieben. Diesem Lob bzw. Anspruch fühlt
sich die Stadt heute noch verpflichtet.
Nibelungendenkmal mit den Wappen der Nibelungenstädte
Eine Nibelungenstadt ist eine Stadt oder allgemeiner ein Ort, der einen
Bezug zu den Nibelungen oder zum Nibelungenlied hat (z. B.
ausdrückliche Nennung im Text) oder einen Anspruch darauf erhebt.

Die Römer erbauten in Pöchlarn eine Befestigungsanlage. Sie war Teil
des hunderte Kilometer langen Grenzwalls (Limes), errichtet zum Schutz
vor den aus Norden eindringenden germanischen Völkern. Hier im
Welserturm zeigt eine permanente Ausstellung interessante Funde aus der
Römerzeit. In mehreren Ausbauphasen errichteten hier römische Soldaten
Legionslager, Kastelle und Wachtürme. Pöchlarn war ein wichtiger Teil
des Donau-Limes Mit der Liburne, einem wendigen Kriegsschiff,
kontrollierten die Römer die Schifffahrt auf der Donau.
Vom 1. bis ins 5. Jahrhundert n. Chr. war das Kastell ARELAPE, das in
dieser Zeit mehrmals aus- und umgebaut wurde, vermutlich durchgehend
mit römischen Soldaten belegt und ab dem 4. Jh. ein Stützpunkt der
römischen Donauflotte. Das Kastell und die angrenzende Siedlung trugen
den Namen „Arelape". Dieser verschwand im Laufe der Zeit und wurde als
„Erlauf" nur für den Fluss gebraucht.

Der Nibelungengau (dazu gehören die Gemeinden Krummnußbaum und
Pöchlarn) gehört wohl zu den geschichtsträchtigsten Talschaften der
Donau in Österreich. Die Nibelungen hatten ihren Weg zum Hunnenkönig
Etzel auf der alten Heeresstraße genommen und dabei die aus der
Römerzeit überlieferten Orte besucht. Durch die Erwähnung im berühmten
Heldenlied bürgerte sich für den Abschnitt zwischen Ybbs und Pöchlarn
die Bezeichnung Nibelungengau ein.

Am 1. März 1886 kam Oskar Kokoschka in dem Haus mit der Adresse
Regensburger Straße 29 in Pöchlarn zur Welt. Das Kokoschka-Haus in
Pöchlarn, Niederösterreich, ist das Geburtshaus des Künstlers Oskar
Kokoschka und beherbergt das Oskar-Kokoschka-Dokumentationszentrum.
Die Ausstellung „Oskar Kokoschka. Stürmische Jahre in Berlin“ widmet
sich Oskar Kokoschkas (1886-1980) Arbeiten für die Berliner Zeitschrift
Der Sturm, einem wichtigen
Künstlernetzwerk der europäischen Avantgarde. Kokoschkas
Porträtzeichnungen, die erstmals hier veröffentlichten Blätter seines
Dramas „Mörder, Hoffnung der Frauen“ sowie die Darstellungen aus der
Welt des Zirkus und Varietes hatten wesentlichen Anteil am
künstlerischen Durchbruch Kokoschkas und zeigen parallel dazu die
vielfältige Kunst- und Kulturszene Berlins der 1910er-Jahre.

Oskar Kokoschka - ein großer Pöchlarner
Kokoschka wurde am 1. März 1886 in Pöchlarn geboren. Sein Geburtshaus
in der Regensburger Straße wurde zu einer Gedenkstätte mit moderner
Galerie ausgebaut. Sehr früh erwarb Kokoschka sich weltweite Aufmerksam
keit als Maler und Dichter. Schwerpunkt seines Schaffens sind
Landschafts- und Städtebilder, Porträts und mytho-logische
Darstellungen. Die Beziehung mit Alma Mahler und der große Bekannten-
und Freundeskreis fanden ihren Niederschlag in Por-träts, die
zweifellos zu den intensivsten Menschenbildern der Moderne zählen. Ab
2021 kommt Kokoschka groß raus, denn auf zwölf Hausfassaden im Zentrum
werden Bilder des Malers im XXL-Format gezeigt. „Der große Kokoschka
2.0" ist eine Neuauflage der Erfolgspremiere von 2019 mit neuen Motiven.

Oskar Kokoschka
1886 Oskar Kokoschka wird am 1. März in Pöchlarn / Niederösterreich geboren. 1887 lässt sich die Familie in Wien nieder.
1904-1909 Studium an der Wiener Kunstgewerbeschule Arbeiten für die Wiener Werkstätte
1908 Beteiligung an der „Kunstschau" in Wien; Uraufführung seines Dramas „Mörder, Hoffnung der Frauen"
1909 Teilnahme an der „Internationalen Kunstschau" in Wien Bekanntschaft mit Adolf Loos und der Wiener Avantgarde.
1910 Aufenthalte in Berlin und Mitarbeit an Herwarth Waldens Avantgardezeitschrift „Der Sturm"
1911 Rückkehr nach Wien und Teilnahme an der Hagenbund-Ausstellung; gibt Kunstunterricht an der privaten Schwarzwald-Schule
1912 Assistent an der
Kunstgewerbeschule für „Allgemeines Aktzeichnen" Erste Begegnung und
Beginn der Liebesbeziehung mit Alma Mahler
1913 Ausstellungsbeteiligungen in Budapest, Zürich, München, Stuttgart
1914/1915 Trennung von Alma Mahler
1915/1916 Freiwillige Meldung zum Kriegsdienst, schwere Verwundungen bei Einsätzen in Galizien (Ukraine) und am Isonzo (Italien)
1916-1919 September bis November 1916 in Berlin bei Herwarth Walden, Aufenthalte in Stockholm und Dresden
1919-1924 Professor an der Dresdner Akademie
1924-1933 Ausgedehnte Reisen durch Europa, Nordafrika und Vorderasien, Längere Aufenthalte in Paris und Wien
1934 Tod der Mutter, Übersiedlung nach Prag, antifaschistisches Engagement, Lernt seine spätere Frau Olda Palkovská kennen.
1937 Erste große Einzelausstellung in Wien im Österreichischen Museum für Kunst und Industrie (heute: MAK),
Diffamierung als „entarteter" Künstler durch die Nationalsozialisten
1938 Erhalt der tschechischen Staatsbürgerschaft
1938-1953 Emigration mit Olda
Palkovská nach England, Heirat 1941 Das Ehepaar lebt in London,
Aufenthalte in Schottland und Cornwall. Kokoschka wird britischer
Staatsbürger (1947)
1953 Gründung der Internationalen Sommerakademie und seiner „Schule des Sehens" in Salzburg (bis 1962),
Übersiedlung nach Villeneuve am Genfer See
1971 Veröffentlichung seiner Autobiografie „Mein Leben"
1973 Gründung der Oskar Kokoschka Dokumentation Pöchlarn
1975 Kokoschka nimmt wieder die österreichische Staatsbürgerschaft an.
1980 Oskar Kokoschka stirbt am 22. Februar in Montreux/Schweiz.

Oskar Kokoschka. Stürmische Jahre in Berlin
Die Ausstellung widmet sich Oskar Kokoschkas (1886-1980) Arbeiten für
die Berliner Zeitschrift Der Sturm, einem wichtigen Künstlernetzwerk
der europäischen Moderne. Der in Pöchlarn geborene Maler, Grafiker und
Dramatiker war ab 1910, dem Gründungsjahr, für das von Herwarth Walden
herausgegebene Avantgardeblatt tätig. Kokoschka porträtierte wichtige
Persönlichkeiten aus den Bereichen Architektur, Schauspiel, Musik oder
Literatur. Die Bildnisse hatten gemeinsam mit den erstmals in der
Zeitschrift veröffentlichten Illustrationen seines expressionistischen
Dramas "Mörder, Hoffnung der Frauen" sowie den Darstellungen aus der
Welt des Zirkus und Varietès wesentlichen Anteil am künstlerischen
Durchbruch Kokoschkas und zeigen parallel dazu die vielfältige Kunst-
und Kulturszene Berlins der 1910er-Jahre. Unter dem Titel" Zwanzig
Zeichnungen" und "Menschenköpfe" wurden Kokoschkas Zeichnungen für den
Sturm auch als eigene Mappenwerke von Herwarth Waldens Sturm-Verlag
herausgegeben.
Kokoschka im Dialog
Oskar Kokoschkas explizite Darstellungen von Femiziden und
struktureller patriarchaler Gewalt sind von erschreckender Aktualität.
Seine radikale Formensprache in Malerei und Grafik fasziniert
Kunstschaffende seit vielen Generationen, wie auch das
Ausstellungsprojekt "Kokoschka im Dialog" mit Studierenden der
Abteilung für Malerei und Animationsfilm der Universität für angewandte
Kunst Wien zeigt. Die Arbeiten sind in der Ausstellung in direkter
Gegenüberstellung mit den Werken Oskar Kokoschkas präsentiert.
50 Jahre Oskar Kokoschka Dokumentation Pöchlarn
Anlässlich des Jubiläums werden zudem die Entstehung und wechselvolle
Geschichte der Forschungseinrichtung und des Ausstellungsbetriebs im
Geburtshaus Oskar Kokoschkas in Pöchlarn näher beleuchtet.
Oskar Kokoschka und die Zeitschrift Der Sturm
Im Jahr 1910 gründete der deutsche Verleger Herwarth Walden (1874 -1941) eine neue Zeitschrift, die unter dem Titel Der Sturm
schon bald zur führenden Plattform der internationalen Avantgarde
werden sollte. Sie setzte sich mit Literatur, Kunst, Musik,
Kunsttheorie und Kulturpolitik auseinander und widmete sich
ästhetischen, philosophischen und moralischen Fragen. Sowohl die
Zeitschrift, in der unter anderem Else Lasker-Schüler, Peter Altenberg,
Adolf Loos, Max Brod, Heinrich Mann oder Selma Lagerlöf publizierten,
als auch die von Herwarth Walden 1912 gegründete Sturm-Galerie bildeten
ein wichtiges Sprachrohr des Expressionismus, Futurismus und Kubismus.
Auf Vermittlung von Karl Kraus und Adolf Loos wurde Oskar Kokoschka
zwei Jahre nach seinem skandalreichen Debüt bei der "Kunstschau Wien
1908" die Möglichkeit geboten, bei Herwarth Walden mitzuarbeiten. 1910
übersiedelte der junge Künstler für ein Jahr nach Berlin und prägte mit
seinen frühexpressionistischen Zeichnungen vor allem den ersten
Jahrgang der Zeitschrift maßgeblich. Allein in dieser Zeit entstanden
28 Arbeiten für das progressive Medium, doch auch die nächsten Jahre
war Kokoschka mit Porträts und szenischen Darstellungen auf den
Titelseiten und im Blattinneren vertreten. Die Auswahl an
Sturm-Ausgaben aus den Jahren 1910 bis 1916 zeigt auch eine
stilistische Entwicklung. Im Gegensatz zu den frühen Darstellungen, die
von der starken Binnenzeichnung, nervösen Strichen und dichten
Schraffuren geprägt sind, weist das Selbstporträt aus dem Jahr 1916
bereits eine viel größere Ruhe auf.

Beziehungen und Verflechtungen
Herwarth Walden, der umtriebige und leidenschaftliche Pianist,
Komponist, Schriftsteller, Verleger und Galerist, gilt als eine der
einflussreichsten und prägendsten Persönlichkeiten im Berlin der
1910er-Jahre. 1878 als Georg Lewin geboren, war er in erster Ehe mit
Else Lasker-Schüler verheiratet, von der möglicherweise auch sein
Pseudonym stammt. Die Dichterin und Zeichnerin veröffentlichte
zahlreiche Gedichte und Texte sowie auch die beiden
Kokoschka-Karikaturen im Sturm
- der Künstler als gesuchter, aber netter Ganove. Gemeinsam mit seiner
zweiten Frau, der schwedischen Malerin und Schriftstellerin Nell
Roslund, baute Walden die Zeitschrift zum transnationalen "Unternehmen
Sturm" aus. Neben dem Verlag gab es eine Galerie, eine Bühne, eine
Schule, musikalische Abende und Lesungen sowie eine Buchhandlung und
Postkartenproduktion, wobei der Aufschwung auch im Zusammen-hang mit
geheimdienstlichen Schattengeschäften mit dem deutschen Kriegspresseamt
gestanden haben dürfte. Im Gegensatz dazu war die Anfangszeit des
Sturms von ständigen finanziellen Engpässen geprägt. Karl Kraus, der
Herausgeber der Wiener Satirezeitschrift Die Fackel, unterstützte
Waldens Zeitschriftengründung sowohl inhaltlich als auch finanziell.
Sein Porträt sowie jenes von Adolf Loos, beide waren wichtige Mentoren
Kokoschkas, bildeten den Auftakt zu einer Serie von Porträtzeichnungen
im Sturm, zu der auch die Bildnisse Nell und Herwarth Waldens gehören.
"Mörder, Hoffnung der Frauen"
In der Zeitschrift Der Sturm wurden 1910 erstmals die Druckfassung
sowie die vier expressionistischen, radikalen Illustrationen zu Oskar
Kokoschkas Drama" Mörder, Hoffnung der Frauen" publiziert, welches bei
der "Internationalen Kunstschau Wien 1909" zur Uraufführung kam. Wie in
zahlreichen frühen Arbeiten des Künstlers steht das Thema der - oftmals
sexuellen - Gewalt gegen Frauen im Mittelpunkt, ein
Geschlechterkonflikt, der sich in den Zeichnungen zu einem
dramatischen, blutigen Kampf steigert und im brutalen Femizid gipfelt.
In dem Drama hat Kokoschka eine Vielzahl an Geschichten, Rückgriffen
und Motiven verarbeitet. Der Text weist mehrere Bedeutungsebenen auf:
Neben der Antike und Kleists Penthesilea spielt das Christentum ebenso
herein wie der in dieser Zeit immer wieder thematisierte Vampirismus
bis hin zum Lustmörder-Motiv, das damals nicht zuletzt durch Frank
Wedekinds Drama" Lulu" in den Intellektuellenzirkeln beständiges Thema
war. Gleichermaßen können die frühen Dramen nicht ohne Johann Jakob
Bachofen (sein Buch Das Mutterrecht befand sich in der Bibliothek
Kokoschkas) und die misogynen Theorien von Otto Weininger gesehen
werden. Die vier Blätter, die zum Zeitpunkt ihres Erscheinens im Sturm
vielfach für Unverständnis gesorgt haben, waren auch Teil des von
Herwarth Walden 1913 verlegten Kokoschka-Mappenwerks "Zwanzig
Zeichnungen". Nell Walden schreibt in ihrem 1963 erschienenen Buch Herwarth Walden. Ein Lebensbild
zu Kokoschkas Zeichnungen: "Herwarth Walden erklärte mir: ,Ich kann dir
keine Hochzeitsgeschenke geben, aber du kannst die Zeichnungen von
Kokoschka haben!' Ich verbannte nun natürlich die eingerahmten
Reproduktionen aus Schweden, und wir hängten die schönen, starken,
damals verfemten Zeichnungen von Kokoschka aus den ersten
,Sturm'-Jahrgängen auf. Darunter waren die jetzt so berühmten
Frühzeichnungen, Mörder, Hoffnung der Frauen."

Kokoschka im Dialog - Reflexionen zu "Mörder, Hoffnung der Frauen"
Oskar Kokoschkas radikale Formensprache in Malerei und Grafik,
Konzeption und Komposition von Bildmotiven ist immer wieder
Ausgangspunkt für eine lebendige künstlerische Auseinandersetzung. Aus
Anlass des 50-Jahr-Jubiläums der Oskar Kokoschka Dokumentation Pöchlarn
findet 2023 eine Kooperation mit der Abteilung für Malerei und
Animationsfilm der Universität für angewandte Kunst Wien statt.
Kokoschka war selbst von 1904 bis 1909 Student der Angewandten, der
früheren Wiener Kunstgewerbeschule, mit der er sich zeitlebens eng
verbunden fühlte. Neun Studierende aus unterschiedlichen Semestern
haben sich Kokoschkas Zeichnungen für die Zeitschrift Der Sturm, die in den Jahren 1910 bis 1916 entstanden sind, als Grundlage für eigene Arbeiten genommen.
Aspekte des nach 1900 omnipräsenten Geschlechterkampfs sowie Kokoschkas
explizite Darstellungen von Femiziden und struktureller patriarchaler
Gewalt erscheinen in aktuellen Diskursen mehr denn je virulent. Hanna
Skultéty reflektiert über die der Gesellschaft immanente Gewalt und
nähert sich dem Thema mit einer ausdrucksstarken, farbkräftigen Arbeit
in einem eher kindlich illustrativen Stil. In dem Triptychon ist nicht
mehr die Frau das Opfer, sondern es ist die tätliche/tödliche
Auseinandersetzung zwischen Männern in einem abstrakten Raum
wiedergegeben. Auch Janne Marie Dauers mehrteilige Arbeit entstand vor
dem Hintergrund von Kokoschkas "Mörder, Hoffnung der Frauen". Sie
greift das Drama auf spielerisch abstrakte Weise auf, indem sie die
Regieanweisungen des Stücks mithilfe eines Comics in einen neuen
Kontext - ein Scheidungsdrama - setzt und die gewaltsame Situation ad
absurdum führt. Aus Kokoschkas brutaler männlicher Figur, im Text nur
als "Der Mann" bezeichnet, wird laut Dauer ein "lächerlicher, hilfloser
Büroangestellter", der von einer Frau einen Ordner mit Papieren
überreicht bekommt und diese dann verbrennt.
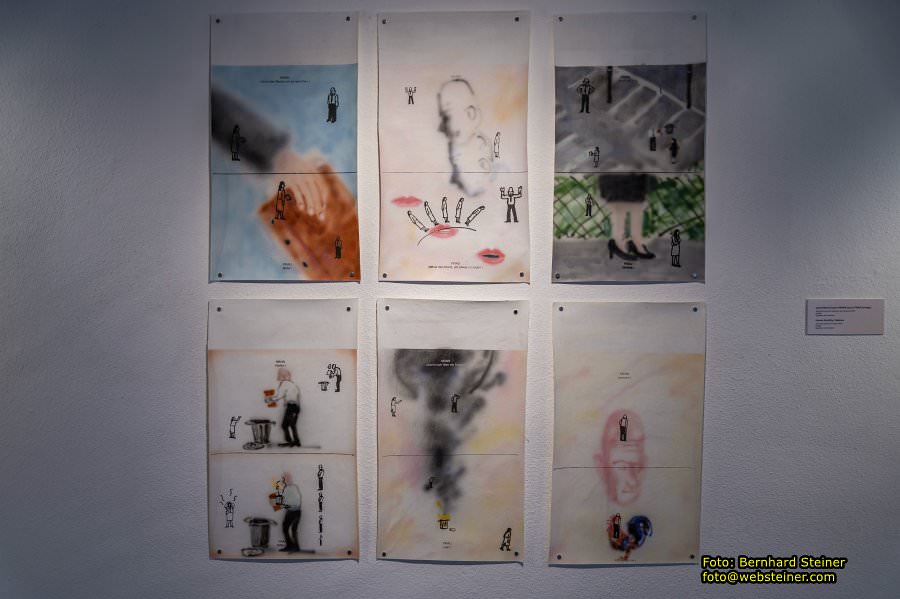
Oskar Kokoschka Dokumentation Pöchlarn - Ein halbes Jahrhundert 1973-2023
Vor 50 Jahren konstituierte sich in Pöchlarn der von einem
international besetzten Kuratorium begleitete "Verein zur Erforschung
und Dokumentation des Werkes Oskar Kokoschkas", am 14. Juli 1973 fand
im Geburtshaus Oskar Kokoschkas die offizielle Eröffnung der
Gedenkstätte statt. Zum Leiter der von Oskar und Olda Kokoschka
unterstützten wissenschaftlichen Einrichtung wurde Johann Winkler
ernannt, der diese während seiner Tätigkeit bis Mitte der 1990er-Jahre
zu einer der wesentlichsten Anlaufstellen der Kokoschka-Forschung
machte und zahlreiche nationale und internationale Ausstellungen und
Publikationen realisieren konnte. Ende der 1990er-Jahre bot sich der
Stadtgemeinde Pöchlarn die Möglichkeit, das Haus zu kaufen und zu einem
allen Museumsstandards gerecht werdenden Ausstellungszentrum umzubauen.
Wie sich das Kokoschka Museum Pöchlarn heute präsentiert, ist
maßgeblich den ehemaligen Bürgermeistern und Vorsitzenden des Vereins -
Rupert Strauß, Hans Klimmer sowie Georg Fuchs zu verdanken.
Unvergesslicher Spiritus Rector der Oskar Kokoschka Dokumentation war
bis zu seinem Tod im Jahr 2018 Franz Eder. Parallel dazu sichert die
über 25-jährige Kooperation mit der Universität für angewandte Kunst
Wien die wissenschaftliche Bearbeitung und Kuratierung der jährlich
stattfindenden Ausstellungen. Anlässlich des 50-Jahr-Jubiläums der
Oskar Kokoschka Dokumentation Pöchlarn erschien eine Festschrift mit
dem Titel "Kokoschka im Fokus. Stürmische Jahre in Berlin / Oskar
Kokoschka Dokumentation Pöchlarn. Ein halbes Jahrhundert 1973-2023".
Der Töpfer
Anlässlich der Eröffnung der Oskar Kokoschka Dokumentation Pöchlarn im
Jahr 1973 schenkte Oskar Kokoschka der Stadtgemeinde das Bronzerelief
„Der Töpfer", das auch als Titelbild für die Gründungsfestschrift
diente. Die Vorlage für das Relief bildete ein Blatt aus seinem 1963
entstandenen Lithografie-Zyklus »Apulia«. Einen weiteren Abguss aus der
Berliner Gießerei Noack ließ Kokoschka neben der Tür seines Hauses in
Villeneuve anbringen. 1978 schuf die Firma Rosenthal zudem eine auf 20
Stück limitierte Auflage in Porzellan.
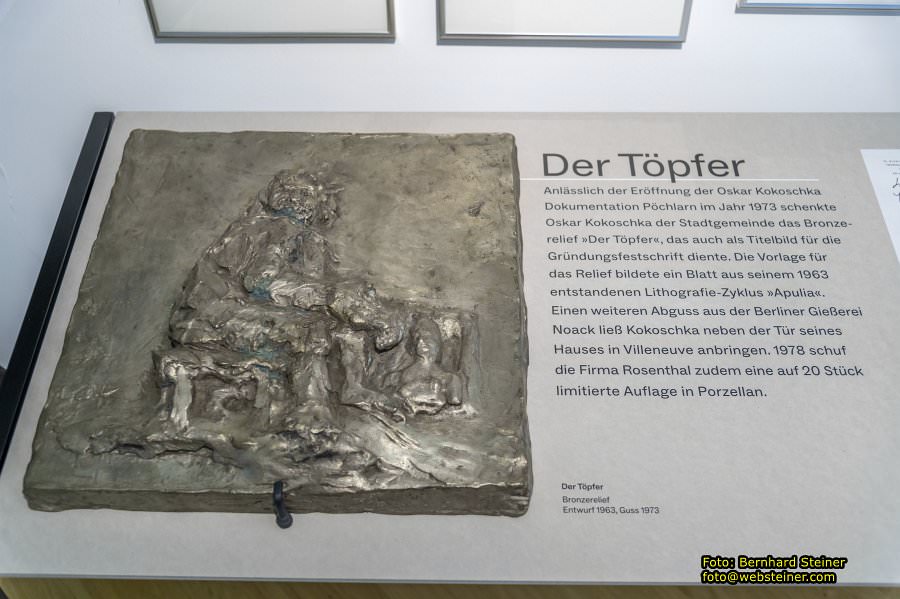
Ehrenbürgerschafts-Urkunde
Im Jahr 1951 wurde Oskar Kokoschka (in Abwesenheit) die
Ehrenbürgerschaft Pöchlarns durch den Gemeinderat unter Bürgermeister
Friedrich Stifsohn verliehen. Nach 1945 hatte der in Golling bei
Pöchlarn aufgewachsene, akademische Maler Sepp Mayrhuber den
Gemeinderat auf Oskar Kokoschka, ihren wohl berühmtesten Sohn,
aufmerksam gemacht. In Folge war es zur Kontaktaufnahme mit dem damals
noch in England lebenden Künstler gekommen.

Ehrenring der Stadt Pöchlarn („Nibelungenring")
1956, anlässlich des 70. Geburtstags Oskar Kokoschkas, beschloss der
Gemeinderat den Künstler mit dem neu geschaffenen Ehrenring der Stadt,
dem Nibelungenring, zu ehren. Oskar Kokoschka nahm diese Ehrung am 16.
August 1956 persönlich durch Bürgermeister Franz Leeb entgegen. Sein
Besuch wurde in Pöchlarn zu einem Festtag, an dem nicht nur sämtliche
Würdenträger der Stadt, sondern auch die Bevölkerung lebhaft teilnahm.

Varieté und Nachtleben
Oskar Kokoschkas Zeichnungen für die wöchentlich erscheinenden
Sturm-Ausgaben, die dem Blatt sein spezifisches künstlerisches Profil
verleihen, unterscheiden sich stilistisch stark von seinen noch
secessionistisch geprägten Arbeiten für die Wiener Werkstätte und das
Cabaret Fledermaus aus der Zeit an der Wiener Kunstgewerbeschule. In
den expressionistischen Porträts und Darstellungen dominieren nun
scharfe Linien, Schraffuren und gekreuzte Strichlagen. Besonders
eindrucksvoll zeigt sich der Stil in jenen Zeichnungen, die im Zuge von
Kokoschkas Rezensionstätigkeit für den Sturm
entstanden. Die nach 1900 boomenden Zirkus-, Tanz- und
Varietéaufführungen in Berlin übten eine große Faszination auf den
Künstler aus. Die Redaktion des Sturms hatte Freikarten für den
Wintergarten, eines der seinerzeit beliebtesten Varietés Berlins mit
internationalen Künstler:innen und Sensationsnummern. Oskar Kokoschka
verbrachte manche Abende im Varieté und hielt die teils waghalsigen
Vorführungen der Artist:innen für den Sturm in Zeichnungen fest, zudem
berichtete er in einigen kurzen Textbeiträgen über die Attraktionen.
Andere Blätter aus diesem Zeitungsjahrgang, aufgrund der dichten
Zeichnung und dem expressiv-nervösen Strichgefüge teils schwer lesbar,
geben Szenen aus dem Prostituierten-Milieu sowie das nächtliche Treiben
in der Großstadt wieder. Die ursprünglich für die Wochenschrift für
Kultur und die Künste entstandenen Darstellungen, wie der Untertitel
des Sturms lautete, gab Herwarth Walden 1913 als Mappenwerk unter dem
Titel "Zwanzig Zeichnungen" heraus. In der drei Jahre später verlegten
Mappe mit dem bezeichnenden Titel " Menschenköpfe" sind die Porträts
zweier damaliger Größen des Varietés enthalten, die beide wiederholt im
Berliner Wintergarten auftraten: Die aus Paris bekannte Diseuse Yvette
Guilbert sowie die beliebte Berliner Volkssängerin Claire Waldoff.

Menschenköpfe
Die Mappe der " Menschenköpfe" versammelt eine lose Serie von Porträts
Oskar Kokoschkas, die vorwiegend 1910/1911 und dann 1916 für die
Zeitschrift Der Sturm
entstanden sind. Den Auftakt machten Adolf Loos und Karl Kraus, zwei
der wichtigsten Vertreter des Wiener Kunst- und Kulturlebens nach 1900.
Es folgten die Bildnisse von Herwarth Walden sowie den engen Vertrauten
und Mitarbeitern des Verlegers, wie jenes des Architekten Paul
Scheerbart, des Schauspielers und Rezitators Rudolf Blümner oder des
Lyrikers Richard Dehmel. Diese frühen Darstellungen heben sich
stilistisch deutlich von Kokoschkas fünf Jahre später im Sturm
publizierten Porträts ab, etwa dem der Schauspielerin Gertrud Eysoldt
oder der Schriftstellerin Mechtild Lichnowsky. Kokoschka war nach
zweimaliger Verwundung im Ersten Weltkrieg für drei Monate zur
Rekonvaleszenz in Berlin. Herwarth und Nell Walden stellten ihm einen
Arbeitsraum in der Sturm-Zentrale in der Potsdamer Straße zur
Verfügung, wo neben drei Illustrationen zu einem Text seines Bruders
Bohuslav auch die neuen Porträts entstanden. Die Gesichter sind nun
durch wenige Striche und einen kräftigen Zeichenduktus geformt. Die
harte Feder wurde von einem weichen Tuschpinsel abgelöst, die
Porträtierten wirken natürlicher. Die Zeichnungen stehen in einem
starken Kontrast zu den frühen sogenannten psychologischen Porträts.

Oskar Kokoschka wird am 1. März 1886 in diesem Haus, damals Haus
Vorstadt Nr. 5, geboren. Seine Kindheit und Jugend verbringt er jedoch
weitgehend in Wien. Schon als junger Künstler verlässt er Österreich
eine internationale Karriere beginnt. Zahlreiche Lebensstationen
folgen, darunter Berlin, Dresden, Paris, Prag und London. Nach 1945
nimmt seine Geburtsstadt Pöchlarn wieder Kontakt mit ihm auf. 1951 wird
er zum Ehrenbürger ernannt und 1954 spendet Kokoschka großzügig für die
Pöchlarner Opfer einer Hochwasserkatastrophe. 1956 erhält er den
Ehrenring der Stadt Pöchlarn, den der Künstler bei einem persönlichen
Besuch entgegennimmt. Im Jahr 1973 wird der Verein zur Erforschung und
Dokumentation des Werkes Oskar Kokoschkas, kurz: die Oskar Kokoschka
Dokumentation, unter der Patronanz von Oskar und Olda Kokoschka
gegründet. Neben der Förderung der Kokoschka-Forschung zählt die
Präsentation seines Werkes in jährlich wechselnden Sonderausstellungen
im Geburtshaus zu ihren Hauptaufgaben.
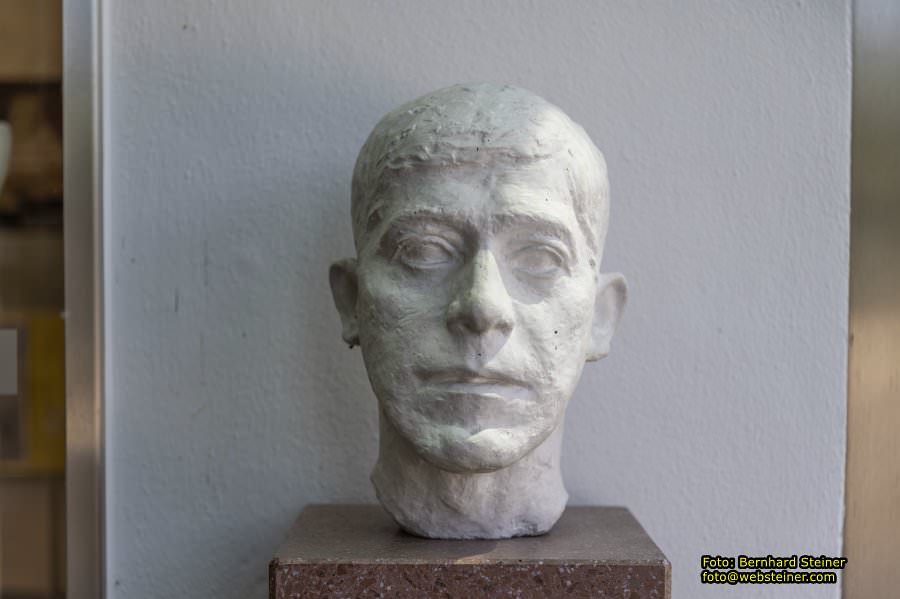
Kokoschka wird am 1. März 1886 bei einem Aufenthalt der Mutter in
Pöchlarn im Haus Vorstadt Nr. 5 geboren. Sein Vater Gustav stammt aus
einer alten Prager Goldschmiedefamilie und arbeitet wirtschaftsbedingt
als Handelsreisender, seine Mutter Romana, geb. Loidl, hat ihre Wurzeln
in einer steirischen Bauernfamilie. Kokoschkas Familie, mit der er
lebenslang eng verbunden bleibt, übersiedelt bald nach Wien. Dort
wächst er in einfachen Verhältnissen auf. Schon in der Schulzeit zeigt
sich sein außergewöhnliches künstlerisches Talent.
Von 1904 bis 1909 studiert Kokoschka an der k. k. Kunstgewerbeschule in
Wien, wo er ursprünglich als „Zeichenlehrer" u. a. von Bertold Löffler
ausgebildet wird. Noch als Student wird er Mitarbeiter der Wiener
Werkstätte, wo er u.a. Postkarten sowie sein Märchenbuch „Die
träumenden Knaben" (1908) gestaltet. Bildlich steht es noch dem
Jugendstil nahe, seine Texte zählen jedoch zu den frühesten
expressionistischen Dichtungen. Er widmet es Gustav Klimt, der ihm die
Chance gibt, erstmals bei der prominenten „Kunstschau" 1908
auszustellen.
Kokoschkas Ausstellungsdebüt 1908 wird zum Skandal, er selbst als „Oberwildling" bezeichnet.
Zugleich wird der Architekt Adolf Loos sein Förderer und der junge
Künstler im künstlerisch-intellektuellen Kreis des „Wien um 1900" um
Karl Kraus und Peter Altenberg aufgenommen. Kokoschkas schonungslose
Porträts, die radikal Seelenzustände zeigen, werden von der Kunstkritik
mit teils wüsten Beschimpfungen abgelehnt. Die Uraufführung seines
Dramas „Mörder, Hoffnung der Frauen" 1909 endet im Tumult. OK - die
Initialen, mit denen er seine Arbeiten signiert - stilisiert sich in
Folge als „Wilder" und Dandy, kahl rasiert und in nobler Garderobe.

1909 ist Kokoschka auch bei der „Internationalen Kunstschau" in Wien
vertreten. Mit Adolf Loos reist er in die Schweiz. Ab 1910 arbeitet er
mit Herwarth Walden in Berlin für die Avantgarde-Zeitschrift „Der
Sturm". In Wien scheiden sich die Geister: Bei einer
Hagenbund-Ausstellung 1911 erntet er sowohl heftige Kritik als auch
große Anerkennung. Die Schulbehörde erzwingt seine Entlassung als
Zeichenlehrer von der privaten Mädchenschule der Eugenie Schwarzwald
wegen seines fantasievollen, kindgerechten Unterrichts. Sein Vortrag
„Das Bewußtsein der Gesichte" endet 1912 mit Polizeieinsatz.
Von 1912 bis 1914 ist Kokoschka mit Alma Mahler, der jungen Witwe des
Komponisten Gustav Mahler in einer leidenschaftlichen Beziehung
verbunden. In Bildern, Bildzyklen und Dramen verarbeitet er sein
Liebesglück, aber auch seine Eifersucht sowie den Schmerz nach der
Abtreibung eines gemeinsamen Kindes. Das berühmte Gemälde „Die
Windsbraut", als Verlobungsbild gedacht, zeigt das Paar in bedrohlicher
Meereswoge. Alma beendet die Beziehung 1914. Kokoschka meldet sich zum
Kriegsdienst und „Die Windsbraut" wird verkauft. Noch 1919 lässt er
eine Puppe nach Almas Vorbild herstellen, die er mehrfach malt.
Nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs meldet sich Kokoschka freiwillig
zur Armee und beginnt Anfang 1915 seinen Kriegsdienst in einem
Dragonerregiment. Im Sommer erleidet er an der galizischen Front einen
Nackenschuss und einen Lungenstich. Im Lazarett entwirft er sein Drama
„Orpheus und Eurydike". Im Sommer 1916 ist er als Kriegsmaler an der
Isonzofront, gilt aber bald wegen eines schweren Schocks nach einer in
unmittelbarer Nähe erlebten Explosion als „kriegsuntauglich".
Zeichnungen mit pazifistischen und kriegsverdammenden Motiven entstehen.

Ab Ende 1916 ist Kokoschka im Sanatorium „Weißer Hirsch" in Dresden, wo
er Anschluss an Literaten- und Theaterkreise findet: sein berühmtes
Gemälde „Die Freunde" entsteht. 1919 erfüllt sich sein Wunsch nach
einer Professur an der Akademie in Dresden, ein Vertrag mit der Galerie
Cassirer Berlin sichert ihn zusätzlich ab. Etliche Dramen erfahren ihre
Uraufführung, seine Arbeiten werden international ausgestellt und von
Museen angekauft. Er malt zahlreiche Städtebilder, vor allem von
Dresden. Diese Schaffensphase ist durch eine flächige, farbintensive
Malweise geprägt.
Ab 1923 ist Kokoschka von seiner Professur in Dresden beurlaubt und
kehrt nicht mehr zurück, intensive Reisejahre beginnen, Porträts,
Landschafts- und Städtebilder entstehen. Er lebt zeitweilig in Paris
und London, wo er im Zoo u. a. den „Mandrill" malt. Ausgedehnte
Aufenthalte in Südfrankreich, Holland und 1928/29 eine große
Afrika-Reise finden fruchtbaren Niederschlag in seiner Arbeit.
Bereits 1920 kauft Kokoschka für seine Familie ein Haus im Liebhartstal
am Rande des Wienerwalds. Als 1923 sein Vater stirbt, fühlt er sich
mehr denn je für das Wohl seiner Mutter und Geschwister verantwortlich.
So lebt und arbeitet er ab 1924 immer wieder auch in Wien. Viele
bekannte Bilder entstehen, u. a. in seinem Wiener Dachatelier. Im
Februar 1934 radikalisiert sich durch die Bürgerkriegsunruhen das
politische Klima in Österreich, Kokoschkas Mutter stirbt. Kokoschka
verlässt Wien im Herbst 1934 endgültig.

Schon als Student schreibt Kokoschka Dramen, die wie „Mörder, Hoffnung
der Frauen" (1908/09) zur frühexpressionistischen Literatur zählen und
meist Skandale provozieren. Im Cabaret Voltaire (Zürich), dem
Geburtsort des Dadaismus, wird sein Stück „Sphinx und Strohmann (Hiob)"
1917 uraufgeführt. Kokoschka führt wiederholt auch Regie und entwirft
bis ins hohe Alter Bühnenbilder für seine eigenen Stücke sowie von
anderen, z. B. von Ferdinand Raimund. Kokoschkas Drama „Comenius" wird
nach seinen Anweisungen 1974 für das Fernsehen verfilmt.
Musik zieht sich wie ein roter Faden durch OKs Lebenswerk. Er ist mit
Komponisten (u. a. Arnold Schönberg, Anton von Webern, Ernst Křenek)
und Musikern befreundet und porträtiert sie. Seine Literatur wird
vertont: 1919 „Mörder, Hoffnung der Frauen" (Oper von Paul Hindemith),
1923 „Orpheus und Eurydike" (Oper von Křenek), 1972 „Die träumenden
Knaben" (Kantate von Gottfried von Einem). Sein Zyklus „Das Konzert"
(1920/21) befasst sich mit den Emotionen beim Musikhören. Für
zahlreiche Opern, u. a. von Mozart und Verdi, erhält er Aufträge für
Bühnenbild- und Kostümentwürfe.
Schon bei seiner ersten Schweiz-Reise 1909 hat die Landschaft rund um
den Genfer See OK sehr beeindruckt. 1953 kauft er mit seiner Frau Olda
ein Grundstück in Villeneuve, ein einfaches Haus wird nach seinen
Wünschen gebaut. Es ist von einem riesigen Garten mit Blick auf den See
umgeben. Der „unstete Wanderer" wird hier zum begeisterten Gärtner und
legt seine vielen Reisen so, dass er die Blütezeit im Frühjahr nicht
verpasst. In seinem Atelier, das er „Bibliothek" nennt, entstehen viele
Blumenaquarelle und sein wichtiges Spätwerk.

Im Herbst 1934 verlässt Kokoschka Wien und zieht nach Prag, wo er u. a.
den Staatspräsidenten Thomas Masaryk malt sowie eine Vielzahl von
Prager Stadtansichten. Er lernt die junge Juristin Olda Palkovská,
seine spätere Frau, kennen. Er ist ein engagierter Antifaschist und
Pazifist und fordert (erfolglos) ein übernationales Schulsystem, das er
als Grundlage für eine friedliche Zukunft sieht. Ähnlich wie Picasso
versucht er mit einem Plakat auf die Massaker im Spanischen Bürgerkrieg
aufmerksam zu machen. 1935 wird er tschechoslowakischer Staatsbürger.
1937 ist Kokoschka in der national-sozialistischen Hetzschau „Entartete
Kunst" mit mehreren Arbeiten vertreten. Insgesamt 456 seiner Werke
werden als „entartet" aus deutschen Museen entfernt und teilweise im
bekannten Schweizer Auktionshaus Fischer für das Naziregime
gewinnbringend versteigert. Er selbst flieht im Oktober 1938 mit Olda
nach London. Er beginnt eine Serie von politischen Allegorien, wie „Das
rote Ei": Hitlers und Mussolinis Machthunger und die (teils
schweigende, teils aktive) Zustimmung Englands und Frankreichs sind
wiederholt Themen seiner „Bildrätsel".
Kokoschka bleibt nach dem Krieg in England und wird 1947 britischer
Staatsbürger. Die Sorge um seine in Wien und Prag verbliebene Familie
ist weiterhin groß. Er ist vielfältig humanitär engagiert, so lässt er
u. a. 5.000 Plakate seiner Grafik „Christus hilft den hungernden
Kindern" als Appell in London affichieren. Ab 1948 wird sein Werk in
mehreren amerikanischen Städten (u. a. New York, Boston) gezeigt. In
Europa, etwa in Basel (1947) oder bei der XXIV. Biennale in Venedig
1948, wird er als moderner „Altmeister" gefeiert. Auch in Österreich
finden große Sonderschauen statt, zu einer dauernden „Rückkehr" kommt
es jedoch nicht. 1953 lassen sich Kokoschka und seine Frau Olda in
Villeneuve am Genfer See nieder.
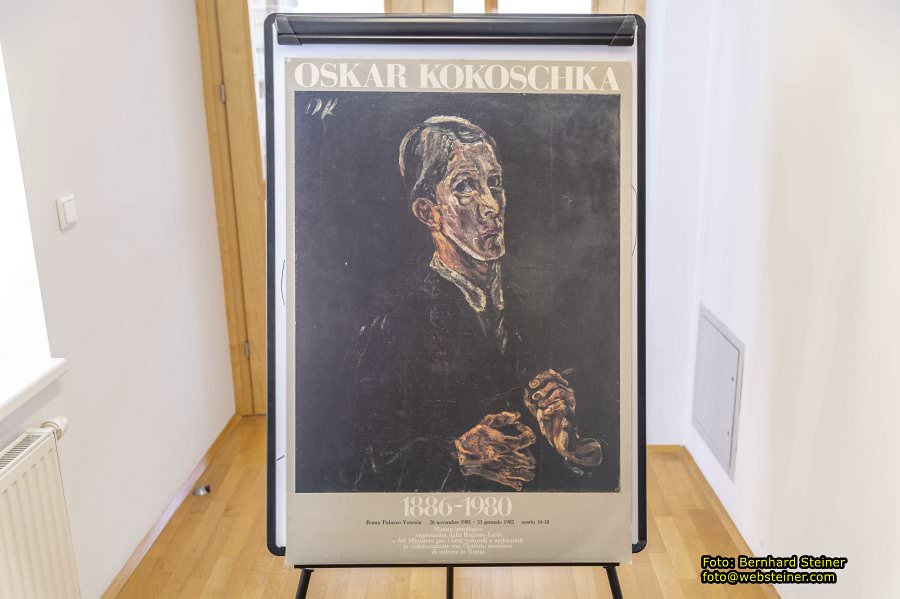
Kokoschka ist ein unkonventioneller, stets begeisterter und
begeisternder Lehrer - schon an der Mädchenschule Eugenie Schwarzwalds
(1911) und als Leiter des „Aktkurses" an der k. k. Kunstgewerbeschule
(1912/13). Nach 1945 unterrichtet er in den USA (Boston, Minneapolis),
in der Schweiz (Sion) und nicht zuletzt in Salzburg. Dort gründet er
seine „Schule des Sehens" (heute: „Internationale Sommerakademie"), die
er von 1953-1963 leitet. Seine „Schule" ist für alle, nicht nur für
„akademische" Maler, offen. „Sehen" hat für ihn in einem tieferen Sinne
mit menschlicher Erkenntnis und Reifung zu tun.
Kokoschka ist sein Leben lang sehr an der Antike interessiert. Im
Mittelmeerraum sieht er die Wiege der (westlichen) Kultur, die
Grundlage des Humanismus. Seine Triptychen mit antiken Themen greifen
auch aktuelle politische Inhalte auf. Grafikzyklen wie „Bekenntnis zu
Hellas" sowie Illustrationen zu antiker Literatur von Homer, Euripides
oder Aristophanes („Odyssee", „Die Troerinnen“, „Die Frösche")
entstehen. Mit dem Geschichtsschreiber Herodot identifiziert er sich
vielfach. Sein (unausgeführter) Entwurf für die Münchner Olympiade 1972
mit einer „Kouros"-Figur steht sinngemäß für Kunst und Sport.
Kokoschka hat unzählige Porträts von Künstlern, Wissenschaftlern,
Unternehmern und Politikern geschaffen. In der Nachkriegszeit wird er
zu einem der gefragtesten Porträtmaler, darunter Politiker wie der
österreichische Bundespräsident Theodor Körner, der deutsche
Bundespräsident Theodor Heuss sowie die deutschen Kanzler Konrad
Adenauer und Helmut Schmidt. Im Zyklus „Jerusalem Faces" porträtiert er
politische und religiöse Vertreter (u.a. Golda Meir, Teddy Kollek).
Anregende Gespräche um Frieden, Humanismus und Kunst finden dabei statt.
Kokoschka ist stets viel gereist. Auch in den mittleren und späten
Lebensjahren malt er zahlreiche, sehr bekannte Städtebilder. Er wählt
dabei oft verschiedene, aber immer erhöhte Standpunkte für seine
Motive. Es wäre nicht Kokoschka, wenn nicht auch auf vielen dieser
Bilder (politische) Botschaften mitschwingen würden, so etwa bei der
wiedereröffneten Wiener Staatsoper, einem Symbol österreichischer
Identität. Das Berliner Bild entsteht genau fünf Jahre nach dem
Berliner Mauerbau. Was auf den ersten Blick wie ein Fisch-Stillleben
(1962) aussieht, entpuppt sich als Reaktion auf eine
Hochwasserkatastrophe in Hamburg („Sturmflut").
OSKAR KOKOSCHKA - Die frühen Jahre
Zeichnungen und Aquarelle ausgewählt von SERGE SABARSKY, New York
Historisches Museum der Stadt Wien, Karlsplatz 2. Dezember 1982-30.
Jänner 1983 Di., Mi., Fr. 10-16, Do. 10-19, Sa. 14-18, So., Fei. 9-17
25. 12. 1982 und 1. 1. 1983 geschlossen.