web steiner
Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen
Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.
+43/2624/54014 - office@websteiner.com
Schloss Pöggstall
Pöggstall, September 2023
Das Kulturjuwel, eine ehemalige Wasserburg, stammt aus dem mittleren 13. Jahrhundert und wurde für die Landesausstellung 2017 renoviert. Ausstellungen „Schloss Pöggstall – zwischen Region und Kaiserhof“, Museum für Rechtsgeschichte, Folterkammer, Franz-Traunfellner-Dokumentation.

Um 1480 ließ Caspar von Rogendorf beim Schloss die Sankt-Gilgen-Kirche
als Schloss- und Begräbniskirche errichten. In der Reformationszeit
diente die zweischiffige spätgotische Hallenkirche mit geradem
Chorabschluss als protestantisches Bethaus. 1659 wurde das Gotteshaus
in feierlicher Zeremonie der Öffentlichkeit für den katholischen
Gottesdienst zugänglich gemacht. Nach Auflassung der Pfarrkirche St.
Anna im Felde wurde die Schlosskirche 1810 zur Pfarrkirche erhoben, der
hl. Anna geweiht und mit einem neugotischen Turm versehen. Die Kirche
birgt bedeutende Werke der Spätgotik: Hochaltar mit bemalten Flügeln
und einer Kreuzigungsgruppe im Schrein, Maria mit dem Kind,
Figurengruppe „Anna Selbdritt“, Westempore mit Seccomalereien, hölzerne
Seitenemporen, Ratsherrenstühle u. a. An der südlichen Außenwand
befindet sich ein mächtiges Sankt-Christophorus-Fresko.

Der zweischiffige und dreijochige Hallenraum verfügt über
Netzrippengewölbe auf zwei mächtigen Bündelpfeilern über niedrigen
Sockeln mit profilierten, spitzbogigen Scheidebögen, die an der Ost-
und Westwand konsolartig abgestuft sind. Die gemauerte,
netzrippenunterwölbte Empore aus dem Jahr 1480 nimmt das halbe Westjoch
ein. Sie ist in vier gleich breiten, auf Achtseitpfeilern ruhenden,
profilierten Spitzbogenarkaden zur Halle hin geöffnet. Ihre gemauerte
Brüstung ist in quadratische Felder unterteilt und mit bedeutenden
Seccomalereien geschmückt. Über dem Mittelpfeiler befindet sich eine
profilierte, polygonale Konsole und eine seichte Rechtecknische.
Oberhalb der seitlichen Pfeiler liegen ausschwingende Konsolen mit
Stabprofil. Die entlang der Seitenwände des Langhauses verlaufenden
Holzemporen sind durch Rechteckfelder gegliedert und im Norden mit
reichem, unterschiedlich durchbrochenem, geschnitztem Blendmaßwerk und
einem gemalten Wappenschild Rogendorf aus dem vierten Viertel des 15.
Jahrhunderts versehen. Die Emporen im Süden sind mit stilisierten
Pflanzenornamenten und zwei Wappen versehen. In der Mitte der Westwand
erhebt sich ein vorspringender Wandpfeiler. Daran ist nördlich oberhalb
der Empore ein runder Treppenturm mit Rechteckportal in durchkreuzter
Stabrahmung angesetzt.
An der Nordseite führt ein Rechteckportal zur tonnengewölbten
Sakristei. Darüber wurden um 1900 drei spitzbogige Oratoriumsfenster
mit einer gemeinsamen Sohlbank eingebaut. In einem der südlichen
Langhausfenster sind zwei mittelalterliche Glasfenster erhalten, die
1984/1985 restauriert wurden. Die Darstellung der beiden Apostel
(rechts ist der hl. Johannes erkennbar) entstand um 1400, die des hl.
Wolfgang wurde um 1450 geschaffen.

Der Hochaltar ist ein bemerkenswerter spätgotischer Flügelaltar aus der
Zeit um 1490. Er hat einen rechteckigen Schrein mit Rankenschnitzereien
Im Schrein befindet sich eine gotische Kreuzigungsgruppe, bestehend aus
dem Gekreuzigten, sowie aus Maria und Johannes unter dem Kreuz und drei
Engeln, die das Blut des Gekreuzigten auffangen. Diese
Kreuzigungsgruppe folgt dem um 1480 entstandenen Kupferstich von Martin
Schongauer. Die bemalten Flügel zeigen in geschlossenem Zustand die
acht Heiligen Georg, Vitus, Sebastian, Mauritius sowie Florian,
Ägidius, Leonhard und Achatius. In geöffnetem Zustand sind vier Szenen
der Passion Christi: Christus vor Pilatus, Dornenkrönung, Geißelung und
Ecce Homo zu sehen. An der bemalten Predella sind links und rechtes
Wappen der Familie Rogendorf zu sehen; auf den Tabernakeltüren außen
Maria und Johannes, innen Maria Magdalena und Maria Salome.

Pfarrkirche hl. Anna, vormals Schlosskapelle hl. Ägidius, Einblick nach
Westen: Die zweischiffige Hallenkirche mit geradem Ostabschluss wurde
um 1480/90 erbaut. Reich profilierte Bündelpfeiler bzw. Konsolen tragen
spätgotische Netzrippengewölbe.
Auf der Mittelkonsole der Westempore befindet sich eine
Herz-Jesu-Statue vom Anfang des 20. Jahrhunderts; an den
Emporenpfeilern die gotischen Statuen des hl. Leopold und des hl.
Erzengels Michael (um 1500), unter der Empore die Hll. Antonius Eremita
und Wendelin aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts.

Die beiden neugotischen Seitenaltäre stellen die „Enthauptung der hl.
Barbara‘“ und die „Krönung Mariens“‘ dar. Die rundbogig geschlossenen
Bilder (Georg Srna, 1847) sind von Säulen und Fialen flankiert, ein
Kielbogen mit eingeblendetem Maßwerk, Krabben und Kreuzblume schließen
den Aufbau ab. In den Tabernakeln werden jetzt die Heiligen Öle bzw.
ein schönes Kreuzreliquiar (1749) aufbewahrt.

Zur weiteren Ausstattung zählen unter anderem 14 Kreuzwegbilder, das
Chorgestühl aus dem Jahr 1492, ein Weihwasserbecken aus dem Jahr 1659,
zwei Vortragestangen aus dem 18. Jahrhundert und eine Glocke aus dem
14. Jahrhundert. Die 14 Kreuzwegbilder entstammen der Schule des Kremser Schmidt und werden Johann Georg Wambacher zugeschrieben (um 1780).

Der Hochaltar (um 1490) ist ein
herrlicher Flügelaltar, der die Passion Christi zum Inhalt hat und
besonders die um diese Zeit verbreitete Heilig-Blut-Verehrung betont.
Die Kreuzigungsgruppe im Schrein folgt dem um 1480 entstandenen
Kupferstich von Martin Schongauer. Die christliche Blutmystik der
Engel, die das Blut des Gekreuzigten auffangen, ist in Beziehung
gesetzt mit den Weintrauben und -ranken im Schleierbrett. Die
Schreinflügel zeigen geöffnet vier Szenen aus der Leidensgeschichte
(Jesus vor Pilatus, Dornenkörnung, Geißelung, Pilatus führt Jesus vor
das Volk), in geschlossenem Zustand acht männliche Heilige (Vitus,
Georg, Mauritius, Sebastian, Ägidius, Florian, Achaz, Leonhard). Auf
den Tabernakeltüren sind Maria und Johannes dargestellt, rechts und
links davon das Wappen der Rogendorfer.
Links vom Hochaltar befindet sich ein weiteres bedeutendes Kunstwerk
aus der Gotik: Maria mit dem Kind, auf der Mondsichel stehend mit
kleinen Engeln zu ihren Füßen (um 1480, Abb. S. 13). Beachtenswert sind
die Perlenkette im Haar der Gottesmutter und die Korallenkette
(„Fraisenkette“) des Kindes.
Rechts vom Hochaltar steht auf einem Postament die spätgotische
Figurengruppe „Anna Selbdritt“ (hl. Mutter Anna mit der erwachsenen
Maria, dazwischen das Jesuskind, um 1480).

Die Orgel wurde 1996 von Sebastian Blank neu gebaut. Sie besitzt 2
Manuale (Rückpositiv und Hauptwerk) und Pedal mit insgesamt 20
Registern und wurde 2010 nach Pilzbefall saniert.

Das Weihwasserbecken beim Haupteingang stammt aus dem Jahr 1659.

Schloss Rogendorf in Pöggstall blickt auf eine etwa 750-jährige
Geschichte mit wechselnden Besitzern zurück. Ebenso lange wird an der
Anlage schon gebaut - zuletzt erfolgte eine Adaptierung im Vorfeld der
Niederösterreichischen Landesausstellung 2017. Vom Bergfried, dem
ältesten Teil, bis hin zum Lifteinbau der Gegenwart entspricht jede
Umgestaltung einem veränderten Nutzungskonzept für das Gebäude. Vor den
jüngsten Bauarbeiten wurde die vielschichtige Geschichte des Schlosses
erstmals wissenschaftlich bearbeitet. Die Ausstellung gibt einerseits
einen Überblick über die sich wandelnden Vorstellungen der Pöggstaller
Schlossherren von zeitgemäßem und repräsentativem Wohnen. Sie
veranschaulicht jene Bauphasen, die am nachhaltigsten zur Entwicklung
des heutigen Ensembles beigetragen haben. Andererseits wird ein Blick
über die Schultern der an der Dokumentation beteiligten Fachleute
geworfen. Ob Bauforschung und Geschichtswissenschaft, Kunstgeschichte
und Archäologie, Konservierung und Restaurierung: Methoden und
Arbeitsfelder verschiedener Disziplinen werden ebenso vorgestellt wie
die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Restaurierung eines
kulturhistorisch bedeutenden Baudenkmals.

"Schloss Pöggstall - zwischen Region und Kaiserhof'
Diese Ausstellung widmet sich in der Barbakane (Rondell) den
sensationellen Erkenntnissen, die bei der Generalsanierung im Zuge der
NÖ Landesausstellung 2017 zu Tage traten - die gesamte neu entdeckte
Baugeschichte - von Anbeginn des Baus bis hin zu den Um- und Ausbauten
der jeweiligen Besitzer.
Schloss Pöggstall ist 750 Jahre alt. Das Schloss hat in dieser Zeit
verschiedenen Familien gehört. Die Familien haben das Schloss immer
wieder umgebaut und anders genutzt. In dieser Sonder-Ausstellung finden
Sie Antworten auf die Fragen: Wem hat das Schloss gehört? Wann hat man
die einzelnen Schloss-Teile gebaut und umgebaut? Wofür hat man das
Schloss genutzt? Wie untersucht man die Geschichte von Gebäuden?
Die Niederösterreichische Landes-Ausstellung im Jahr 2017 ist eine gute
Gelegenheit für die Erforschung von Schloss Pöggstall gewesen. Denn
dafür hat man die Gebäude renovieren müssen. Dabei haben
Wissenschaftler aus mehreren Fach-Bereichen die Gebäude genau
untersucht. So haben sie herausgefunden, wie sich das Schloss im Lauf
der Zeit verändert hat. In dieser Sonder-Ausstellung können Sie auch
sehen, wie Expertinnen und Experten für Bau-Forschung, Geschichte und
Kunst-Geschichte arbeiten. Außerdem erfahren Sie, was man alles
beachten muss, wenn man wertvolle alte Gebäude renoviert.

Andachtsbild Kaspars von Rogendorf (Trinitarische Marienkrönung)
Tempera auf Holz, 1493 (Reproduktion) Rosenburg, Renaissanceschloss Rosenburg
Kaspar von Rogendorf kniet mit seiner ersten Frau Margarete von
Wildhaus (gest. 1492) und den gemeinsamen Kindern im Gebet vor der
Gottesmutter. Diese wird von den drei Personen Gottes - Vater, Sohn und
Heiliger Geist, als männliche Figuren wiedergegeben - gekrönt. Von den
fünf abgebildeten Söhnen Kaspars überlebten nur drei den Vater um mehr
als ein Jahr. Dessen prunkvoller Harnisch erinnert an ein ähnliches
Exemplar für Kaiser Maximilian I. Ursprünglich befand sich das
Tafelbild auf der Empore der Pöggstaller Schlosskapelle. 1869 gelangte
es über Umwege auf die Rosenburg.

Porträts der Brüder Wolfgang (links) und Georg von Rogendorf (rechts)
Kopien zweier 1540 bzw. 1541 datierter Tafelbilder, Tempera auf Holz,
2. Hälfte 16. Jh. (Reproduktion) Eferding, Schloss Starhemberg
Einer oberösterreichischen Sammlung entstammen die Kopien zweier
großformatiger, offenbar als Gegenstücke entstandener Porträts der
Brüder Wolfgang und Georg. Sie sind mit 1540 bzw. 1541 datiert. Mit den
auf den Rahmeninschriften angeführten Lebensdaten der Dargestellten ist
das allerdings nicht vereinbar - zudem starb Georg in der ersten
Jahreshälfte 1537.

Porträtbüste Georgs von Rogendorf
Nachbildung, 2017; Original: Sandstein, verloren, 1536 (R) Schallaburg, Schallaburg Kulturbetriebsges.m.b.H.
Eine Sandsteinbüste Georgs von 1536 ging um 1995 bei Umbauten des
Mährischen Landesmuseums in Brünn verloren. Dorthin war sie vermutlich
über die Herrschaft Raitz/Rajec gekommen, die im 17. Jahrhundert an die
Rogendorfer gelangte. Einem Foto aus den 1990ern zufolge wies die Büste
Schäden im Gesicht auf. Sie wurde auf Grundlage des Porträts von Georg
rekonstruiert.
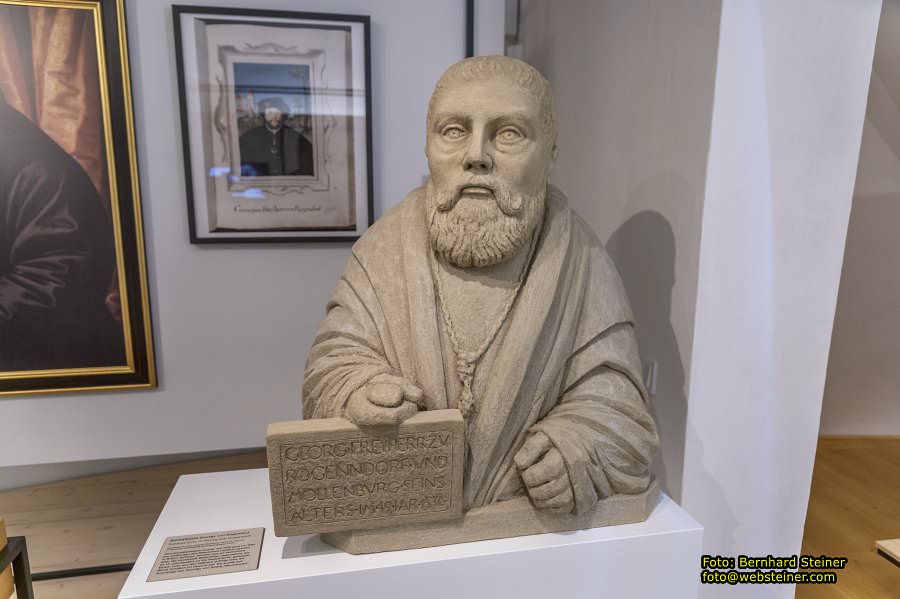
Die älteste Urkunde, die einst im Archiv des Schlosses Pöggstall
aufbewahrt wurde, stammte vom 8. September 1255. Ausgestellt hatte sie
Přemysl Otakar II., König von Böhmen, der auch als österreichischer
Landesfürst regierte. Die Urkunde dürfte die Belehnung der
Landherrenfamilie der Maissauer mit den Herrschaften Pöggstall, Horn,
Staatz und Ottenschlag zum Inhalt gehabt haben. Otto von Maissau zählte
von etwa 1251 bis zu seiner Entmachtung 1265 zu den politisch
einflussreichsten Adeligen Österreichs. Unmittelbar nach dem Erwerb der
Herrschaft scheint er mit der Errichtung einer neuen Burg in Pöggstall
begonnen zu haben.

Die ältesten Bauteile der Pöggstaller Burg sind im Bereich des oberen
Burghofes erhalten - wie etwa der romanische Bergfried, der
ursprünglich nur durch einen Hocheingang im 1. Obergeschoß zugänglich
war. Noch heute führt die in der Außenmauer gelegene Stiege bis in das
abschließende Zinnengeschoß. Als zusätzliches Wehrelement besaß der
Bergfried einen hölzernen Außenwehrgang, der aber bereits im 15.
Jahrhundert abgetragen wurde. Die spätromanische Mantelmauer ist nur
mehr an der Ostseite mit vermauerten Zinnen und somit in originaler
Höhe vorhanden. Im Zuge barocker Bautätigkeit wurde der südliche Teil
der Mantelmauer mit dem spätromanischen Burgtor entfernt, um einen
größeren Hof zu schaffen.

Bald nach 1300 nahm eine Vergrößerung der Burg nach Süden ihren
Ausgang. In zumindest zwei Bauphasen wurde die umbaute Grundfläche
nahezu verdoppelt. Das neue Areal war von einer hohen Ringmauer
umschlossen. An der West- und Südseite entstanden Wohnbauten, an der
Ostseite lag vermutlich die Burgküche. In der südöstlichen Ecke wurde
erst nachträglich ein mächtiger Torturm hochgezogen. Zeitgleich mit der
Burg wuchs auch der Ort, der bald nach 1400 als Markt bezeichnet wurde.
Pöggstall bildete das Zentrum eines ausgedehnten Landgerichtsbezirks.
Aus dem späten 14. Jahrhundert sind auch die Namen jener
Funktionsträger überliefert, die im Burgareal im Namen der Herrschaft
Recht sprachen.
Bis in die Mitte des 14. Jahrhunderts galt das Interesse der Maissauer
vor allem dem Horner Becken als der Basis ihrer Besitzungen. Nach dem
Aussterben der Dürnsteiner Kuenringer nahmen sie deren Machtposition in
der Wachau ein. Vielleicht aufgrund dieser Neuorientierung gewannen
auch die maissauischen Herrschaften im Südlichen Waldviertel neue
Bedeutung vor allem Pöggstall. Offenbar machten von da an Angehörige
der Familie, etwa Konrad von Maissau (gest. 1396) und später sein Sohn
Otto (IV., gest. 1440), Pöggstall zu ihrem persönlichen Wohnsitz. Die
Komfortansprüche der Burgherren erforderten nun einen zeitgemäßen
Ausbau der Burganlage.
Kaspar von Rogendorf war es ein großes Anliegen, seinen Herrschaftssitz
der Weiterentwicklung von Belagerungsgeschützen anzupassen. Er ließ
Erdwerke anlegen und an der Westseite einen Portalturm errichten, von
dem aus diese über eine Brücke zugänglich waren. Zudem investierte er
in die repräsentative bauliche Ausgestaltung der Burg. So entstand etwa
im Westtrakt eine Halle mit Netzrippengewölbe. Östlich der Burg ließ er
eine monumentale Schlosskapelle - die heutige Pfarrkirche - errichten,
die das hohe Selbstbewusstsein und den Wohlstand des Bauherrn
verdeutlicht.

Schon 50 Jahre nach dem Bau war die Burg zu klein. Die Besitzer haben
die Burg mindestens 2 Mal umgebaut und vergrößert. Auch der Ort
Pöggstall ist gewachsen und wichtiger geworden. Dann ist Pöggstall
sogar das Zentrum von einem großen Land-Gerichts-Bezirk geworden. Das
heißt: Dort haben Gerichts-Verhandlungen stattgefunden. Nach den
Umbauten war die Burg etwa doppelt so groß wie vorher. Eine hohe Mauer
hat die neue Anlage vor Feinden geschützt. Direkt an der Mauer hat es
Wohn-Bauten gegeben, und wahrscheinlich war im Osten die Burg-Küche.
Auch der Tor-Turm war neu. Über das Land-Gericht sind genaue Unterlagen
erhalten geblieben. Darin stehen die Namen der Männer, die als Richter
tätig waren. Die Männer haben als Vertreter der Herrscher entschieden,
ob jemand ein Verbrechen begangen hat oder nicht. Die Männer haben auch
entschieden, wie ein Verbrecher bestraft werden sollte.
Wie die archäologischen Untersuchungen ergaben, wurde der romanischen
Burg um 1300 ein gotischer Zwinger vorgelagert. Dieses offene, von
Mauern begrenzte Areal sollte die Wehrhaftigkeit erhöhen. Im weiteren
Verlauf entstand eine aufwendige Vorburg mit zeitgemäßen Wohngebäuden,
die das gestiegene Interesse der Maissauer an ihrem Herrschaftssitz
belegen. In dieses Ensemble wurde nachträglich ein mächtiger Torturm
eingestellt, dessen Obergeschoße im späten 19. Jahrhundert abgetragen
wurden. Reste seines gotischen Mauerwerks liegen im Dachraum des
Südtraktes frei.

Zur Baugeschichte von Schloss Pöggstall - Arkadenhof
Unter Wilhelm von Rogendorf entstand um 1530/40 der ehemals
vierflügelige zweigeschoßige Arkadengang im Bereich des unteren
Burghofes. Er wird über einen Wendeltreppenturm mit reich gestaltetem
Renaissanceportal erschlossen. Im Auftrag seines Sohnes Christoph
entstanden 1546 die qualitätsvollen Malereien Pietro Ferraboscos, die
in den 1990ern freigelegt wurden. Sie imitieren eine in
verschiedenfarbigem Steinmaterial gefertigte und mit figuralem sowie
vegetabilem Dekor besetzte noble Renaissancefassade.

Der aus der Steiermark stammende Kaspar von Rogendorf (gest. 1506)
diente Kaiser Friedrich III. als Söldnerführer und Rat. Zuletzt
bekleidete er als Küchenmeister an dessen Hof ein prestigeträchtiges
Amt. Unter Maximilian I. gehörte er zu den führenden Finanzfachleuten
der österreichischen Zentralverwaltung. Im Südlichen Waldviertel schuf
Kaspar einen dichten Besitzkomplex. Schloss Pöggstall, 1478 erworben,
ließ er zu einer modernen Residenz zwischen Region und Kaiserhof
umgestalten. Mit seinem Sohn Wilhelm (gest. 1541) setzte sich der
Aufstieg der Familie fort: Er wurde erster Obersthofmeister Ferdinands
I. und einer der engsten Ratgeber des Hauses Habsburg. Eindrücke aus
den kulturellen Zentren der Niederlande und Oberitaliens, die er als
kaiserlicher Statthalter und Oberstfeldhauptmann kennengelernt hatte,
flossen in den Pöggstaller Bau ein. Wilhelms Sohn Christoph, der 1537
zum Reichsgrafen erhoben wurde, pflog einen luxuriösen Lebensstil.
Dieser endete mit einem Bankrott und der skandalumwitterten Desertion
in das Osmanische Reich 1546. Die Rogendorfer waren nicht nur für etwa
120 Jahre Inhaber der Herrschaft Pöggstall, sie übertrugen auch ihren
Namen auf das Schloss, das sein heutiges Erscheinungsbild weitgehend
ihnen verdankt.
Im letzten Viertel des 15. Jahrhunderts stellte ein Besitzerwechsel die
Weichen für eine weitreichende Umgestaltung, die sich über 60 Jahre
erstreckte. Drei Generationen der neuen Inhaberfamilie betätigten sich
als Bauherren. Ihre Erfahrungen aus dem habsburgischen Kriegsdienst
flossen in eine Neukonzeption des Befestigungs- und
Verteidigungssystems der alten Burganlage ein. Auch die Wohnbauten
wurden mehrfach neu gestaltet, um den Vorstellungen der weltläufigen
und kunstbegeisterten Besitzer zu entsprechen. Aus der
mittelalterlichen Burg Pöggstall wurde so ein spätmittelalterliches
Burgschloss und schließlich ein Renaissanceschloss, bei dem die
tatsächliche Wehrhaftigkeit kaum mehr eine Rolle spielte. Fürstliche
Anlagen dieser Zeit wirkten offenkundig inspirierend: Standen anderswo
auf dem flachen Land Profan-, Wirtschafts- und Sakralgebäude kaum
verbunden nebeneinander, verdichtete sich die Pöggstaller Anlage nun zu
einer eindrucksvollen geschlossenen Residenz. Schloss „Rogendorf in
Pöggstall", wie es nach den Inhabern genannt wurde, bildete das Zentrum
des gleichnamigen Marktes und stellte um 1550 ein weitum einzigartiges
Beispiel modernster Herrschaftsarchitektur dar.

Im Jahr 1478 hat die Familie Rogendorf das Schloss Pöggstall gekauft.
Der neue Besitzer war Kaspar von Rogendorf. Kaspar, seine Söhne und
seine Enkel haben das Schloss ganz neu gestaltet. Sie haben aus der
Mittelalter-Burg ein prachtvolles Schloss gemacht. Schloss Pöggstall
hat gar nicht wie ein normales Schloss auf dem Land gewirkt. Es hat
mehr wie ein teures Schloss in einer modernen Hauptstadt ausgesehen.
Die Familie Rogendorf stammt
aus der Steiermark. Kaspar von Rogendorf hat für den Kaiser gearbeitet.
Im südlichen Waldviertel hat ihm viel Land gehört. Im Jahr 1478 hat er
Schloss Pöggstall gekauft. Seit damals heißt das Schloss auch Schloss
Rogendorf. Das Schloss hat der Familie Rogendorf etwa 130 Jahre lang
gehört Kaspar von Rogendorf hat Schloss Pöggstall zum Familien-Wohnsitz
gemacht. Sein Sohn Wilhelm von Rogendorf war der Vertreter des Kaisers
in den Niederlanden und in Italien. Dort hat er fremde Kulturen kennen
gelernt. Wilhelm hat Kunst und Kultur nach Schloss Pöggstall gebracht.
Nach Wilhelm hat sein Sohn Christoph das Schloss geerbt. Er hat vom
Kaiser sogar den Titel Reichs-Graf erhalten. Christoph hat zu viel Geld
ausgegeben und ist pleite gegangen. Dann ist er in die Türkei
geflüchtet. Schloss Pöggstall hat aber weiter der Familie Rogendorf
gehört. Erst nach dem Jahr 1600 hat die Familie das Schloss verkauft.

Die Malereien des Arkadenhofes von Schloss Pöggstall wurden im Rahmen
einer Lehrrestaurierung durch das Bundesdenkmalamt freigelegt. Fünf in-
und ausländische Universitäten waren daran beteiligt. Dadurch konnten
das Wissen, die Technik und das Handwerk an die Forscher und
Restauratoren von morgen weitergegeben werden. Das Bundesdenkmalamt
kommt hier mit seiner Fachabteilung für Restaurierung und Konservierung
sowie dem dazugehörigen naturwissenschaftlichen Labor auch der
Vermittlung und Weiterbildung nach - neben seiner Aufgabe, das
kulturelle Erbe zu erforschen, zu schützen und zu pflegen.
Wilhelm trat in die Fußstapfen seines baufreudigen Vaters Kaspar. Auf
ihn gehen die Malereien in einem spätgotischen Festsaal zurück, deren
Reste im Dachraum des Südtraktes freiliegen. In einer weiteren Bauphase
entstanden ab den 1530er-Jahren die Arkadengänge des großen Burghofes.
Sie wurden über einen neuen Wendeltreppenturm mit aufwendig gestaltetem
Renaissanceportal erschlossen. Herausragende Visitenkarte von Wilhelms
Bautätigkeit ist das italienischen Vorbildern folgende große Rondell
(Barbakane), das vermutlich auch auf Anregungen Albrecht Dürers
zurückging. Der repräsentativ-funktionelle Wehrbau wurde 1548 erstmals
als „newe passtey" genannt und diente auch als Stall für die edlen
Rösser des Feldherrn.
Graf Christoph strebte nach architektonischer Innovation und
Repräsentation. Für die Umsetzung sorgten namhafte italienische
Künstler und Handwerker. Obwohl die Last der Schulden immer größer
wurde, ließ Christoph die von seinem Vater Wilhelm begonnenen
Bauprojekte fertigstellen, zahlreiche bauliche Adaptierungen ausführen
und die Fassaden des Schlosses neu gestalten. Seine bedeutendste
Hinterlassenschaft stellt jedoch die 1546 erfolgte malerische
Ausgestaltung des Arkadenhofes dar, die von bemerkenswerter Qualität
ist. Sie schuf der auch am königlichen Hof tätige Meister Pietro
Ferrabosco.

Die Rogendorfer räumten Kunst
und Architektur einen hohen Rang ein - darin brachten sie nicht zuletzt
ihre Stellung zum Ausdruck. So ließ Kaspar die an Sakralbauten Kaiser
Friedrichs III. orientierte Kapelle mit modernen Altar- und anderen
Bildern ausstatten. Sein Sohn Wilhelm hielt mit Künstlern wie Albrecht
Dürer Kontakt. Die Brüder Wolfgang und Georg wiederum gaben mehrere
Porträts in Auftrag. Zudem setzten sie der Familie mit den nahen
Schlössern Ottenschlag und Mollenburg weitere Denkmäler. In den 1520ern
entstand in Pöggstall eine Sammlung vom damals innovativen Typ der
fürstlichen Kunst- und Wunderkammer. Die Kunstpatronage der Rogendorfer
hatte somit weit überregionales, europäisch-höfisches Format.
Bald nach 1610 wechselte Pöggstall neuerlich seinen Besitzer. Eine
Generalsanierung des Schlosses folgte. Dabei wurde die Außenmauer des
Rondells erhöht und an der Südwestecke ein neuer Baukörper errichtet.
Dieser verband die dem Markt zugewandte südliche Schauseite mit dem
westseitigen Torbau aus dem späten 15. Jahrhundert. Durch eine
einheitliche Sgraffito-Gliederung wurden die Außenfassaden
zusammengefasst. Auch im Inneren setzte man neue Akzente, etwa durch
eine moderne Stuckdecke, die nun den Kaisersaal so sein heutiger Name
schmückte. Mehrere Bestattungen von Familienmitgliedern in der Gruft
der Schlosskapelle unterstreichen die starke persönliche Bindung der
neuen Inhaber an ihr Schloss.
1601 trennten sich die Rogendorfer von ihrem ältesten Besitz in
Niederösterreich. Über Umwege gelangte Pöggstall 1610 als gleichsam
mündelsichere Anlage an die teils minderjährigen Erben Joachims von
Sinzendorf. Im Gegensatz zu den politisch hochaktiven Angehörigen
anderer Zweige ihrer Familie waren die neuen Inhaber von Pöggstall
wenig karrierebewusst. Sie engagierten sich lieber abseits des Hofes in
der Ausgestaltung ihres ländlichen Sitzes Pöggstall. Schon bald nach
dem Erwerb wurden nachhaltige Adaptierungsmaßnahmen gesetzt. Die
Sinzendorfer Herrschaft über Pöggstall endete Mitte des 18.
Jahrhunderts. Wieder einmal führte ein Bankrott dazu, dass der Besitz
in andere Hände überging.
Die baulichen Maßnahmen, die unter den Sinzendorfern
erfolgten, hatten die Modernisierung und Monumentalisierung der Anlage
zum Ziel. Durch Aufstockung des südwestlichen Baukörpers konnte eine
repräsentative Südfassade mit neuer Sgraffitogliederung geschaffen
werden, die ein mächtiges Dachwerk abschloss. Denselben Intentionen
dienten auch die Erhöhung des großen Rondells durch Übermauerung des
renaissancezeitlichen Zinnenkranzes und dessen Neufassadierung. Neben
den repräsentativen Fassaden belegt die mondän gestaltete Stuckdecke
des neuen Festsaales das künstlerische Selbstverständnis der neuen
Herrschaftsinhaber.

1795 erwarben die Habsburger die Herrschaft. Sie ließen schadhafte
Dachwerke reparieren und die Wirtschaftsgebäude im nördlichen
Schlosshof ausbauen. Baupläne von 1812 geben Aufschluss darüber, dass
Kaiser Franz I. die Räume des Südtrakts als Appartement nutzte. Zum
ersten Mal wurde das Gebäude nun Gegenstand historischer Betrachtung
durch seine Inhaber. Zur selben Zeit errichtete das Kaiserhaus in
Laxenburg einen romantischen Burgenneubau, in dem spätgotische
Holzteile aus Pöggstall verbaut wurden - „anonym", also ohne Verweis
auf ihre Herkunft. In Pöggstall dagegen erinnerte man bewusst an die
Rogendorfer: etwa in Form einer Sonnenuhr, in der die Wortdevise - der
Wahlspruch -Graf Christophs Platz fand.
Als die Habsburger 1795 das Schloss erwarben, befand es sich in
schlechtem baulichen Zustand. Zwei Jahrzehnte dauerte die
Generalsanierung, welche die Instandsetzung von Dachwerken, die
umfangreiche Schaffung und Adaptierung von Wohnraum sowie die
Neufassadierung der gesamten Anlage umfasste. In Erinnerung an die
Rogendorfer wurden zudem spätgotische Werksteine aus dem Südtrakt - wie
etwa die Portale im großen Rondell - hier wiederverwendet. Die zur
Pfarrkirche erhobene Schlosskapelle erhielt um 1800/10 ihren heutigen
in gotischen Formen erbauten Glockenturm.
1795 erwarb die k.k. Familiengüterdirektion Pöggstall als Teil eines
ausgedehnten Herrschaftskomplexes im Südlichen Waldviertel, den Joseph
Edler von Fürnberg aufgebaut hatte. Man erhoffte sich gute Geschäfte
mit Bau- und Brennholz in Wien - eine Idee, die aber nicht realisiert
wurde. Im Schloss inszenierte man den Bergfried im Sinn der Romantik
als „mittelalterliche" Folterkammer - sie fand im gleichzeitig erbauten
Verlies der Laxenburger Franzensburg ein unmittelbares Gegenstück. Die
Einrichtung der Folterkammer folgte jedoch pedantisch einem damals noch
eher modernen Vorbild: den Abbildungen in der Strafprozessordnung Maria
Theresias von 1768.
* * *
Franz Traunfellner Dokumentation - Leben und Werk des bedeutenden Künstlers stehen im Mittelpunkt der Dokumentation.

Franz Traunfellner (1913-1986) war ein Maler und Grafiker, dessen
Atelier sich in Gerersdorf bei Pöggstall befand. Die Franz Traunfellner
Dokumentation hat in vier Räumen des Schlosses Pöggstall einen würdigen
Rahmen gefunden und präsentiert in ansprechendem Ambiente, gestaltet
von Designerin Doris Zichtl, sowohl Druckgrafiken als auch Gemälde. Sie
folgt einem wohldurchdachten Ausstellungskonzept, das auch Aufschluss
über die Technik der Druckgrafik gibt. Werkzeuge, eine Tiefdruckpresse
und eine Lithopresse sowie ein Kurzfilm und Fotos erlauben Einblick in
das Umfeld, in dem Traunfellner gelebt hat.
Franz Traunfellner lebte auf einem kleinen Bauernhof in Gerersdorf bei
Pöggstall. Als Maler und Holzschneider Autodidakt, erlernte er die
Radiertechniken bei Professor Kromar von Hohenwolf (Melk) und die
Lithographie als Gastschüler der Graphischen Lehr- und Versuchsanstalt
in Wien. Ab 1963 lebte er als freischaffender Künstler.
Mitglied der Gesellschaft Bildender Künstler (Künstlerhaus) Wien, des
Kunstvereines Salzburg und anderer namhafter Kunstvereine. Werke unter
anderem im Besitz der Albertina Wien, der Österreichischen Galerie
Belvedere sowie in in- und ausländischen Sammlungen. Zahlreiche
Ausstellungen im In- und Ausland, Publikationen in Büchern, Rundfunk
und Fernsehen. Studienreisen in mehrere europäische Länder.
Verschiedene Ehrungen, darunter erster Kulturpreis des Landes
Niederösterreich 1960, Berufstitel Professor, Ehrenkreuz für
Wissenschaft und Kunst, Goldener Lorbeer des Künstlerhauses Wien.

Traunfellners Werk umfasst Zeichnungen, Aquarelle und Ölbilder, vor
allem aber Grafiken in den verschiedensten Techniken, wo vor allem
Holzschnitt und Holzstich besonders zu erwähnen sind. Mensch, Tier und
Natur, meist aus seiner näheren Umgebung, sind seine bevorzugten
Motive. Wenn Traunfellner der Landschaft als Maler und Holzschneider
antwortet, so dokumentiert er damit ihr Sinnbildhaftes, ihre Melodik,
ihre Schönheit und Kraft.

"Die Geschichte der Rechtsprechung mit Folterkammer"
Das "Museum für Rechtsgeschichte" lädt seine BesucherInnen mit einem
neuen wissenschaftlichen Konzept zur Vermittlung zum Thema
Rechtsprechung ein.
Die 1532 erlassene „Constitutio Criminalis Carolina" enthält einen Katalog von Leibesstrafen,
die nicht zum Tod führen sollten. Neben dem Ausstreichen mit Ruten sind
Verstümmelungen angeführt: Abschneiden der Zunge und der Ohren,
Abtrennen von zwei Fingern der rechten Hand. Zu den Leibesstrafen
zählten hier außerdem öffentliche Arbeit und der Verweis des „Leibes"
von einem bestimmten Ort oder des Landes. Als öffentliche Arbeiten
galten die „Wartung der Kranken" im Spital, das Kehren der Gassen,
Schanz- und Zuchthausarbeit. Verstümmeln wurde nur mehr als
Strafverschärfung vor einer Hinrichtung empfohlen. Die - stets in der
Öffentlichkeit vollzogene - Prügelstrafe konnte allein oder als
Verschärfung einer Haftstrafe sowie einer öffentlichen Arbeit verhängt
werden. Das Josephinische Strafgesetz setzte die Höchstzahl der Schläge
mit 100 fest.
Prügelbank, Preßburg, 18. Jh.
Prügelstrafen kamen sowohl bei Verurteilungen wegen Verbrechen als auch
bei Übertretungen zur Anwendung. Außerdem dienten die „Stock-,
Karbatsch- und Ruthenstreiche" dazu, Freiheitsstrafen zu verschärfen.
Bis 1848 praktizierte man Prügelstrafen, ehe sie kurzfristig
abgeschafft und dann wieder eingeführt wurden. 1867 verschwanden sie
endgültig aus dem Strafkatalog.

Zange zum glühenden Zwicken, 18. Jh.
Jenen, die sich einer besonders schändlichen Tat schuldig gemacht
hatten, drohten vor der Hinrichtung noch Strafverschärfungen: Man
schleifte sie zur Richtstatt, schnitt ihnen Riemen aus der Haut, riss
ihnen die Zunge heraus oder zwickte sie mit glühenden Zangen.
Zange zum Herausreißen der Zunge, Schlesien, 17. Jh.
Noch die „Constitutio Criminalis Theresiana" sah als strafverschärfende
Maßnahme vor einer Hinrichtung das Herausreißen der Zunge vor. Im
fünften Artikel heißt es unter § 3: „Bey diesen Todesstraffen kann nach
Maß der unterwaltend schwereren Umständen die Pein noch weiters [...]
durch Zungenabschneid [...] vermehret" werden.
Zange zum glühenden Zwicken, Scheibbs, 18. Jh.
Der Letzte, der vor der Hinrichtung noch mit glühenden Zangen gezwickt
wurde, war Franz von Zahlheim. Für einen „höchst abscheulichen
Meuchelmord" wurde der adelige Beamte 1786 in Wien durch Rädern
hingerichtet - und das, obwohl die Todesstrafe zu diesem Zeitpunkt
bereits abgeschafft war. Im Urteil heißt es: „auf den hohen Wagen
gesetzet, und ihm in die rechte Brust ein Zwick mit glühenden Zangen,
sodann auf der Freiung eben ein gleicher Zwick in die linke Brust
gegeben".

LEBENSSTRAFEN
Die Todesstrafen im Mittelalter standen aus heutiger Sicht in keinem
Verhältnis zur Schwere des Deliktes: So wurde etwa Diebstahl mit dem
Tod geahndet. In der Frühen Neuzeit reduzierte man die Vollzugsmethoden
auf Feuer, Rad, Schwert und Galgen. Bis dahin noch mögliche Strafen wie
das Einmauern bei lebendigem Leib wurden aus dem Strafkatalog
gestrichen. Allerdings hatte man diese Strafen auch zuvor nur selten
verhängt. Nach Maria Theresia waren nur mehr Hinrichtungen durch den
Strang üblich. Bis 1873 fanden sie in der Öffentlichkeit statt. 1919
wurde in Österreich die Todesstrafe im ordentlichen Verfahren
aufgehoben und durch lebenslangen schweren Kerker ersetzt. 1933 wieder
eingeführt, erfolgte 1950 ihre Abschaffung im ordentlichen Verfahren.
Im Verfassungsgesetz von 1968 verschwand sie mit dem Verbot von
Ausnahmegerichten aus der Gesetzgebung.
Richtschwert, 17. Jh. (?)
Die Klinge ist reich mit Barockornamentik und symbolischen
Darstellungen geschmückt: Auf einer Seite finden sich ein Richtrad und
ein Spruch, der durch häufiges Schleifen teils unleserlich ist:,,[...]
Das Schwert füer Ich in meiner Handt, Der Justitia Ich es gebrauch
[...]". Die andere Seite zeigt den Spruch,,Ein Unrechtes Und Gestolnes
Gut niemals Erspriessen tuet", darüber einen Galgen, dann den Spruch:
„Wer findt, ehe das der eine verliert, der Stirbt, Ehe das Er Kranck
Wirt."
Richtschwert des Jacob Beyer, 1737
Die Klinge zeigt in vergoldeter Ätzung auf einer Seite den Spruch:
„Wann dem Armen sünder wirdt Abgesprochen Dass leben, so wirdt Er Mir
unter meine handt gegeben". Darunter finden sich der Name Jacob Beyer,
die Jahreszahl 1737 und die Darstellung eines Bischofs. Auf der anderen
Seite ist zu lesen: „Hier Stehe ich, hoffe nebst godt zu Richten Recht,
Jesu Christe Du bist Richter und Ich der Knecht", darüber wieder der
Name, die Jahreszahl und eine Darstellung des heiligen Georg.
Richtschwert, 17. Jh.
Die Ätzung der Klinge weist typische Ornamentformen der Spätrenaissance
auf. Auf einer Seite findet sich der Spruch: „Wan ich dhue das Schwert
aufheben, so geb Got dem Sünder das ewige Leben". Die andere Seite
zeigt unter der Zeichnung eines Richtrads und Galgens den Spruch: „Et
verbum caro factum est." Am verlaufenden Ende der Blutrinne sind in
Kupfer der Reichsapfel und ein stehender Löwe eingelegt. Die
Klingenschmiedemarke stellt eine Biene dar.

FOLTERWERKZEUG
Schon die „Constitutio Criminalis Carolina" (1532) und die „Peinliche
Halsgerichtsordnung" Kaiser Ferdinands III. (1656) regelten den Ablauf
der Folter und die anzuwendenden Geräte bis ins Detail. Damit wollte
man der Willkür einzelner Scharfrichter und der Landgerichte vorbeugen.
Der Richter hatte zu kontrollieren, ob die vom Scharfrichter
verwendeten Werkzeuge auch rechtens seien. Die 1768 erschienene
„Constitutio Criminalis Theresiana" ergänzte den Wortlaut um präzise
bildliche Darstellungen. Detailgetreu sind die in Wien und Prag
anzuwendenden Peinigungsarten sowie die hierfür verwendeten
Gerätschaften mittels Bildern illustriert. Unterschieden wurden drei
Grade der Tortur: der Daumenstock (erster Grad), die Schnürung (zweiter
Grad) und das Aufziehen (dritter Grad). Die Beinschraube war nur
gelegentlich anzuwenden.
Beinschraube (Spanischer Stiefel), 17. oder 18. Jh.
Zwar waren der „Constitutio Criminalis Theresiana" Kupferstiche mit
der Darstellung der Beinschraube beigegeben. Sie stellte allerdings
keinen eigenen Grad der Tortur dar, sondern sollte nur als Ersatz für
ein anderes Martergerät dienen. Wie viele Rechtsvorgänge fand diese Art
der Folter Eingang in die Umgangssprache, und zwar in der Redewendung
„die Wadln viererichten“: Hierzulande heißt das nichts anderes, als
jemanden zur Vernunft zu bringen.
Daumen- und Fingerschrauben, 17. und 18. Jh.
Laut „Constitutio Criminalis Theresiana" bestand im Anlegen der
Daumenschrauben mit und ohne Anschlagen die erste Stufe der Folter. Bei
der im § 9 beschriebenen „Territion" (Androhung der Folter) zeigte der
Scharfrichter dem Delinquenten die Daumenschrauben zur Abschreckung.
„Jemandem die Daumenschrauben anlegen" ist noch heute eine
gebräuchliche Phrase, um auszudrücken, dass eine Person auf unangenehme
Art unter Druck gesetzt wird.

DIE GESCHICHTE DER FOLTER
Im Spätmittelalter begann die Obrigkeit, Straftaten aus eigenem Antrieb
zu verfolgen. Wurde der Täter nicht auf frischer Tat ertappt, benötigte
der Richter nun im Inquisitionsprozess für die Verurteilung ein
Geständnis. Lag kein solches vor, versuchte man, es durch Androhung
oder Anwendung von Folter zu erzwingen. Vom 16. Jahrhundert an
enthielten die gedruckten Strafgesetzbücher Artikel, die den Einsatz
der Folter und ihre Durchführung regelten. Die Tortur konnte bis zu
drei Mal in verschiedenen Härtegraden - wiederholt werden. 1776 hob
Kaiserin Maria Theresia die Folter de facto auf. Österreich war damit
nach Preußen (1756) der zweite Staat in Europa, der auf die Folter
verzichtete.
Mundbirnen
In den diversen Anleitungen zur Durchführung der Folter fanden die
Mund-, Graus- oder Folterbirnen keine Erwähnung als Folterinstrumente.
Sie dienten dazu, das Schreien während der Folter zu verhindern. Den
aus mehreren löffelförmigen Schalen beweglich zusammengesetzten Körper
steckte man der verdächtigen Person in den Mund und schraubte ihn dann
auf. Mundbirnen kamen im 18. Jahrhundert auch in der Psychiatrie zum
Einsatz, um die Patienten am Sprechen zu hindern.
Mundbirne mit Halsring
Nach Abschaffung der Folter 1776 blieb die Mundbirne im Strafvollzug
weiter in Gebrauch. Schreienden und tobenden Gefangenen wurde sie als
Zwangsmittel angelegt. Erst mit einem Erlass des Justizministeriums vom
3. November 1896 wurde die Verwendung der Mundbirne endgültig
abgeschafft.

SCHARFRICHTER - EIN HANDWERK
Was die Rolle des Scharfrichters oder „Freimannes" betraf, war die
Gesellschaft gespalten: Zwar benötigte sie seine Dienste, doch seine
Tätigkeit machte ihn zum Außenseiter. Er und seine Familie galten als
„Ehrlose" und waren bis zur Zeit Maria Theresias aus der Gemeinschaft
ausgeschlossen. Da seine Söhne kein Handwerk erlernen durften, traten
viele in die väterlichen Fußstapfen. So entstanden Dynastien von
Scharfrichtern. Wie Handwerker erlernten sie ihren Beruf, führten Buch
und stellten Rechnungen aus. Die Aufgaben des Freimannes waren
vielfältig: An den Verdächtigen vollzog er die Folter, die Verurteilten
musste er gemäß Urteil abstrafen, die Selbstmörder bestatten - ihnen
blieb ja ein kirchliches Begräbnis verwehrt. In manchen Herrschaften
lagen auch das Reinigen der Kloaken sowie die Verwertung und Entsorgung
der Tierkadaver in seiner Zuständigkeit. Im Geheimen bediente man sich
seiner Kenntnisse der menschlichen Anatomie auch bei schweren
Verletzungen oder Knochenbrüchen. Eine weitere Einnahmequelle bot der
Verkauf von Leichenteilen: In getrockneter und pulverisierter Form
spielten sie ebenso wie das Arme-Sünder-Fett eine wichtige Rolle in der
Volksmedizin.
Beinschraube (Spanischer Stiefel), 17. oder 18. Jh.
Eisenplatte und gebogene Eisenspange der Beinschraube wurden um den
Unterschenkel gelegt und mithilfe der seitlich angebrachten
Gewindestäbe immer stärker zusammengedreht. Durch Klopfen und
wiederholtes Anziehen der Schrauben ließ sich die Wirkung verstärken.
Die Landgerichtsordnung Ferdinands III. führte den Spanischen Stiefel
als vierten Grad der Folter an – einzusetzen bei Personen, die zu
schwach zum Aufziehen waren.
Finger- und Daumenschrauben, 17. und 18. Jh.
Die einfachen Finger- oder Daumenschrauben bestanden aus zwei
Eisenplatten, die an zwei, manchmal auch drei Schraubenspindeln
zusammengedreht wurden - dazwischen lagen die Daumen der beiden Hände.
Die Druckflächen waren oft rautenförmig eingefeilt, um den Schmerz zu
verstärken. Durch Klopfen, Lockern und Wiederanziehen der Schrauben
steigerte man die Wirkung. In der Landgerichtsordnung Ferdinands III.
waren die Daumenschrauben der dritte Grad der Tortur.

Schandmantel mit Schandkopf, Brunn am Walde, 18. Jh. (?)
Die verurteilte Person saß im Schandmantel am Pranger oder musste
diesen durch den Ort tragen. Manche erhaltene Exemplare weisen reiche
Bemalungen auf. Sie erzählen von den Verbrechen, für die jemand den
Schandmantel tragen musste. Es waren dies etwa kleine Diebstähle,
Schlägereien, Spielsucht, Trunksucht, Müßiggang oder Fluchen. Die
jeweils zutreffende Szene wurde dem Publikum zugewandt. So ersparte man
sich die Schandtafeln.

JEDEM BERUF SEINE STRAFE
Verstöße in Gewerbe und Handwerk ahndete die Obrigkeit mit großer
Strenge. Schuldigen drohten Geldstrafen, eine Beschlagnahme der
mangelhaften Ware, der Entzug des Gewerberechts, Schandstrafen oder
Stadtverweis. Für gewisse Berufsgruppen gab es eigene Strafen. Bäcker,
die zu kleine Brote gebacken hatten, wurden ab dem Mittelalter
mancherorts mit dem „Bäckerschupfen" belegt. In Wien fand die Prozedur
zunächst am Graben und am Neuen Markt statt, wo die Verkaufsstände der
Bäcker standen. Später verlegte man sie in die Roßau, an einen Nebenarm
der damals noch nicht regulierten Donau. Zum letzten Mal wurde dort
1773 ein Bäcker „geschupft". Kaiser Joseph II. schaffte diese Art der
Bestrafung ab.
Stuhl einer Bäckerwippe, Hainburg, 18. Jh. (?)
Die Konstruktion der Bäckerwippen erinnert an den Hebel eines Brunnens:
Dafür wurde ein Pfahl in den Boden geschlagen und daran ein beweglicher
Arm angebracht. An einem Ende hing ein Korb, ein Käfig oder ein Stuhl,
am anderen ein Stein, dessen Gewicht in etwa dem eines Menschen
entsprach. Mithilfe der Wippe wurde der Beschuldigte zum Gaudium der
Zuseher in Jauche, Kot oder einen Fluss getaucht. Die Strafe lässt sich
in unterschiedlicher Ausformung in nahezu allen Ländern Europas
nachweisen.

Schandmasken wurden aus
Eisenblech in den unterschiedlichsten Formen gefertigt. Inschriften auf
der Schandmaske nahmen auf die Tat Bezug. Schweinsrüssel, Pfeife oder
Glöckchen symbolisierten das Delikt des Trägers und verstärkten den
herabwürdigenden Charakter der Strafe. Die bestrafte Person hatte die
Maske, die Teile des Gesichts mehr oder minder stark umschloss, in der
Öffentlichkeit am Pranger oder - strafmildernd - zu Hause zu tragen.
Schandmaske mit Pfeiferl, Engelberg, Schlesien, 18. Jh.
Schandmaske in Form einer Teufelsfratze, Oberösterreich, um 1700
Schandmaske mit langem Rüssel, Niederösterreich, um 1700
Schandmaske mit Glöckchen, Stift Zwettl, 1755
Schandmaske in Form einer Teufelsfratze mit Pfeiferl, Schloss Plauder, Mähren, 18. Jh.
Schandmaske, vermutlich Bayern, 18. Jh.

Ehe 1787 das Josephinische Strafgesetz in Kraft trat, spielten Freiheitsstrafen
eine geringe Rolle. Die von Behörden der niederen Gerichtsbarkeit
verhängte Haft war nur von kurzer Dauer. Man leistete sie als
Hausarrest oder im Gemeindekotter ab. Darüber hinaus wurden in
Gefängnissen Beschuldigte während der Untersuchung und zum Tode
Verurteilte verwahrt sowie Landstreicher oder sonstige Angehörige von
Randgruppen vor ihrer Abschiebung festgesetzt. Als im Lauf des 18.
Jahrhunderts Zahl und Dauer der Haftstrafen stiegen, stand man vor
einem Problem: Es brauchte Gefängnisse. Doch dafür fehlte das Geld, und
so behalf man sich zunächst mit den vorhandenen Zucht- und
Arbeitshäusern - eine auf Dauer wenig zufriedenstellende Lösung. Das
Strafgesetz von 1803 schuf den Kerker als neuen Anstaltstypus. Er
sollte nur mehr verurteilte Verbrecher beherbergen.
Doppelschandfiedel, Mühlviertel, 18. Jh.
Mit dem Tragen dieses Instruments wurden zwei Personen bestraft, die
miteinander in Streit geraten waren meist Frauen. In die
Doppelschandfiedel eingespannt, standen sie einander gegenüber und
mussten sich während der Strafdauer ständig in die Augen schauen. Ob
das der verlangten Versöhnung förderlich war, sei dahingestellt...
Schandfiedel, Niederösterreich (?), 18. Jh. (?)
Das Tragen der Schandfiedel war eine typische Frauenstrafe, die in den
niederösterreichischen Weistümern erstmals 1579 für Drosendorf belegt
ist. Hals und Hände wurden eingespannt, ehe die Verurteilte einige
Stunden am Pranger ausgestellt oder vom Gerichtsdiener durch den Ort
geführt wurde.

Bagsteine, Niederösterreich (?), 17./18. Jh.
Geringfügige Vergehen ahndete die niedere Gerichtsbarkeit auch mit dem
Tragen des Bagsteins. Diese Ehrenstrafe traf vorwiegend Frauen, die
über andere lästerten. Die Verurteilte musste den schweren Bagstein,
der sonst meist am Pranger hing, durch den Ort tragen. In manchen
Weistümern wurde sogar der Weg dafür genau festgelegt. Er verlief
beispielsweise vom Pranger zum Haus der Bestraften.
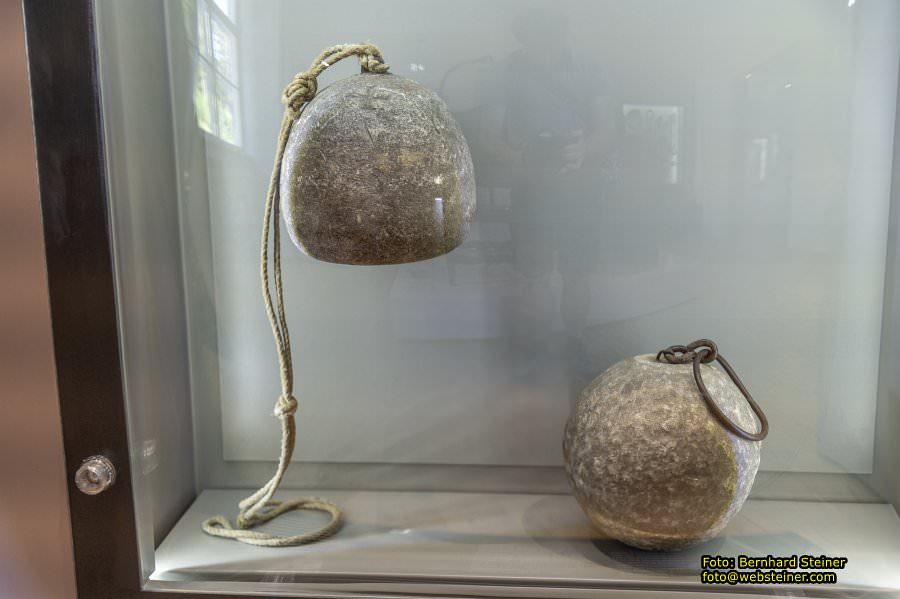
EHRENSTRAFEN
Bis in die Neuzeit hatte die Ehre hohen Stellenwert in der
Gesellschaft. Ihr Verlust wog schwer. Dem System der Ehrenstrafen kam
daher eine umso wichtigere Rolle zu: Sie wirkten ehrmindernd und
sollten so disziplinieren. Mit Ehrenstrafen geahndet wurden Raufhändel,
Trunkenheitsexzesse, Ehrenbeleidigungen oder Sittlichkeitsdelikte.
Männer verbüßten die Ehrenstrafe zumeist angekettet und mit einer
Schandtafel versehen am Pranger, der - als Plattform, Säule oder
Holzpfosten - an einem prominenten Platz im Ort stand. Mancherorts gab
es dafür auch das Schandeck an einem öffentlichen Gebäude. Straffällige
Frauen hingegen mussten mit dem Bagstein oder der Schandfiedel auf
einem festgelegten Weg durch den Ort gehen. Erst mit der
Strafrechtsreform von 1848 verschwanden Pranger und Ehrenstrafen aus
dem Gesetzbuch und damit aus dem Alltag der Menschen.
Schandmaske mit Federaufsatz, Niederösterreich (?), 17. Jh. (?)
Schandmaske mit kurzem Pfeiferl, Grafenegg, 17. Jh.
Schandmaske in Gitterform, Niederösterreich (?), 18. Jh. (?)
Schandmaske in Form eines Pappenheimer Helms, Niederösterreich (?), 17. Jh.

VERBRECHEN UND STRAFE
Die Strafe hatte vorrangig zwei Funktionen: Sie diente der Abschreckung
und sollte das verletzte Rechtsempfinden vergelten. Bis zum 10./11.
Jahrhundert bestanden Strafen vielfach in Geldleistungen. Ihre Höhe
richtete sich nach der Schwere der Tat und der Stellung des Opfers.
Fehlten dem Täter die Mittel, trat an die Stelle der Geldleistungen
eine Strafe an Leib und Leben oder der Verlust des Status als Freier.
Zunehmend verlor die Geldstrafe jedoch an Bedeutung. Nun kamen Strafen
zur Anwendung, die heute noch schockieren: Erhängen, Enthaupten,
Rädern, Verbrennen, Ertränken, Einmauern, Pfählen etc. Allerdings
schöpften die Richter das Strafausmaß häufig nicht aus: Gnade galt als
Stärke, nicht als Schwäche des Richters. Die Zahl der Hinrichtungen
nahm im Lauf der Frühen Neuzeit ab. Die Schaffung des „Rechtsstaats" im
18. Jahrhundert zielte auf Einheitlichkeit in der Straffestsetzung ab.
Die Josephinische Gesetzgebung nahm den Richtern freilich das
Gnadenmittel: Fortan mussten sie Strafen laut Gesetzbuch festsetzen.
Die Todesstrafe wurde abgeschafft, doch an ihre Stelle trat schwerste
körperliche Arbeit: In Bergwerken, auf Galeeren oder als Schiffszieher
an der Donau fanden die Delinquenten einen frühen Tod.
Die „Folterkammer"
Im ersten Obergeschoß des Bergfrieds liegt die sogenannte Folterkammer,
in die früher einzig ein Hocheinstieg führte. Die erhaltenen
Schlossinventare geben indes keinerlei Hinweise auf eine Folterkammer.
Erst 1882 taucht in den Pöggstaller Quellen die Bezeichnung
„Marterturm" für den Bergfried auf. Der Historiker Andreas Zajic nimmt
an, dass die „Folterkammer" im Zusammenhang mit den Aktivitäten Kaiser
Franz' II./I. stand: Ganz im Sinne des romantischen Burgenbaus ließ er
ja eine solche auch in der Laxenburger Franzensburg einrichten.
Gesichert ist hingegen, dass das Landgericht Pöggstall seit 1521,
vielleicht auch schon früher, die hohe Gerichtsbarkeit innehatte. Daran
knüpfte sich zumindest seit der „Carolina" (1532) die Verpflichtung, im
Gerichtsverfahren die „peinliche Frage" - also die Folter anzuwenden.
Welcher Raum in Schloss Pöggstall dafür bestimmt war, ist noch unklar.

Gerichtszeichen in Form eines Doppeladlers, Mannersdorf, 16. Jh. (?)
Alle mit Recht, Rechtsprechung und Vollzug verbundenen Handlungen,
Gerätschaften und Gebäude waren in der Vergangenheit von Symbolik
bestimmt. Zeichen markierten die Orte, an denen Recht verkündet und
gesprochen wurde.
Gerichtsschild, Grenzgebiet zu Mähren, Mitte 17. Jh.
Rolandfigur, Kopie, Original: St. Aegyd am Neuwalde, 16./17. Jh.
Den Pranger in St. Aegyd am Neuwalde 1886 zerstört und 1955 als
Rekonstruktion am Weg zur Kirche wieder aufgerichtet - krönt eine
Rolandfigur, die allerdings nur als Blechschnitt ausgeführt ist.
Benannt wurden diese Figuren nach dem sagenhaften Paladin Karls des
Großen. Ob die niederösterreichischen Rolande mit jenen in
Norddeutschland in Zusammenhang stehen, ist noch ungeklärt. Dort
dienten sie, freilich in monumentaler Form, als Zeichen der
Hochgerichtsbarkeit, des Markt- und Stadtrechtes oder anderer
Privilegien.

VOM WORT ZUR SCHRIFT
Recht wurde zunächst ausschließlich gesprochen - im wahrsten Sinne des
Wortes. Um die Rechtsprechung und den Verlauf der Verfahren zu
vereinheitlichen, begann man schließlich damit, das mündlich
weitergegebene Recht in Rechtsbüchern aufzuzeichnen. Das erste
Rechtsbuch in deutscher Sprache war der „Sachsenspiegel" (1220-1235).
Das „gesetzte" Recht konnten unterschiedliche Personen oder Gruppen
erlassen: Kaiser wie Fürsten, Kirche wie Grundherrschaft, Städte wie
autonome Verbände. Handelte es sich bei den frühen Rechtsbüchern noch
um private Aufzeichnungen, änderte sich das mit dem Ende des
Mittelalters: In „Landgerichtsordnungen" oder „Halsgerichtsordnungen"
wurden Straf- und Prozessrecht niedergeschrieben. Das 18. Jahrhundert
brachte schließlich länderübergreifende Ordnungen - und damit eine
Vereinheitlichung des Rechts.
„Bambergische Peinliche Halsgerichtsordnung"
Buchdruck, Bamberg, revidierte Fassung von 1580
Verfasser des 1507 erstmals im Druck erschienenen Rechtsbuches war der
Bamberger Hofrichter Johann von Schwarzenberg. An die Stelle der bis
dahin üblichen Privatklage trat nun die amtliche Untersuchung und
Strafverfolgung. Mit der Übernahme dieses Inquisitionsprinzips wurde
das Geständnis zum zentralen Beweismittel. Deshalb sah die
Halsgerichtsordnung auch die „peinliche" - die Pein verursachende -
Befragung als Mittel der Wahrheitsfindung vor. Allerdings war die
Anwendung der Tortur an strenge Voraussetzungen gebunden.
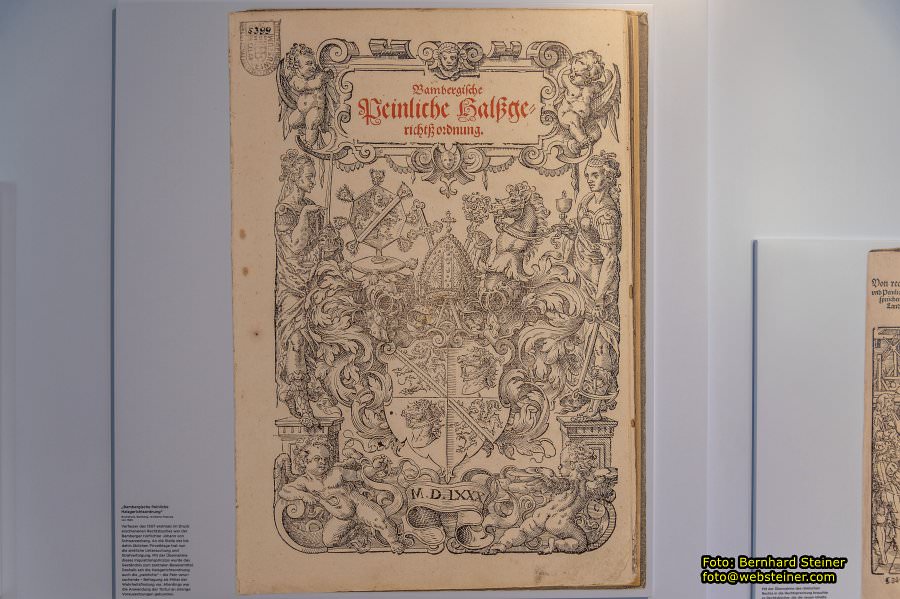
IM NAMEN DES GESETZES
Zu Beginn des Mittelalters hatte im heutigen Österreich eine Vielzahl
von Rechtsordnungen Gültigkeit. Einen Staat in unserem Sinn und
rechtsprechende Instanzen gab es noch nicht. Das einzige Mittel, seine
Ansprüche durchzusetzen, war die Selbsthilfe. Um Unruhen zu verhindern,
bildete sich ein geregeltes Verfahren für die Verfolgung von
Rechtsverletzungen aus. Noch galt der Grundsatz „Wo kein Kläger, da
kein Richter": Erst wenn man privat Anklage erhob, wurde die
Rechtsprechung aktiv. Im 13. Jahrhundert entwickelte sich im
kirchlichen Bereich der Inquisitionsprozess zur Bekämpfung der Ketzer.
Diesen übernahm nun die weltliche Rechtsprechung: Ein Vertreter der
Obrigkeit erhob Anklage, ermittelte und verhaftete den Verdächtigen.
Ziel war es, die „Wahrheit" zu ermitteln, und das möglichst durch ein
Geständnis. Dafür kam die aus dem römischen Recht übernommene Folter
zum Einsatz. Das Verfahren - nun nicht mehr öffentlich - führten lokale
Instanzen durch, die Entscheidung lag bei einer Juristenfakultät oder
einem Obergericht. Auf einem „endlichen Rechtstag" erfolgte die
öffentliche Vollstreckung des Urteils. Weiterhin zeichnete sich die
Gerichtslandschaft durch eine bunte Vielfalt aus. Erst im aufgeklärten
Absolutismus machte man sich an die Schaffung eines einheitlichen
Straf- und Zivilrechtes.
RICHTER UND URTEILER
Bis 1848 war die Gerichtslandschaft zersplittert. Die Gerichtsbarkeit
oblag Landgerichten, Stadt- und Grundgerichten sowie für bestimmte
Berufe und Stände eingerichteten Sondergerichten. Ein Kriterium für die
Zuständigkeit war die Schwere des Deliktes. Die hohe Gerichtsbarkeit -
der „Blutbann" kam zunächst allein dem Landesherrn zu. Durch
Privilegien wurde sie auch Städten oder Märkten zuerkannt und mit der
Formel „Pranger, Stock und Galgen" in Stadt- und Marktrechten
verankert. Grundherren übten die niedere Gerichtsbarkeit aus. Um
geringfügige Übertretungen und Zivilstreitsachen im Dorf kümmerte sich
die Dorfobrigkeit. Im 17. Jahrhundert gab es in Niederösterreich 403
Landgerichte, noch 1848 waren es um die 200. Nach der Revolution von
1848 lag die Gerichtsbarkeit nur mehr in den Händen des Staates.
Schwurkreuz der Herrschaft Paasdorf, 18. Jh.
Schwurkreuze gehörten einst zum Inventar von Gerichtsstuben. Noch heute
stehen sie bisweilen auf den Richtertischen. Und noch heute schwören
Zeugen „bei Gott dem Allmächtigen und Allwissenden" und sollen den Eid,
so sie der christlichen Religion angehören, „vor einem Crucifixe und
zwei brennenden Kerzen" ablegen. Die Herrschaft Paasdorf - heute zu
Mistelbach gehörig - umfasste das gleichnamige Dorf sowie die Orte
Schrick und Gaunersdorf.
Zeremonialschwert eines Stadtrichters, Toledaner Klinge, Mitte 16. Jh.
Gerichtsschwerter waren Hoheitszeichen für die richterliche Gewalt. Sie
standen allerdings alleine Gerichten zu, die die Blutgerichtsbarkeit
innehatten, also Todesurteile fällen durften. Man verwendete sie bei
gerichtlichen Handlungen oder bei Zeremonien - etwa wenn ein neuer
Richter eingesetzt wurde. Die prunkvolle Ausgestaltung zeugt davon,
dass das Schwert dem jeweiligen Auftraggeber auch zur Repräsentation
diente: Seht her, wer ich bin!

ORTE DER RECHTSPRECHUNG
Nach altem germanischen Recht hielt man die „Thing" oder „Taiding"
genannte Gerichtsversammlung unter freiem Himmel an ehrwürdigen Plätzen
ab. Alte Bäume - die „Gerichtslinden" -, große Steine oder Gewässer
wurden eigens dafür eingehegt. Bereits Karl der Große erlaubte im 8.
Jahrhundert, bei schlechtem Wetter in die Vorhallen von Kirchen oder
andere Hallen zu übersiedeln. Während die Dorfgerichte weiterhin unter
freiem Himmel tagten, entstanden in anderen Bereichen eigene
Räumlichkeiten. Grundherren richteten Gerichtsstuben in Burgen,
Schlössern und Klöstern ein. Städte bauten Gerichtslauben oder
statteten die Rathäuser mit Gerichtssälen aus. Als Einrichtung dienten
Tische und Bänke. In der Gestaltung der Wände, dem Deckenschmuck, der
Fensterdekoration, in Gemälden und Statuen wurden Rechtssymbole und
-allegorien aufgegriffen.
Freiung, Umgebung von Aspang, 17. Jh.
Aus der Verbindung der uralten Hoheitssymbole Hand und Schwert
entstanden speziell in Österreich die Schwerthände bzw. -arme. Zunächst
war die Freiung ein Zeichen für die Blutgerichtsbarkeit. Erst später
markierte sie einen privilegierten Jahrmarkt, an den Vorrechte geknüpft
waren: etwa erweiterter Rechtsfrieden, erhöhter strafrechtlicher Schutz
oder wirtschaftliche Privilegien. Vor Beginn des Marktes wurde die
Freiung bei einer feierlichen Zeremonie ausgesteckt.
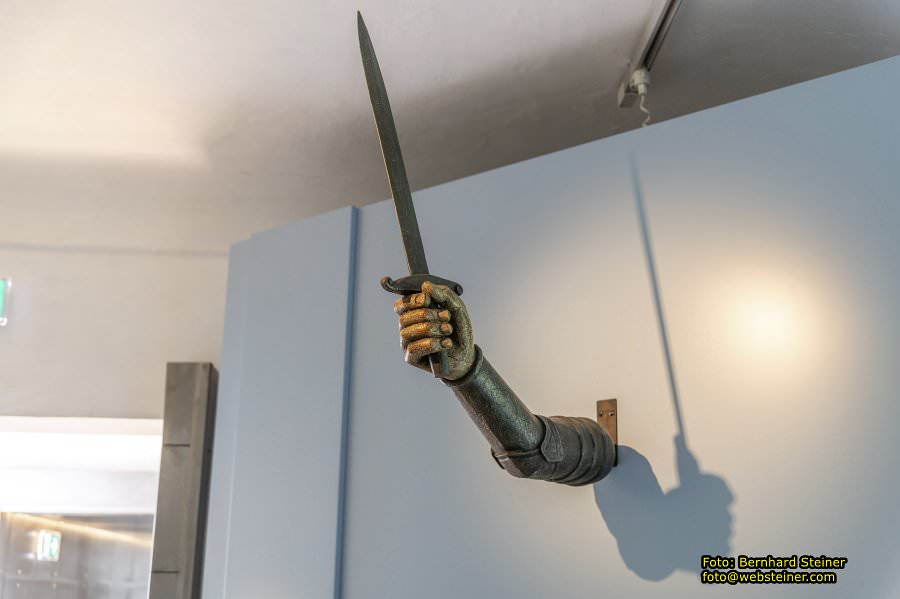
Schandblock für drei Verurteilte
Kopie, Original: Neunkirchen, 1698 (Stadtmuseum Neunkirchen)
Dieser Schandblock ist ein Unikum. Er erinnert an die ähnlich aufwändig
bemalte „Wiege der Alten" des Marchtrenker Richters Kötzinger, die auf
1702 datiert wird. Dargestellt ist ein Ehepaar an einem Tisch mit
Spielkarten, Würfeln und Weinglas. Das lässt vermuten, dass mit
Einspannen in diesen Block Männer bestraft wurden, die ihr Vermögen im
Wirtshaus bei Spiel und Trank verschleuderten.

Pranger mit Bagstein und zwei Handfesseln, Rekonstruktion, 1988
Der Pranger stand stets auf einem Platz im Zentrum des Ortes. Er war
mit Zeichen der Strafgerichtsbarkeit wie Bagsteinen, Hals- und
Handfesseln ebenso versehen wie mit jenen der „Markgerechtigkeit", etwa
der Freiung, dem Marktschwert. Ursprünglich bestanden die Pranger meist
aus Holz. Von den später aus Stein errichteten Prangersäulen hat sich
eine große Zahl vor allem im Waldviertel erhalten. Eine Besonderheit
stellt deren Bekrönung mit Ritterfiguren dar, „Prangermandl",
„Prangerhansl" oder „Roland" genannt. Ob diese Figuren in Zusammenhang
mit dem norddeutschen Stadtrechts-Roland stehen, ist bislang ungeklärt.
Die erhaltenen Prangersäulen stammen vor allem aus der Renaissance- und
der Barockzeit. Noch gotische Elemente weist die 8,3 Meter hohe
Prangersäule in Drosendorf auf. Auch in den Weistümern finden sich
immer wieder Hinweise auf Prangersäulen, meist in Zusammenhang mit
verhängten Strafen.

Seit jeher rufen Schauergeschichten wohliges Gruseln hervor. Die
Erfindung des Buchdrucks machte es möglich, günstig hergestellte
Flugblätter mit kurzen, meist illustrierten Texten unter die Leute zu
bringen. Sie handelten von unerhörten Geschehnissen aus aller Welt.
Bereits 1516 berichtete der Nürnberger Meistersinger Kunz Has von einer
Gräueltat: In Wien hatte ein Knecht seinen Meister und dessen Familie
ermordet. Im 18. Jahrhundert verkauften in Wiens Straßen sogenannte
Urteil- oder Liederweiber Druckschriften, die unter anderem Verbrechen,
„Urthel" (Urteil) und Bestrafung behandelten. Das lag durchaus im
Interesse der Behörden: Das Volk sollte von ihrer erfolgreichen Arbeit
erfahren. Bei Hinrichtungen wurden die Urteile gedruckt verteilt. Das
diente der Warnung und Abschreckung, man wollte aber auch ein Gefühl
von Sicherheit vermitteln.
Porträt des Johann Georg Grasl, Lithografie, Wien, 1816
Als am 31. Jänner 1818 vor dem Neutor in Wien Johann Georg Grasl und
seine Komplizen Johann Fühding sowie Ignaz Stangl hingerichtet wurden,
endete eine kriminelle Laufbahn, die fast zehn Jahre lang die Justiz
auf Trab gehalten hatte. Als Sohn eines Abdeckers gehörte Grasl zum
Kreis der Ausgegrenzten. Damit blieb ihm auch ein „normaler" Beruf
verwehrt. Mit Diebstahl, Raub und Raubmord verbreiteten Grasl und seine
Bande im Waldviertel und in den angrenzenden Gebieten Böhmens und
Mährens Schrecken. Erst ein Kopfgeld in der Höhe von 4.000 Gulden
brachte ihn zur Strecke.
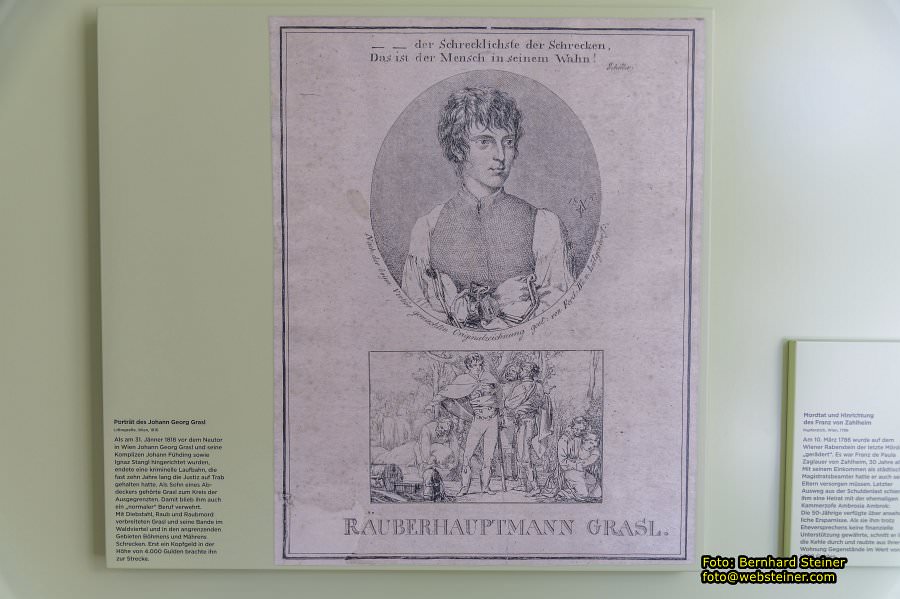
Der mächtige Bergfried entstand
in der ersten Bauphase der Burg. Obwohl in der Niederung errichtet,
machten ihn seine markante Höhe und der sorgfältig gestaltete
Zinnenkranz weithin sichtbar. Nicht zuletzt drückten seine Erbauer
damit ihre Herrschaftsansprüche aus. Schlüssige Hinweise auf die
Entstehungszeit der ersten kleinen Burg geben historische Quellen und
eine naturwissenschaftliche Untersuchung des verbauten Holzes: Demnach
wurde es in den 1250er-Jahren gefällt. Eine hohe Mantelmauer umschloss
ein bescheidenes Wohngebäude im Westen. Der Wirtschaftsbereich mit
Holzbauten lag südlich der Burg. Diese bewohnten die Inhaber nicht
selbst: Sie residierten zunächst noch anderswo in Niederösterreich.
Ein Turm war im Mittelalter ein
Zeichen von Macht. Der Besitzer hat damit gezeigt: Dieses Land gehört
einem mächtigen Herrscher. Der Turm von Burg Pöggstall war sehr hoch,
und er war auch besonders schön gebaut. Der Turm war mit Zinnen
verziert. Aus den Holz-Teilen in einem Gebäude kann man das Alter
bestimmen.
Die Forscher haben herausgefunden: Die Bäume für den Pöggstaller Turm
sind im Jahr 1256 gefällt worden. In dieser Zeit hat man wahrscheinlich
mit dem Bau der Burg begonnen. Dieses Datum passt auch zu den Urkunden
aus dieser Zeit. Die Erbauer der Burg haben damals nicht selbst in
Pöggstall gelebt. Sie haben in anderen Burgen in Niederösterreich
gewohnt. In der Burg in Pöggstall hat es daher nur ein bescheidenes
Wohn-Gebäude für das Personal gegeben. Das Wohn-Gebäude war an eine
Außen-Mauer angebaut. Diese Mauer hat die Burg wie ein Mantel
geschützt. Darum heißen solche Mauern Mantel-Mauern. Im Süden vor der
Mauer waren die Wirtschafts-Gebäude. Die Wirtschafts-Gebäude waren aus
Holz gebaut.

Ab 1478 kam es zu einer umfassenden Neugestaltung des Herrschaftssitzes
in mehreren Bauphasen. Sie sind der Spätgotik und Renaissance
zuzurechnen. Zunächst wurde das Verteidigungssystem umgestellt: Man
legte riesige Erdwerke an den Hangseiten an und erschloss sie durch
einen Portalturm an der Westseite der Burg. Auch ein zusätzlicher
Zwinger wurde errichtet. Zeitgleich erfolgte eine Erhöhung der beiden
bestehenden Türme. Ein Wohnbau an der Ost- und der Nordseite veränderte
die Kernburg. Im südlichen Teil des Areals entstand ein neuer Osttrakt,
während der Westtrakt durch repräsentative Innenräume wie eine gewölbte
Halle aufgewertet wurde. Eine große freistehende Kapelle an der
Ostseite - die heutige Pfarrkirche - ergänzte die Residenz ebenso wie
ein Meierhof. Zuletzt wurde der große Schlosshof durch einen
Arkadengang neu erschlossen. In die 1540er fällt die Fertigstellung des
im Süden vorgelagerten großen Rondells (Barbakane). Außerdem wurde der
Arkadenhof mit hochwertigen Renaissancefresken ausgestattet.

Seit 1986 ist die Marktgemeinde Pöggstall Besitzerin des Schlosses. Mit
dem Zuschlag zur Niederösterreichischen Landesausstellung 2017 ließ
sich auch die längst notwendige Sanierung des Kulturjuwels in Angriff
nehmen. In enger Zusammenarbeit von Land Niederösterreich, Gemeinde,
Bundesdenkmalamt und dem Architekturbüro W30 wurden Schloss und
Kanonenrondell behutsam restauriert und die Außenbereiche neu
gestaltet. Was lange Zeit einen Fremdkörper im Ort darstellte, steht
nun im Mittelpunkt der Gemeinde und ihrer Bewohner. Ab 2018 sorgt das
Schloss als kulturelles und kommunales Zentrum mit Gemeindeamt,
Veranstaltungs- und Ausstellungsräumen, Gastronomie und Shop dafür,
dass seine historischen Mauern auch künftig mit Leben erfüllt sind.
Bei der jüngsten Restaurierung wurde die Schlossanlage behutsam
instandgesetzt. Wo Neues notwendig war, bieten Stahl, Beton und Holz
einen reizvollen Kontrast zum Altbestand. So etwa im neuen
Stiegenhausblock, dessen Kern eine renaissancezeitliche Wendeltreppe
bildet - eine überraschende Entdeckung. Und nicht die einzige: So legte
man unter anderem einen Saal mit spätgotischem Netzrippengewölbe frei.
Offenkundig wird die Neubelebung schon bei der Ankunft: Diente das
große Rondell einst der Abwehr, so laden die heute offen stehenden Tore
der einst durch Zugbrücken gesicherten Portale zum Besuch ein.

Rechtliche Aufarbeitung der NS-Zeit - chronologisch auf Tafeln im Schloss Pöggstall
Drittes Rückstellungsgesetz, 6. Februar 1947
Zwischen 1946 und 1949 werden sieben Rückstellungsgesetze erlassen.
Das dritte bezieht sich erstmals auf Vermögen in privatem Besitz.
Rückerstattet wird jedoch nur, was tatsächlich noch vorhanden ist. Für
aufgelösten Besitz oder solchen, der nicht eindeutig zuordenbar ist,
wird man bis in die 1960er-Jahre nicht entschädigt. Bis dahin
beschränkt sich die Erbfolge auch auf die engsten Familienmitglieder.
Beträchtliche Vermögen bleiben so unberührt.
Opferfürsorgegesetz, 4. Juli 1947
Bedürftige Menschen, die nachweisen können, in der NS-Zeit Widerstand
geleistet zu haben, sollen finanziell unterstützt werden. Voraussetzung
dafür ist zunächst die österreichische Staatsbürgerschaft. Jene, die
man aus rassistischen oder religiösen Gründen verfolgte, sind im
ursprünglichen Gesetz nicht berücksichtigt. Später werden sie als
„passive" Opfer geführt und schlechtergestellt. Bis heute ist diese
Unterscheidung der NS-Opfer im Gesetzestext erhalten geblieben - nach
über 70 Novellen.
Zum Umgang mit erblosem jüdischen Vermögen, 9. November 1948
„Ich sehe überall nur jüdische Ausbreitung [...] Auch den Nazis ist im
Jahre 1945 alles weggenommen worden [...] Ich wäre dafür, dass man die
Sache in die Länge zieht [...]."
Innenminister Oskar Helmer in der 132. Ministerratssitzung
Kriegsopferversorgungsgesetz, 14. Juli 1949
§ 1. (1) Wer für die Republik Österreich, die vormalige
österreichisch-ungarische Monarchie oder deren Verbündete oder nach dem
13. März 1938 als Soldat der ehemaligen deutschen Wehrmacht
militärische Dienste geleistet und hiedurch eine Gesundheitsschädigung
(Dienstbeschädigung) erlitten hat, ist versorgungsberechtigt. Hat das
schädigende Ereignis den Tod verursacht, sind die Hinterbliebenen
versorgungsberechtigt."
Gesetz über die Aufhebung der Volksgerichte, 20. Dezember 1955
Die Tätigkeit der Volksgerichte wird mit Inkrafttreten dieses Gesetzes
beendet. Für Verfahren nach dem NS-Verbotsgesetz und dem
Kriegsverbrechergesetz (beide aus dem Jahr 1945) werden ab sofort
ordentliche Gerichte zuständig. Meist sitzen nun Geschworene über die
NS-Verbrecher zu Gericht. Sie sprechen mutmaßliche Täter mehrheitlich
frei, oft trotz belastender Beweise.
NS-Amnestiegesetz, 14. März 1957
„Unmittelbar nach der Unterzeichnung des Staatsvertrags war Österreich
endlich frei, das zu tun, was man schon immer wollte: Der Nationalrat
verabschiedete ein Gesetz, das eine Amnestie für den Großteil der von
den Volksgerichten verurteilten NS-Verbrecher brachte, denen auch noch
die Bezüge nachbezahlt wurden und deren Haftzeit als Dienstzeit
angerechnet wurde. Ebenso wurde die Dienstzeit von SS-Männern voll für
den Pensionsanspruch gewertet."
Walter Manoschek, Politikwissenschaftler, 1995
Gesetz zur Abgeltung von Vermögensverlusten, 22. März 1961
Erstmals entschädigt man jüdische Opfer für finanzielle Verluste.
Darunter fallen auch Steuern, die ihnen während der NS-Zeit
aufgezwungen wurden. Die politisch Verfolgten sind bereit zuzustimmen –
vorausgesetzt, man behandelt ihre Opferschaft ab sofort großzügiger.
Erst als Deutschland finanzielle Unterstützung - auch für die
Integration der 1945 vertriebenen „Volksdeutschen" - zusagt, wird das
Gesetz erlassen.
Kunst- und Kulturgutbereinigungsgesetz, 27. Juni 1969
Im Staatsvertrag von 1955 verpflichtet sich Österreich, mit dem Erlös
aus nicht rückerstatteten Vermögenswerten künftig NS-Opfer zu
unterstützen. 1969 werden auf Druck von Simon Wiesenthal 8.400 solcher
Objekte - sie lagern zu diesem Zeitpunkt in der Kartause Mauerbach -
auf einer Liste einsehbar, darunter etwa 2.000 Kunstgegenstände. 269
davon werden rückgestellt. Der Rest kommt gegen eine Abschlagszahlung
von fünf Millionen Schilling in den Besitz der Republik Österreich.
Zweites Kunst- und Kulturgutbereinigungsgesetz, 13. Dezember 1985
1984 erscheint in der Kunstzeitschrift „Art news" ein Beitrag über
Österreichs Umgang mit „arisierten" und herrenlosen Gütern. „A Legacy
of Shame" - „Ein Vermächtnis der Schande" betitelt ihn der Autor Andrew
Decker. Öffentlicher Druck führt dazu, dass im Jahr darauf ein zweites
Kunstbereinigungsgesetz verabschiedet und erneut eine Liste
veröffentlich wird. 3.300 Anträge auf Rückstellung werden eingebracht,
22 Werke ausgefolgt.
Nationalfondsgesetz, 30. Juni 1995
Basierend auf einer Idee von Albert Sternfeld soll der Nationalfonds
Österreichs „besondere Verantwortung gegenüber den Opfern des
Nationalsozialismus zum Ausdruck bringen". Erstmals werden dazu auch
jene gezählt, die wegen ihrer sexuellen Orientierung, als „Asoziale"
oder aufgrund einer Behinderung verfolgt wurden. Als Geste zahlt man
bislang an 28.000 antragstellende Personen je 5.000 Euro aus.
Mauerbach-Auktion, 29. und 30. Oktober 1996
In Wien werden die restlichen Kunstobjekte versteigert, die noch in
Mauerbach lagern. Mit der Versicherung, sie seien „erblos", hat die
Republik sie zuvor der Israelitischen Kultusgemeinde überantwortet. Der
Erlös von 120 Millionen Schilling kommt auftragsgemäß Opfern des
NS-Regimes zugute. Im Zuge der Versteigerung entdeckt die
Kunsthistorikerin Sophie Lillie Etiketten, Stempel und Siegel auf den
Rückseiten der Gemälde. In den Folgejahren wird sie Dutzende
rechtmäßige Besitzer nachweisen können.
Kunstrückgabegesetz, 4. Dezember 1998
Im Jänner 1998 werden in New York zwei Schiele-Bilder beschlagnahmt. Es
handle sich um Raubkunst, so der Verdacht. Kurz darauf erteilt die
zuständige Ministerin die Weisung, Archive und Sammlungen der Republik
zu überprüfen. Mit dem in der Folge beschlossenen Gesetz wird die
Herkunft von Kunstwerken zum ersten Mal systematisch untersucht. Bis
heute unterliegen Privatsammlungen nicht dem Gesetz, es existiert kein
Rechtsanspruch, und die Betroffenen haben im Verfahren keine
Parteienstellung.
Versöhnungsfondsgesetz, 8. August 2000
Im April 2000 reicht US-Opferanwalt Ed Fagan eine Sammelklage gegen die
Republik Österreich und gegen heimische Unternehmen in der Gesamthöhe
von etwa 260 Milliarden Schilling ein. Daraufhin wird ein mit sechs
Milliarden Schilling dotierter Fonds errichtet, der diese Ansprüche
beantworten soll. Entschädigt werden ehemalige Zwangsarbeiter, die vor
allem aus Osteuropa stammen. Deren Erben erhalten nur dann Geld, wenn
ihr Angehöriger frühestens am 15. Februar 2000 verstorben ist.
Washingtoner Abkommen, 17. Jänner 2001
Die Zahlungen aus dem Versöhnungsfonds fließen erst, nachdem alle mit
Zwangsarbeit zusammenhängenden Klagen abgewiesen sind. Außerdem wird
ein mit 210 Millionen Dollar ausgestatteter „Allgemeiner
Entschädigungsfonds" vereinbart. Erstmals sind davon zerschlagene
jüdische Kleinbetriebe und „arisierte" Mietwohnungen erfasst. Auch hier
wird die letzte offene Klage abgewartet, ehe es ab dem Jahr 2005 zu
Auszahlungen kommt.
Anerkennungsgesetz, 10. August 2005
Mit dem Anerkennungsgesetz werden die Sprüche der NS-Militärjustiz
endgültig für nichtig erklärt. Zwar ist damit die Gruppe der
Wehrmachtsdeserteure angesprochen, allerdings nur indirekt. Geklärt
sind vor allem die sozialrechtlichen Aspekte: Deserteure werden
erstmals in das Opferfürsorgegesetz aufgenommen ebenso wie Menschen,
die in der NS-Zeit zwangsweise unfruchtbar gemacht wurden.
Aufhebungs- und Rehabilitationsgesetz, 17. November 2009
Anders als das Anerkennungsgesetz von 2005 erklärt das neue Gesetz nun
klar alle Urteile aus der NS-Zeit für nichtig, die Deserteure und
zwangsweise sterilisierte Menschen betreffen. Die Prüfung des einzelnen
Falls ist dafür nicht mehr nötig. Opfer und Opferangehörige können
seitdem ihre Anträge auf Aufhebung der Urteile beim Straflandesgericht
Wien einbringen.
Und heute 2017?
Wie zieht man nach 70 Jahren zäher Anerkennung und bescheidener
Zahlungen Bilanz? Noch immer werden NS-Opfer rechtlich ausgeblendet -
so wie die KZ-Häftlinge, die oft geehrt, aber von der Republik nie
entschädigt wurden. Forschungen zu den Insassen von NS-Gefängnissen
sind bislang nicht erfolgt. Und der Anteil von Sklaven- und
Zwangsarbeit am industriellen Grundstock der Zweiten Republik wurde nie
adäquat bemessen. Die Ausforschung von Tätern bleibt bis heute
mangelhaft.

Wem der viele Text zu lange war und lieber Bewegtbilder mit Musik mag,
kann sich gerne dieses Video antun: