web steiner
Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen
Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.
+43/2624/54014 - office@websteiner.com
Erlauftaler Feuerwehrmuseum
Purgstall an der Erlauf, Juni 2023
Purgstall an der Erlauf im Bezirk Scheibbs liegt im
Mostviertel in der niederösterreichischen Eisenwurzen und bezeichnet
sich selbst als das Tor zum Ötscherland. Die katholische Pfarrkirche
Purgstall hl. Petrus wurde im 14. Jahrhundert errichtet, das
Erlauftaler Feuerwehrmuseum im Feuerwehrhaus zeigt die geschichtliche
Entwicklung des Feuerwehrwesens in Niederösterreich.

Der Wehrturm: Um 1380 erwirkten die Walseer von Landesherrn Albrecht
III die Erlaubnis, den Markt von Purgstall mit einer Ringmauer umgeben
zu dürfen. Um 1850 wurde der erste der 5 Türme bei Abriss der Markttore
demoliert. Der letzte verbliebene Wehrturm steht heute beim
„Feichsengassl“. Dieser Wehrturm und die Wehrmauer in diesem „Gassl“
neben der Feichsen stehen unter Denkmalschutz. Der Turm wurde
mittlerweile renoviert und wird für Veranstaltungen verwendet.

Im ehemaligen Kriegsgefangenenlager Purgstall von 1915 bis 1918 wurden
Personen der damaligen „Feindstaaten“ unter Bewachung gehalten. Unter
dem Bewachungspersonal befand sich kurze Zeit auch der Maler Egon
Schiele, der einige bekannte Werke im Erlauftal schuf.

Die Erlaufschlucht in Purgstall ist ein besonderes Naturjuwel innerhalb
des Europaschutzgebietes „Niederösterreichische Alpenvorlandflüsse“.
Der Fluss hat sich hier im Laufe der Jahrtausende tief (bis 17 m) in
dem seit der letzten Eiszeit aufgelandeten Schotter (Konglomerat)
eingegraben und gilt bereits seit 1972 aufgrund seiner geologischen und
landschaftlichen Besonderheiten als Naturdenkmal. Den Besitzern der
Grundstücke, auf denen dieses Naherholungsgebiet (insbesondere der
Florian'schen Gutsverwaltung) verläuft, ist es zu danken, dass durch
eine sehr naturschonende Betriebsweise diese wunderbaren Struktu-ren
erhalten geblieben sind.
Vom Quellgebiet westlich des Erlaufsees bis zur Mündung in die Donau
bei Pöchlarn durchfließt die Erlauf ca. 75 Kilometer. Im Ortsgebiet
Purgstalls befindet sich ein 6 km langer, einmaliger Flussabschnitt -
das Naturdenkmal „Erlaufschlucht", im Volksmund auch „Praterschlucht"
genannt. Entsprechend der Bodenverhältnisse siedelten sich auch alpine
Pflanzen und Tiere an. Einige fremdländische Pflanzen sind schon zu
Beginn des 20. Jhdt. aus dem gräflichen botanischen Schlossgarten
ausgewildert und bereichern die Flora.

Gasthof Hörhan, Zum Goldenen Löwen

Cafe am Platz, Schulgasse 2, 3251 Purgstall an der Erlauf

Pfarrkirche Purgstall an der Erlauf
Die Kirche steht in der Ortsmitte von Purgstall. Sie wird im Süden von
Pfarrhof und Pfarrheim umgeben, im Westen von der hohen ehemaligen
Friedhofsmauer und im Osten vom alten Schulhaus (bis 1908) und von
Teilen der Friedhofsmauer. Gegen Nordenbildet der Kirchenplatz mit der
Kirchenstraße eine durchgehende Begegnungszone. Durch den großzügigen
Freiraum um die Kirche kommt der eindrucksvolle Baukörper auch in
unmittelbarer Nähe sehr gut zur Wirkung und verliert kaum etwas von der
wuchtigen und beherrschenden Erscheinung, die er nach allen Richtungen
hin zeigt. Die Fernwirkung ist vor allem durch das große Giebeldach mit
einer Firsthöhe von durchschnittlich 28 Metern und durch den wuchtigen
Turm an der Westfassade mit der schwungvollen barocken Zwiebelhaube
bestimmt. Der Turm weist eine Höhe von 49,96 Metern auf und ist somit
der höchste Kirchenturm des Bezirkes Scheibbs.

Katholische Pfarrkirche Purgstall hl. Petrus: Der erste Bau wurde im
14. Jahrhundert errichtet, davon sind heute noch der untere Teil des
Turmes und das jetzige nördliche Seitenportal erhalten. Am Anfang des
15. Jahrhunderts wurde die heute noch bestehende dreischiffige
spätgotische Hallenkirche erbaut. Der Chorschluss dieser spätgotischen
Kirche und die arkadenartigen Emporen wurden in den Jahren 1712–1719
neu errichtet. Aus dem Jahre 1711 liegt eine Rechnung für Kirchenrisse
vor, die Jakob Prandtauer nach Purgstall liefern ließ. Es darf daher
angenommen werden, dass der bekannte Baumeister des Barock an der
Kirche mitgeplant hat. 1871, 1980, 1985 und zuletzt 1996 erfolgten
Renovierungsarbeiten. Das Innere der Kirche ist im Wesentlichen ein
dreischiffiger Raum aus der Spätgotik, dessen Decke von einem
Netzrippengewölbe gebildet ist. Die Ausstattung stammt im Unterschied
zum spätgotischen Raum aus der Barockzeit.

Zu den bemerkenswertesten Ausstattungsstücken zählt schließlich die Orgel,
die noch das barocke Gehäuse mit einem klassischen fünfteiligen
Prospekt und einer Uhr als Bekrönung besitzt. In ihrem Werk wurde sie
jedoch mehrfach verändert. Bereits im Jahr 1650 ist der Kauf eines
Positivs von Meister Michael in Lahr am Spessart erwähnt. Die barocke
Orgel wird auf das Jahr 1730 datiert und war mit 21 Registern
ausgestattet. Der ausführende Orgelbaumeister war Gottfried Sonnholz
aus Wien. 1792 wurde die Orgel durch den Kremser Orgelbauer Ignaz Gatto
d.]. mit 22 neuen Registern ausgestattet, wobei das alte Orgelgehäuse
übernommen wurde.
Die letzte Erneuerung und Restaurierung erfolgte schließlich 1980 durch
den Orgelbaumeister Gerhard Hradetzky aus Oberbergern. Die Orgel wurde
unter Verwendung von elf noch vorhandenen barocken Registern auf den
alten Zustand von 20 klingenden Registern rückgeführt. Bei der
Kirchenneugestaltung 2019 wurde die Orgel von der Firma Pieringer,
Stadt Haag, gereinigt und neu intoniert.

Ein beherrschendes Ausstattungsstück im vorderen Teil des Kirchenschiffes ist die Kanzel,
errichtet um 1760, die am vorletzten Mittelschiffpfeiler auf der linken
Seite angebracht ist. Auf dem breit ausladenden Kanzelkorb mit leicht
geschwungenem Umriss sind vorne sitzend die vier Evangelisten mit ihren
Symbolen dargestellt. Dazwischen sind ovale Reliefs angebracht, von
denen das mittlere den zwölfjährigen Jesus im Tempel, das linke die
Taufe Christi im Jordan und das rechte die Predigt Johannes des Täufers
zeigt. Auf dem Schalldeckel, der die geschwungene Form des Kanzelkorbes
aufnimmt, ist Christus als „Guter Hirte“, umgeben von fünf schwebenden
Engelsputti, dargestellt. An der Vorderkante sitzen zwei große Engel
mit ausgebreiteten Armen. Dazwischen ist eine Inschriftkartusche mit
folgendem Zitat aus dem Lukasevangelium angebracht: „Selig, die das
Wort Gottes hören und dasselbe beachten. Lk 11,28“ Dem reichen
Kanzelschmuck entsprechend, besitzt der Aufgang sogar ein eigenes
Portal mit Türblatt.

Der Hochaltar Malers Karl Frister (1742-1783). Der
nimmt in nahezu voller Breite und Höhe den Abschluss des Mittelschiffes
ein und ist sowohl durch seine Größe als auch durch seine reiche
Goldfassung als zentrales Ausstattungsstück entsprechend hervorgehoben.
Die Altarstufen und die Altarmensa bestehen aus rotem Marmor, während
der Aufbau selbst aus Holz besteht und eine entsprechende Marmorierung
aufweist. Alle Figuren und sämtliche ornamentalen Teile sind vergoldet.
Das Altarbild ist dem Kirchenpatron gewidmet undzeigt Petrus, wie er
von Christus die Schlüssel des Himmelreiches überreicht bekommt. Das
Gemälde ist ein Werk des an der Wiener Akademie tätig gewesenen
Künstler greift in diesem Werk auf eine Komposition des Venezianers
Giovanni Battista Pittoni zurück. Als Vorlage dürfte entweder das heute
nicht mehr erhaltene Altarbild Pittonis selbst gedient haben oder
Skizzen, von denen sich unter anderem auch zwei in der Albertina in
Wien erhalten haben. Flankiert wird das prächtige Altarbild von den
Statuen der Apostel Andreas und Jakobus sowie — auBerhalb der
Altarsäulen — von den Statuen des hl. Augustinus auf der linken und des
hl. Karl Borromäus auf der rechten Seite.
Über dem Altarbild nehmen die zwei schwebenden Engel mit dem
Kirchenmodell und den Schlüsseln nochmals auf den Kirchenpatron Bezug.
Am gesprengten Dreiecksgiebel des Aufsatzes sitzt jeweils ein großer
Engel. Den Abschluss bildet die Heilig-Geist-Taube in der Glorie.
Besonders reich und durch die vollständige Vergoldung auch entsprechend
kostbar ist der Tabernakelaufbau gestaltet, der eine tempiettoartige
Form mit jeweils drei Säulchen seitlich und als Bekränzung des
kuppelförmigen Abschlusses das Lamm auf dem Buch mit den sieben Siegeln
zeigt. Seitlich des Tabernakels sind zwei anbetende Engel angeordnet.
Auf den Sockeln der seitlichen Tabernakelteile sind als Relief links
die Manna-Lese und rechts das Opfer des Hohenpriesters Melchisedech
dargestellt. Die Mitte des Tabernakels zeigt das letzte Abendmahl. Der
Entwurf zu diesem prachtvollen Hochaltar stammt vom
niederösterreichischen Regierungsbaumeister Andreas Zach (1737-1797).
Ausgeführt wurde der Altaraufbau von Ignaz Tempes. Die
Bildhauerarbeiten stammen von dem in den Kirchenrechnungen genannten
Simon Reindl aus Wien. Als Vergolder wird Herr Kirschner aus Wien
genannt.
Im Zuge der Renovierung 2019 erhielt auch die historische
Ewig-Licht-Lampe wieder ihren Platz im Zentrum vor dem Hochaltar. Die
aus der Zeit des barocken Hochaltars stammende Ampel wurde im Zuge
einer vorangegangenen Renovierung entfernt. Diese Lampe aus
getriebenem, versilbertem Messing mit reichlichen Goldauflagen und
einer kunstvoll ausgefertigten Aufhängung wurde von Mag. Pina Klonner
restauriert und verweist auf den Platz des Allerheiligsten, den
Tabernakel.

Das Herz Jesu- und das Herz Mariä-Fenster über den beiden Seitenaltären
wurden im Jahr 1893 auf Kosten einer Wohltäterin von der Mayer‘schen
königlichen Hofkunstanstalt in München bestellt.


Der Aufbau des linken Seitenaltars
entspricht optisch dem rechten Seitenaltar, ist jedoch nicht aus echtem
Marmor, sondern aus Holz gebaut und mit einer roten Marmorfassung
versehen. Das Altarbild zeigt den Tod der hl. Anna und ist ein Werk des
Martin Johann Schmidt, genannt Kremser Schmidt (1718 — 1801). Ihm ist
auch das Aufsatzbild der hl. Barbara zuzuschreiben. Die das Altarbild
flankierenden Figuren stellen links den hl. Johannes den Evangelisten
und rechts den hl. Judas Thaddäus dar. Entsprechend dem rechten
Seitenaltar ziert diesen Altar auch ein reich geschnitzter und
vergoldeter Aufsatz für die Kanontafeln.
Den rechten Seitenaltar ließ
die Verwaltung des Vogel‘schen Benefiziums 1762-65 errichten. Er war
für den Benefiziaten zum Lesen der heiligen Messenfür die Stifter des
Benefiziums bestimmt. Der Altaraufbau besteht zur Gänze aus Marmor und
soll vom Mariazeller Steinmetz Stephan Schittner in der Kartause Gaming
gefertigt worden sein. Das Altarbild stellt den Tod des hl. Josef dar
und ist das Werk des in Niederösterreich noch anderweitig
anzutreffenden Wiener Malers Franz Xaver Wagenschön (1726-1790). Die
seitlichen Figuren zeigen links den hl. Ferdinand und rechts den hl.
Leopold, Werke des Melker Bildhauers Andreas Stolz. Der hl. Ferdinand
dürfte hier in Bezug zum Hauptstifter Johann Ferdinand Vogel stehen.
Das Aufsatzbild, das dem Stil nach auch von Wagenschön stammt, zeigt
die hl. Katharina in Erinnerung an den Vorgängeraltar, der der hl.
Katharina gewidmet war.


Das Kirchenschiff hat Ausmaße von zirka 36 Meter Länge, das Langhaus
ist 18 Meter breit und 11 Meter hoch und im Querschiff beträgt die
Breite 21 Meter. Das Innere der Kirche präsentiert sich im Wesentlichen
als dreischiffiger, spätgotischer Raum. Die drei Schiffe des Langhauses
sind fast gleich hoch und mit verschiedenartigen, zum Teil recht
bizarren Netzrippengewölben eingedeckt. Die Gewölberippen sind unter
Vermittlung von Konsolen auf die Achteckpfeiler aufgesetzt.
Bemerkenswert sind die unterschiedliche‘ Ausführung der Netzrippen im
Gewölbe des Nordschiffes (im Vergleich zum Haupt- und Südschiff) sowie
die Trennung dieser Schiffe durch einen Schildbogen. Dies deutet darauf
hin, dass das nördliche Seitenschiff (aus der Erbauungszeit der Herren
von Wallsee um 1418/1450) offenbar in den Neubau des südlichen Hauptund
Seitenschiffes (erbaut um 1510 durch die Herren von Auersperg)
integriert wurde. Das Rippennetz im nördlichen Seitenschiff trägt im
Osten bemalte Wappenschildchen.

Die Kirche besitzt eine Reihe von Grabdenkmälern, unter denen wohl auf
Grund seiner Größe wie auch seines künstlerischen Ranges vor allem das Tumbagrab
des Volkhard und der Elisabeth von Auersperg unter der Orgelempore
hervorragt. Die Verstorbenen sind als Vollplastiken in Lebensgröße,
einander gegenüberliegend, aus weißem Marmor auf dem mächtigen
Tumbagrab dargestellt. An derlinken Seite der Frau ist auch noch ein
kleines Wickelkind zu sehen. Der Tod des ersten seiner vier Kinder
(1587) war für Volkhard von Auersperg der Anlass, noch zu Lebzeiten für
sich, seine Frau und seine Kinder dieses Grabmal errichten zu lassen,
wie den an der Längsseite der Tumba angebrachten Inschriftentafeln zu
entnehmen ist. Bis 1792 stand dieses Grabmonument frei rechts neben dem
Hochaltar und kam dort zweifellos mehr zur Wirkung, als es auf dem doch
etwas beengten Platz unter der Orgelempore der Fall ist. Diese Art der
Grabmalplastik ist in Niederösterreich eher ein Einzelfall. Als
Künstler ist der Regensburger Bildhauer Hans Pötzlinger anzusehen, der
diesen Auftrag über Vermittlung der Grafen von Ortenburg erhielt.
Tumbagrab des Volkhard und der Elisabeth von Auersperg

Die Kreuzwegbilder werden in der Literatur durchwegs in das Jahr 1843
datiert. In Wirklichkeit dürften sie jedoch älter sein, wahrscheinlich
handelt es sich sogar um die nachweislich 1734 gestifteten
Kreuzwegbilder. Laut Bericht der Pfarrchronik wurden 1843 die in der
Kirche befindlichen Kreuzwegbilder vom Wiener Maler und Restaurator
Johann Beltram in vergrößertem Maßstab mit neuen Rahmen hergestellt.
Anlässlich der Innenrestaurierung im Jahr 1970 wurden die
Kreuzwegbilder wieder auf die ursprüngliche Größe rückgeführt. Als
interessantes Detail zum Kreuzweg sei noch angemerkt, dass der Zyklus
15 Bilder umfasst, wobei die 15. Station die Auffindung des Kreuzes
Christi durch die hl. Helena zeigt. Seit der Neugestaltung 2019 werden
die Kreuzwegbilder nur in der Fastenzeit unter den Emporen präsentiert,
in der Osterzeit befindet sich dort ein Lichtweg und während des Jahres
die Apostelkreuze mit Leuchtern.
Die dreiseitig umlaufende Empore aus der Bauzeit um 1418/1450 mit einer
Kassettenbrüstung auf Pfeilerarkaden ist westseitig
kreuzrippenunterwölbt und im Mittelschiff mit Spitzbogenarkaden
geöffnet. Die längsseitigen Emporen aus der 1. Hälfte des 16.
Jahrhunderts sind kreuzgratunterwölbt und rundbogig geöffnet und wurden
1848 um zwei korbbogige Achsen ostwärts erweitert. Die drei
Triumphbögen am Übergang vom Langhaus zum Chor sind spätgotisch
profiliert. Der hallenartige Chor ist mit einem Kreuzgratgewölbe auf
schlanken Quadratpfeilern und Pilastern überwölbt. Die an Chorhaupt
angebaute Sakristei hat in beiden Geschoßen ein barockes
Kreuzgratgewölbe, eine spätgotische Eisenplattentüre und zwei
Lavabonischen mit Muscheldekor.

Im westlichen Chorjoch an der Nordseite hängt noch ein weiteres, etwas
kleineres Gemälde mit der Darstellung der Verkündigung an Maria. Dieses
Bild ist ein Werk des in Wien und Niederösterreich mehrfach
anzutreffenden venezianischen Wanderkünstlers Andrea Celesti
(1637-1712). Hier ist die Herkunft aus der Kartause Gaming
wahrscheinlich; denn für die dortige Klosterkirche malte Celesti das
Hochaltarbild, das sich heute zusammen mit dem gesamten Hochaltar in
der Pfarrkirche von Ybbsitz befindet.

Im Erlauftaler Feuerwehrmuseum wird die Entwicklung des
niederösterreichischen Feuerwehrwesens dargestellt. Sie können
Feuerwehr nicht nur sehen, sondern auch erleben – von den
pferdegezogenen Wagenspritzen bis hin zu den modernen Einsatzfahrzeugen
von heute.

Einsatzdarstellung um 1900
HAUPTMANN: Helm mit Schuppenband, Dienstgrade: um 1892
STEIGER: Aufgabe des Steigers: Retten und Vorbrechen, Lederhelm, Steigergurt, Steigerbeil und Steigerleine
HORNIST: Aufgabe des Hornisten: Weiterleitung der Befehle mit dem Signalhorn. Helm mit rotem Federbusch und Signalhorn
Angehöriger der PUMPENMANNSCHAFT: Dienstgrade ab 1928
KAISERJUBILÄUMSSPRITZE: Firma Czermack 1908, Leihgabe der FF Gaming
ABPROTZSPRITZE mit VORDERWAGEN: Firma Knaust, Leihgabe der FF Göstling/Y.
HYDROPHOR: Firma Hekele 1887, FF Purgstall

Das Erlauftaler Feuerwehrmuseum im Feuerwehrhaus in der Pöchlarner
Straße 56 zeigt die geschichtliche Entwicklung des Feuerwehrwesens in
Niederösterreich. Neben einer umfassenden Ausstellung historischer
Feuerwehrgeräte werden jeden ersten Samstag im Monat
Feuerwehr-Oldtimerfahrten angeboten. Für Kinder steht eine alte
Karrenspritze bereit, mit der sie einen „Löschangriff“ durchführen
dürfen.

Feuerwehr - Motorrad: Puch 250 SGS - 1954, Leihgabe - FF Wang

Die Benzinmotorspritzen der ersten Jahre waren durchwegs Unikate. Der
Unterbau entstand meist in den örtlichen Schmiede- oder
Schlosserwerkstätten.
Anhängemotorspritze, Rosenbauer - 1928
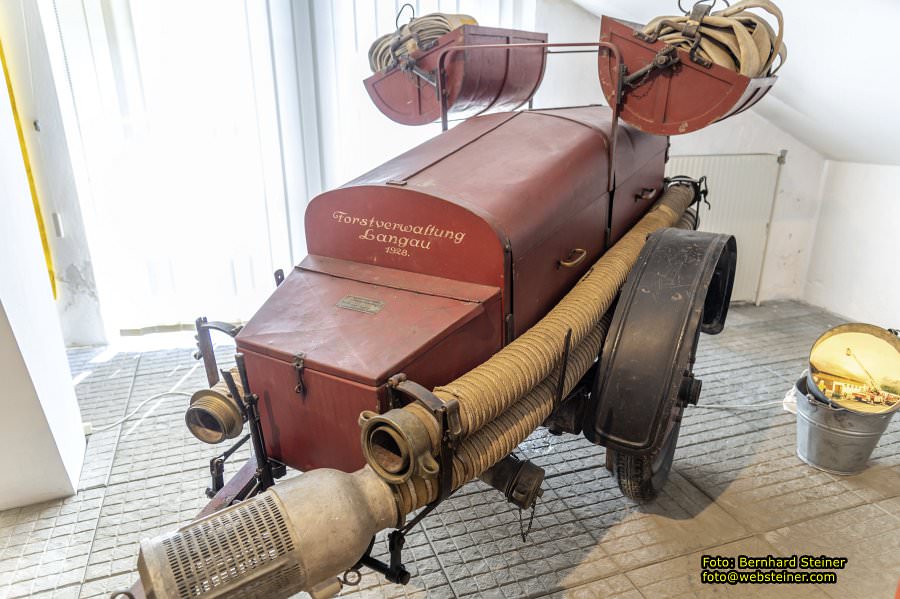
Deutscher Stahlhelm, nach dem 2. Weltkrieg mit Spinne weiterverwendet


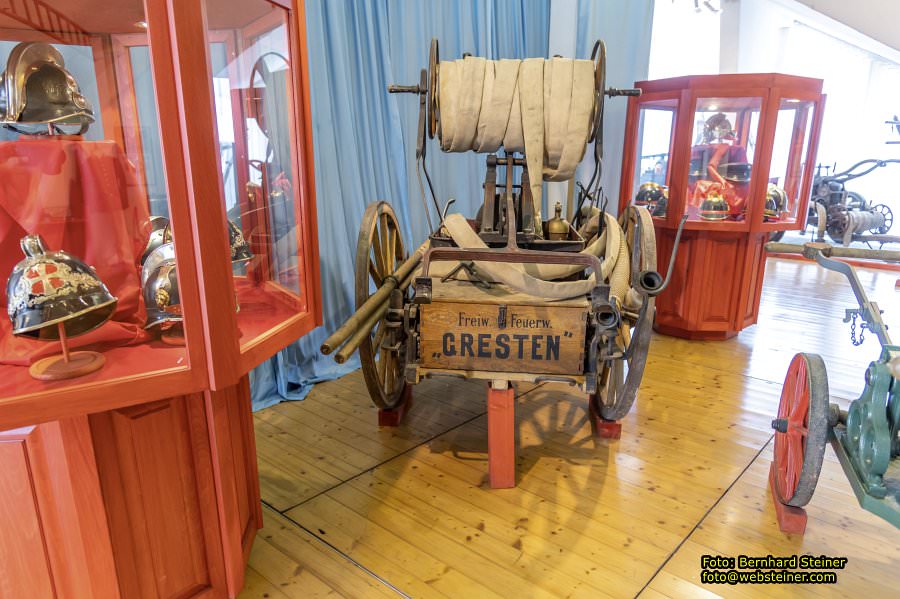
ATEMSCHUTZ
Die größte Gefährdung bei Bränden stellen Atemgifte und Rauchgase dar.
Die Feuerwehrmänner versuchten sich seit je her mit feuchten Tüchern
oder Mundschwämmen und zu schützen. Dies war nur vorgetäuschter
Atemschutz und so gut wie wirkungslos. Erst durch die Einführung von
Gasmasken, von Sauerstoffschutzgeräten und des Pressluftatmers, war ein
wirkungsvoller Atemschutz gegeben. Diese Geräte ermöglichten ein
gezieltes Arbeiten in brennenden und verrauchten Gebäuden.
Gas- oder Atemmasken
Gasmaske für leichtem Atemschutz, S[Schutz]-Maske 1936
Gasmaske mit Kohlendioxid-Filter
Volksgasmaske, Firma Dräger
Mundschwamm
Kreislaufgerät, SSG Dräger/Auer Typ: Heeresatmer, um 1940
Pressluftatmer, um 1955, Leihgabe der FF Gresten-Land
Schlauchgerät, um 1937, Leihgabe der Betriebsfeuerwehr Kienberg

1938-1945
Handsirene
Uniform Feuerschutzpolizist mit Berliner Axt
Tragkraftspritze TS 8, Magirus, Zweizylindermotor 2-Takt, 30 PS (22,06 kW), 3000 U/min, um 1942
Adaptierte Uniform Technische Hilfspolizeitruppe
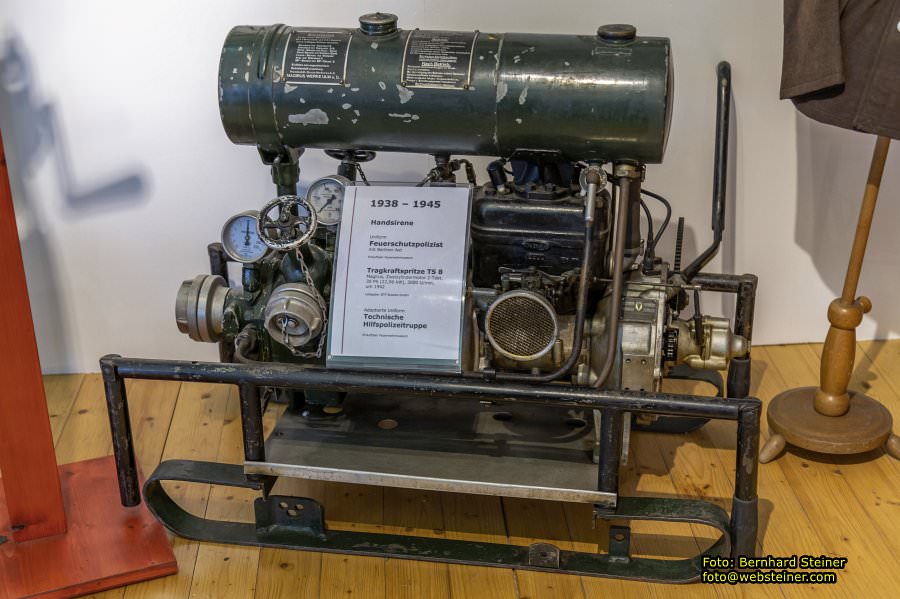
1938-1945
Nach der Angliederung Österreichs an das Deutsche Reich im März 1938
waren die Feuerwehren von einschneidenden Veränderungen betroffen:
Auflösung der Feuerwehren als Vereine und Umwandlung in eine technische
Hilfspolizeitruppe, basierend auf Freiwillige; Übernahme des
Feuerwehrvermögens in das Gemeindeeigentum; Sirenen durften für den
normalen Brandeinsatz nicht verwendet werden; 1942 Aufstellung einer
Hitlerjugend-Feuerwehrschar; Ab 1943 waren die Feuerwehren laufend bei
Einsätzen nach Bombenangriffen eingesetzt.

Bezirksfunkstelle Florian Purgstall
Die Bezirksfunkstelle Florian Purgstall wurde ab dem Jahr 1960 von
Purgstaller Feuerwehrmännern und deren Frauen betreut. Tägliche
Proberufe, Einsatz- und Einsatz-Sofortmeldungen wurden von den zwei
Funkstationen, „Florian 118" und „Florian 218" rund um die Uhr
freiwillig von den Feuerwehrangehörigen betreut. Regelmäßig mussten
Proberufe nach Tulln und nach Mariazell durchgeführt werden.

ALARMIERUNG
Besondere Bedeutung kam von Anbeginn an der Warnung der Bevölkerung und
der Verständigung der Einsatzkräfte zu. Kirchenglocken wurden von
Signalhörnern und diese später von Sirenen abgelöst. Viele Feuerwehren
besaßen elektrische Klingelleitungen. An der Einsatzstelle erfolgte die
Nachrichtenübermittlung durch Hörner und Pfeifen (einzelne Kommandos -
Ortsrufe). Seit den Siebzigerjahren ist es möglich die Feuerwehrmänner
mit Funkmeldeempfänger (Pager) zu verständigen. Heute ist der
Digitalfunk wichtigstes Verbindungsmittel der Feuerwehren im Einsatz.

Alarmierungsanlage von 1889
1883 bestand bereits die Linie von Gresten-Steinakirchen/F.-Purgstall,
1884 Purgstall-Scheibbs-Neubruck und ab 1889 wurde sie bis
Ruprechtshofen erweitert.



Helmabzeichen und Dienstzeichen

Die Republik Armenien ist ein
Binnenstaat in Vorderasien und im Kaukasus mit rund 3 Millionen
Einwohnern. Die Gesamtfläche beträgt 29.800 Quadratkilometer. Armenien
grenzt im Norden an Georgien, im Osten an Aserbaidschan, im Süden an
die aserbaidschanische Exklave Nachitschewan und den Iran und im Westen
an die Türkei. Hauptstadt und mit rund einer Million Einwohnern größte
Stadt Armeniens ist Jerewan. Weitere wichtige Städte sind Gjumri,
Wanadsor und Wagharschapat mit der Kathedrale von Etschmiadsin
(UNESCO-Weltkulturerbe). Unter den dokumentierten Kriegsgefangenen der
russischen Armee befanden sich 191 Armenier. Diese stammten aus
verschiedenen Teilen des Russischen Reiches, vorwiegend aus den
Bezirken Erivan, Elisabetpol, Tiflis und Baku. Die 191 Armenier wurden
in den Lagern Eger, Reichenberg, Theresienstadt, Bruck-Kiralyhida,
Grödig, Wieselburg an der Erlauf, Hart und Spratzern dokumentiert. Von
ihnen sind unterschiedliche Listen, Messblätter, ethnographische
Aufzeichnungen und Fotografien erhalten, sowie auch acht Gipse. Drei
Kriegsgefangenen wurden mit dem Phonographen aufgenommen. Josef
Weninger veröffentlichte 1951 den Band „Armenier. Ein Beitrag zur
Anthropologie der Kaukasusvölker", in dem er die Ergebnisse der
Forschung, sowie Fotografien ausgewählter armenischer Kriegsgefangener
anonymisiert präsentierte.
Die Frage nach dem Menschen hinter einer Archivnummer stand im
Mittelpunkt eines österreichisch-armenischen Forschungsprojekts unter
der Leitung von Univ. Doz. Dr. Dr. h.c. Jasmine Dum-Tragut
Bakk.rer.nat., Armenologin an der Universität Salzburg. Eine
Spurensuche, die ihren Anfang im Archiv Pöch in Wien nahm, über
österreichische, russische und armenische Archive und schlussendlich in
die Heimat der Kriegsgefangenen, nach Armenien, führte. Die Ergebnisse
der Forschung wurden 2019 in einer Ausstellung am Genozidmuseum in
Jerevan (Armenien) präsentiert. Fotos, Pläne und Leihgaben von den
Kriegsgefangenenlagern Wieselburg, Mühling und Purgstall bereicherten
die Ausstellung in Armenien.
Auf den Lagerfriedhöfen in Wieselburg und Purgstall fanden in den
Jahren des Ersten Weltkriegs auch armenische Kriegsgefangene ihre
letzte Ruhestätte. Im Lagerfriedhof in Purgstall befinden sich sechs
Armenier. Jasmine Dum-Tragut hat die aus dem Sterberegister zur
Verfügung stehenden Informationen durch weiteres Archivmaterial
ergänzt.
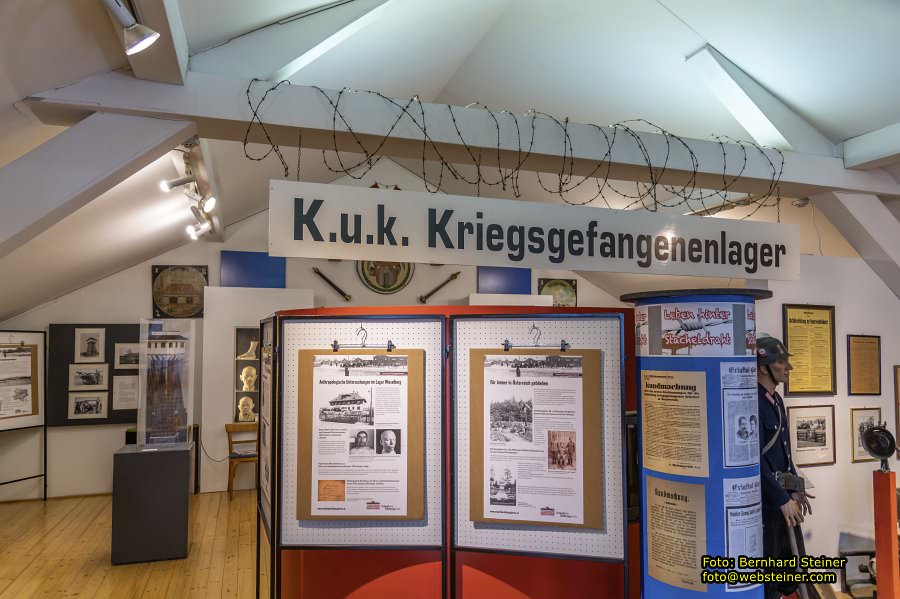
Anthropologische Forschungen an Kriegsgefangenen
Der Erste Weltkrieg bot Forschern unterschiedlichster Disziplinen die
Gelegenheit ihren Forschungsinteressen in den Kriegsgefangenenlagern
nachzugehen. Rudolf Pöch (1870-1921) war ein österreichischer
Mediziner, Ethnograph, Anthropologe und Forschungsreisender. Nach dem
Pöch 1897 in Bombay und 1902 in Afrika gedient hatte, unternahm er ab
1904 Expeditionen nach Neu-Guinea, Indonesien, Australien und in die
Kalahari. 1913 wurde er zum Professor für Anthropologie und Völkerkunde
ernannt und leitete das Institut für Anthropologie und Ethnographie an
der Universität Wien. Im Auftrag der Anthropologischen Gesellschaft
Wien und der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften führte er
umfangreiche Studien in den Kriegsgefangenenlagern durch. Zwischen 1915
und 1918 dokumentierte Pöch etwa 7.000 Kriegsgefangene. 5.000
Fotografien, Phonogrammaufnahmen, Kurzfilme und etwa 300 Gipsformen
wurden hergestellt.
Rudolf Pöch führte auch im Lager Wieselburg anthropologische
Untersuchungen an russischen und serbischen Kriegsgefangenen vom 18.
bis 24. Dezember 1916 und vom 1. bis 6. Jänner 1917 durch und
dokumentierte dabei insgesamt 117 Personen, darunter 104 russische
Kriegsgefangene (25 Slawen, 4 Balten, 33 Finno-Ugrier, 23 Turkstämmige,
5 Balkanvölker und 14 Kaukasier). Unter den letzteren befanden sich 12
Armenier, die alle am 3. Jänner 1917 vermessen und befragt wurden.

Der Erste Weltkrieg
Der wachsende Gegensatz zwischen den europäischen Großmächten gegen
Ende des 19. Jahrhunderts führte zur Bildung von militärischen
Bündnissystemen: der Dreibund (Mittelmächte) - Deutsches Reich,
Österreich-Ungarn und Italien (allerdings mit wechselnden Interessen)
stand der Entente Frankreich, Russland, Großbritannien gegenüber. Der
Gegensatz Deutsches Reich zu Frankreich war noch durch den Krieg von
1870 bestimmt, der Konflikt mit dem Britischen Königreich vor allem
durch die Frage nach der Vormachtstellung zur See. Österreich-Ungarn
stritt mit Russland um die Vormachtstellung am Balkan. Der junge Staat
Serbien, mit dem mächtigen Russland verbündet, versuchte alle Südslawen
in einem Staat zu vereinigen. Dadurch zog er sich die Feindschaft der
Donaumonarchie zu, weil vor allem die slawische Bevölkerung des
Vielvölkerstaates vehement auf eine, wie auch immer definierte,
Loslösung von Wien drängte. Als 1908 Österreich-Ungarn das bereits
besetzte, mehrheitlich von Südslawen bewohnte Bosnien annektierte,
schien ein Krieg bereits unvermeidlich. Doch erst das Attentat auf das
österreichische Thronfolgerpaar Franz Ferdinand und Sophie am 28. Juni
1914 in Sarajewo wurde zum Auslöser des Krieges, wobei die Ausweitung
des Konfliktes zu einem Weltkrieg nicht im Interesse Österreichs lag.
Die Mitglieder der Bündnissysteme hatten den Weltkonflikt nicht gerade
gewollt, aber ihn doch auch keineswegs gescheut.
Kriegsgefangenenlager in der österreichisch-ungarischen Monarchie
Der Erste Weltkrieg führte schon bald nach seinem Ausbruch zu
Verhältnissen, wie sie in der Kriegsgeschichte zuvor niemals
vorgekommen waren. Dies traf auch auf die ungeheuer große Zahl der
Kriegsgefangenen zu. Hat sich schon die bloße Unterbringung dieser
Menschenmengen als ein schwer zu lösendes Problem dargestellt, so
gesellte sich als besonders erschwerendes Moment die Entstehung
verheerender Seuchen hinzu, die bald nach Kriegsbeginn im Kriegsgebiet
auftraten und durch Übertragung der Krankheitserreger sich auch in den
im ersten Ansturm für die Kriegsgefangenen geschaffenen, notdürftigen
Provisorien und Barackenbauten in großem Maße auszubreiten drohten. Die
Kriegsgefangenen sollen in großen Lagern zusammen gefasst werden, um
sie einerseits einfach zu bewachen und verwalten zu können.
Andererseits um die Zivilbevölkerung vor jenen Seuchen, deren Träger
die Kriegsgefangenen anfangs waren, dauernd und sicher zu schützen. Es
entstanden somit in kürzester Zeit große Barackenstädte, bei deren Bau
die modernsten Errungenschaften der Technik und die neuesten
Erfahrungen auf dem Gebiet der Hygiene verwertet wurden. Mehr als
80.000 Gefangene und Bewachungssoldaten lebten von 1915 bis 1918 in
solchen Lagern in den niederösterreichischen Gemeinden Wieselburg,
Mühling und Purgstall.

Lagerfeuerwehren
Auf feuerpolizeiliche Vorkehrungen wurde auf Grund der vielen
Holzbaracken in allen drei Lagern großer Wert gelegt. In den Lagern
Wieselburg und Purgstall befanden sich zwei, in der Offiziersstation
Mühling eine Feuerspritze. Überdies befand sich im Lager Wieselburg für
alle Lager eine Benzinmotorspritze. Im Lager Purgstall standen 43
Hydranten und sechs Wasserbetonreservoirs mit je 25 Kubikmeter
Wasserinhalt zur Verfügung. Im März 1918 bestand die Lagerfeuerwehr
Purgstall aus 30 Mann eigener Mannschaft sowie 52 kriegsgefangene
Russen, die gut ausgebildet waren.
Brände im Lager
In den Lagern fanden verschiedene lokale Brände statt, die aber rasch
von den Lagerfeuerwehren gelöscht werden konnten. Der folgenschwerste
Brand fand im Kriegsgefangenenlager Wieselburg in der Nacht vom 24.
Dezember auf den 25. Dezember 1917 statt, dem das Verwaltungsgebäude im
Lager I zum Opfer fiel. Dieser Brand war sehr mysteriös und warf viele
Fragen auf.
Brände außerhalb der Lager
Am 2. April 1916 stand ein Teil des Sägewerkes des Herrn Emanuel
Angerer in Purgstall in Brand. Weiters brannte ein gefüllter Schuppen
mit trockenen Brettern sowie das angebaute Wohngebäude des
Sägearbeiters. Die Feuerwehr Purgstall war durch die Kriegslage
ziemlich dezimiert und dadurch war die Mithilfe durch die
Lagerfeuerwehr von großer Bedeutung.

Lagerablauf
Die Kriegsgefangenen wurden mit der Eisenbahn in das Erlauftal gebracht
und bei ihrem Eintreffen im Lager Wieselburg zuerst im Kontumazlager
(Quarantänelager) untergebracht und nach längerer Kontumazierung und
Beobachtung in der Zentral-reinigungsanstalt, in welcher binnen 24
Stunden 3.000 Mann gebadet, gereinigt sowie deren Kleider und Wäsche
desinfiziert werden konnten, untergebracht. Erst nach gründlicher
Reinigung, Desinfizierung und ärztlicher Untersuchung kamen sie in das
eigentliche Lager. Die Kriegsgefangenen waren in Baracken mit einem
Fassungs-raum von 200 Mann untergebracht und lagen auf Holzpritschen.
Entlausung
Die ankommenden Transporte wurden nach ihrem Einlangen einer ärztlichen
Musterung unterzogen, verköstigt und unmittelbar nachher partienweise
entlaust. Den Gefangenen wurden die Haare geschnitten und jeder erhielt
reine Wäsche. Die Bekleidungsstücke der Kriegsgefangenen wurden
inzwischen der Dampfdesinfektion unterzogen. Pelze und Kappen wurden in
die Schwefelungskammern gebracht. Wertlose Gegenstände, unbrauchbare
Kleider und Wäschestücke wurden im Verbrennungsofen verbrannt. Der
gebadete Mann wurde nackt einer neuerlichen ärztlichen Untersuchung
unterzogen und im Anschluss mit Schutzpockenlymphe geimpft.
Proteste der Bevölkerung
Nach Dienstschluss verbrachten manche Offiziere einen vergnügten Abend
mit Musik in den umliegenden Gasthäusern. Die Bevölkerung reagierte
daraufhin mit Protesten in diversen Zeitungen, da ihre Angehörigen im
Fronteinsatz waren, während sich die Offiziere zu Hause vergnügten.
Originalgipsabguss von einem russischen Kriegsgefangenen anlässlich anthropologischer Untersuchungen von Dr. Rudolf Pöch

Im Mai 1916 wurde der Maler Egon Schiele
von Wien nach Mühling in die Provianturkanzlei der Station für
kriegsgefangene Offiziere versetzt. Am 3. Mai 1916 traf er in Mühling
ein. Bis Jänner 1917 lebte Schiele, teilweise mit seiner Gattin Edith
und seinem Hund Lord, im Erlauftal. Egon Schiele führte minuziös ein
Kriegstagebuch.
Egon Schiele & Egon Schiele (Mitte) mit Kameraden
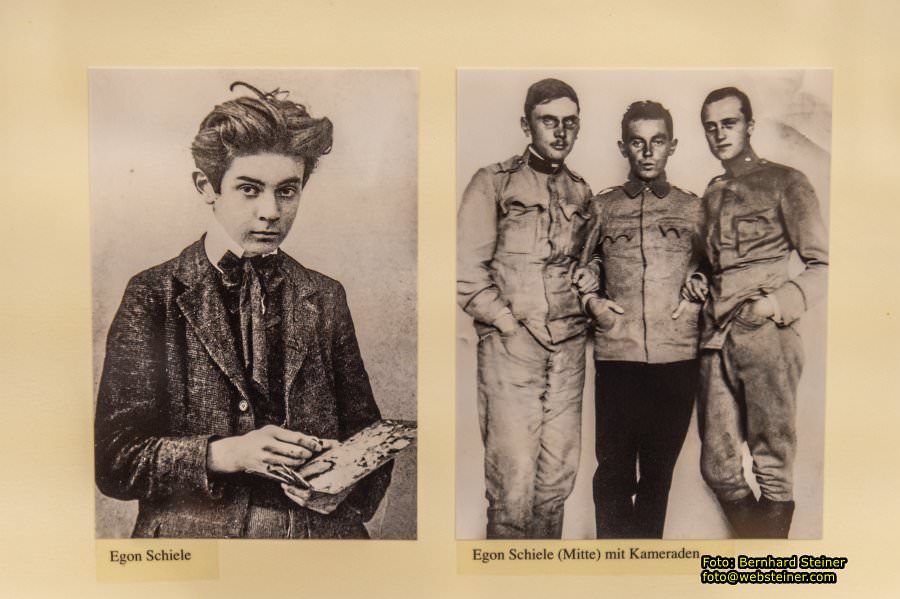
Bau von Kriegsgefangenenlagern
In der ehemaligen österreichisch-ungarischen Monarchie offenbarten sich
bald nach Ausbruch des Ersten Weltkrieges auf allen Gebieten der
Kriegsführung Verhältnisse, wie sie in der Kriegsgeschichte niemals
zuvor vorgekommen waren, so auch hinsichtlich der ungeheuer großen Zahl
von Kriegsgefangenen. Im Verlauf des Ersten Weltkrieges gerieten rund 8
bis 9 Millionen Soldaten in feindliches Gewahrsam, die Mehrheit der
Kriegsgefangenen, etwa 5 Millionen bis zum Jahr 1917, allein an der
„östlichen" Front. Vertraut man offiziellen Schätzungen, so befanden
sich rund 2,9 Millionen Soldaten in Lagern des Russischen Zarenreichs,
2,5 Millionen im Deutschen Reich und rund 1,9 Millionen in
Österreich-Ungarn. In Lagern des Russischen Zarenreichs waren ungefähr
160.000 Deutsche und mehr als 2 Millionen österreich-ungarische
Heeresangehörige interniert. Umgekehrt befanden sich 1,4 Millionen
Soldaten des Russischen Zarenreichs im Deutschen Reich und etwa 1,27
Millionen in Österreich-Ungarn. Von den etwa 1,9 Millionen
Kriegsgefangenen in der Habsburgermonarchie stellten daher Angehörige
der Zarenarmee weit mehr als die Hälfte, gefolgt von rund 369.000
Italienern, 155.000 Serben und anderen. Ein schwer zu lösendes Problem
war, die Entstehung verheerender Seuchen zu verhindern, die bald nach
Kriegsbeginn auftraten. In den notdürftigen Provisorien und
Barackenbauten für die Kriegsgefangenen konnten sich die
Krankheitserreger rasch ausbreiten.
Um die Zivilbevölkerung vor jenen Seuchen zu schützen, entstanden in
kürzester Zeit in den einzelnen Militärkommandobereichen große
Barackenstädte, bei deren Bau die modernsten Errungenschaften der
Technik und die neuesten Erfahrungen auf dem Gebiet der Hygiene
angewendet wurden. In Niederösterreich wurden im Jahr 1915 unter
anderem Kriegsgefangenenlager im Erlauftal, in den Gemeinden
Wieselburg, Mühling und Purgstall, errichtet. Durch die erfolgreich
bekämpfte Seuchengefahr und die dadurch erreichte Gesundheit der
Kriegsgefangenen konnten diese als Arbeitskräfte in den verschiedenen
Betrieben des Hinterlandes wie auch im Bereich der Armee eingesetzt
werden. Die Kriegsgefangenenlager leerten sich allmählich wieder, bis
auf die Schonungsbedürftigen, Kranken und den Beschäftigten in den
Eigenbetrieben der Lager. Die Kriegsgefangenenlager des Erlauftales
sind im Hinblick auf ihre grundsätzlichen Strukturen nicht mit jenen
des Zweiten Weltkrieges zu vergleichen.
Originalgipsabgüsse von russischen Kriegsgefangenen anlässlich anthropologischer Untersuchungen von Dr. Rudolf Pöch
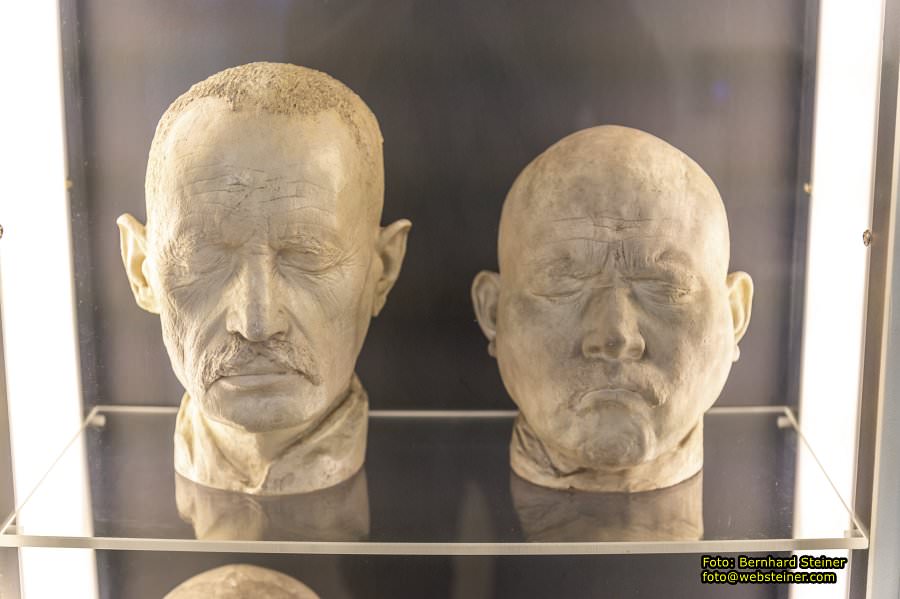
Bewachung - Fluchtversuche
Auf die Bewachung der Kriegsgefangenenlager wurde großer Wert gelegt.
Jede Wohn-, Werkstätten- und Verpflegsgruppe war eingefriedet.
Insgesamt wurden 21 Hochstände und 18 Schilderhäuser für die äußere
Bewachung errichtet. Viele Fluchtversuche fanden nur deshalb statt, um
an Lebensmitteln zu kommen.
Mitrailleusen-Abteilung
Für den Fall eines Aufruhrs im Lager Purgstall hatten die Wachposten
auf den Hochständen anfangs Handgranaten in versperrbaren Holzkästchen
zur Verfügung. Später wurden zwei Mitrailleusen stationiert.
Mitrailleusen waren geschützähnliche, mehrläufige, mit der Hand zu
kurbelnde Maschinenwaffen von Gewehrkaliber, Vorgänger der
Maschinengewehre.
Schießstätte
Für die Ausbildung der Wachtruppen im Gebrauch der Feuerwaffen wurde in
Mühling eine Schießstätte für die Lager Wieselburg, Mühling und
Purgstall errichtet. Die Schießübungen der Wachmannschaften hatten zum
Unterschied der Fronttruppen lediglich den Zweck, die Mannschaft an den
scharfen Schuss zu gewöhnen, dass diese als Posten oder bei Assistenzen
von ihrer Waffe Gebrauch machen konnten. Ein Großteil der
Wachmannschaften hatte nämlich noch nie mit einem Gewehr geschossen.
Abhärtung der Wachmannschaft
Aus Reinlichkeitsgründen aber auch zur Abhärtung badete die Mannschaft
im Sommer wöchentlich zweimal im Freien, in einem bestimmten Teil der
Großen Erlauf. Im Winter und in der kühlen Jahreszeit fand das Baden
wöchentlich einmal in einem geschlossenen Raum statt.

Omnia - Pumpe, Firma Knaust, um 1884

Einfache, aus Holz gefertigte Handspritzen, auch Stockspritzen genannt,
gab es vereinzelt bereits seit dem 14. Jahrhundert. Im 17. Jahrhundert
wurden Handdruckspritzen, die man in Eimer oder Bottiche stellte,
verwendet. Mit ihnen konnte Wasser gepumpt oder verspritzt werden doch
gab es keine Möglichkeit das Wasser mit diesen Geräten anzusaugen.
Verbesserte Modelle standen erst ab ca. 1800 zur Verfügung.

Vor Gründung einer Feuerwehr
Bis zum 19. Jahrhundert war grundsätzlich jeder Einwohner verpflichtet
im Brandfall Hilfe zu leisten. Die Josephinische Feuerordnung von 1782
legte bereits die Ausrüstung der einzelnen Gemeinden mit Löschgeräten
fest. Löscheimer, Einreißhaken und einfache Stockspritzen waren damals
die üblichen Geräte. Dem Nachtwächter kam bezüglich der Entdeckung von
Bränden besondere Bedeutung zu.
Nachtwächter mit Hellebarde, Laterne und Stechuhr

Trinkhorn, 1881, FF-Purgstall/Erlauf
H. Florian, Hinterglasbild aus Sandl/OÖ
Heiliger Florian, Schutzpatron der Feuerwehr


Damenballspenden bei Feuerwehrbällen um 1900

Tanzbüchlein für Damen um 1900
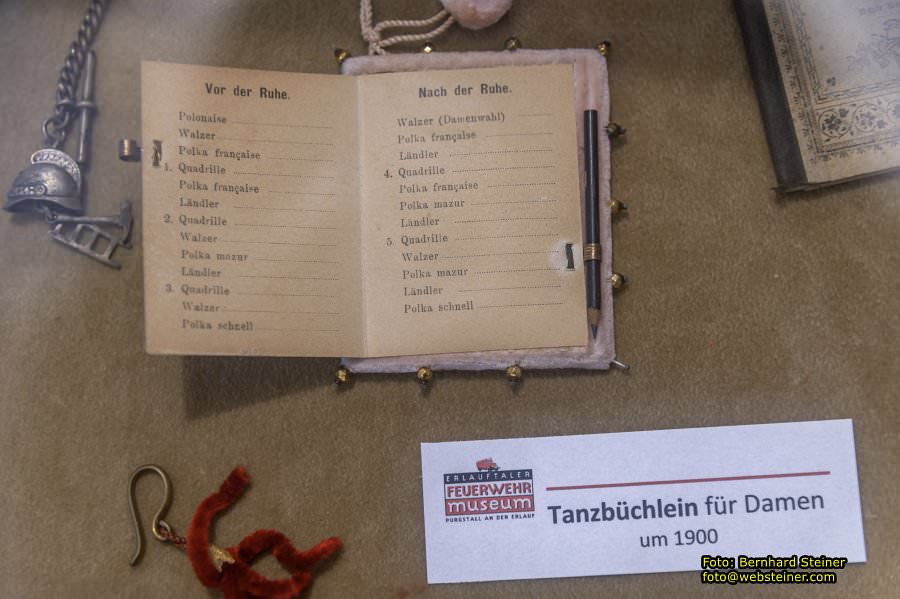
Löschfahrzeug - Allrad - LFA - Steyr
Für die Deutsche Wehrmacht wurde dieses Fahrzeug der Type 1500 A,
Baujahr 1943, Nutzleistung 80 PS, gebaut. 1949 wurde es von der
Feuerwehr Leonstein, Bezirk Kirchdorf, OÖ, als Löschfahrzeug mit
offenem Aufbau adaptiert. 1977 ging es in den Besitz eines
Oldtimersammlers über und 1993 wurde es vom Erlauftaler Feuerwehrmuseum
erworben.
Steyr 1500A, 8 Zylinder Motor, luftgekühlt, Baujahr 1943

Löschfahrzeug- Allrad - LFA - Morris
Dieser Waffentransporter der Type Morris 1 to, Baujahr ca. 1940,
Nutzleistung 70 PS, wurde von der britischen Armee verwendet. 1955
erwarb die Feuerwehr Lauterbach, Bezirk Kirchdorf, OÖ, das Fahrzeug ünd
adaptierte es als Löschfahrzeug. Bis 1992 stand es in Lauterbach im
Einsatz und wurde dann vom Erlauftaler Feuerwehrmuseum angekauft.

Leichtes Löschfahrzeug - LLF - Opel Blitz
Bei der Feuerwehr Gaming, Bezirk Scheibbs, stand diese Type, Baujahr
1959, Nutzleistung 58 PS, in Verwendung. 1991 wurde es vom Erlauftaler
Feuerwehrmuseum angekauft.
Opel Blitz, Leichtes Löschfahrzeug, Baujahr 1959

Tanklöschfahrzeug 1500 - TLF 1500 - Opel Blitz
Bei der Feuerwehr Krems, Wache Stein, wurde von 1961 bis 1972 dieses
Fahrzeug der Type 3.6-36-30, Baujahr 1939, Nutzleistung 75 PS,
verwendet. Von 1972 bis 1984 stand es bei der Feuerwehr Purgstall im
Dienst. In den Jahren 1991 und 1992 wurde das Fahrzeug in 1300
freiwilligen Arbeitsstunden restauriert und repräsentiert nun ein
typisches Wehrmachtsfahrzeug, das in der Nachkriegszeit aufgebaut und
mit einer Vorbaupumpe versehen wurde.
Opel Blitz, Tanklöschfahrzeug, Baujahr 1939

FEUERWEHR PURGSTALL
Am 29. September 1870 wurde die Freiwillige Feuerwehr Purgstall von Dr.
Gustav Bergwald gegründet. Anton Nurscher wurde zum ersten Kommandanten
gewählt. Die Marktgemeinde Purgstall, die Gutsinhabung und die Pfarre
stellten ihre Löschrequisiten zur Verfügung. Noch im selben Jahr wurde
das Feuerwehrhaus in der Feichsenstraße erbaut. 1878 errichtete die
Feuerwehr einen Steigerturm. Am 6. Juli 1926 erhielt die Feuerwehr ein
Rüstfahrzeug der Marke FIAT und eine Motorspritze. 1945 erwarb die
Feuerwehr ein weiteres Auto und 1958 einen Tankwagen der Marke OPEL
BLITZ. 1971 wurde das erweiterte Feuerwehrhaus sowie das
Feuerwehrmuseum eröffnet. Am 5. September 1990 wurde mit dem Neubau des
Feuerwehrhauses begonnen. Am 20. September 1992 wurde das Feuerwehrhaus
und das darin untergebrachten Erlauftaler Feuerwehrmuseum eröffnet.

Wem der viele Text zu lange war und lieber Bewegtbilder mit Musik mag,
kann sich gerne dieses Video antun:
Erlauftaler Feuerwehrmuseum, Purgstall/Erlauf, Juni 2023: