web steiner
Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen
Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.
+43/2624/54014 - office@websteiner.com
Schloss Greillenstein
Renaissanceschloss bei Horn im Waldviertel, September 2023
Schloss Greillenstein ist ein Renaissance-Schloss im
Ort Greillenstein in der niederösterreichischen Gemeinde Röhrenbach.
Die Geschichte des Schlosses ist eng mit dem Adelsgeschlecht Kuefstein
verbunden. Das Gebäude ist seit 1534 im Privatbesitz der Familie
Kuefstein und ist seit den 1960er-Jahren nicht mehr bewohnt, sondern
dient als Museum. Es ist damit eines der ersten Schlösser, die als
Museum der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden.

Das Schloss Greillenstein ist eine vierflügelige Anlage um einen
quadratischen Innenhof, in dem sich mehrere Barockvasen befinden, die
von Johann Bernhard Fischer von Erlach entworfen wurden. Die
Inneneinrichtung ist zum überwiegenden Teil noch im Originalzustand
erhalten und wurde teilweise ergänzt. Das Gebäude besitzt zwei
Hauptgeschoße. Im Süden befindet sich ein großer Torturm. Über den
Schlossgraben führt eine Brücke mit barocken Steinfiguren. Vor dem
Schloss liegt ein englischer Landschaftsgarten, der im 17. und 18.
Jahrhundert angelegt wurde.

Von Beginn an lag das Schloss inmitten einer Gartenanlage. Blütezeit
war das 18 Jahrhundert als Park und Garten in barocker Manier
neungestaltet wurden. Aus dieser Zeit stammen die beeindruckenden
Baumalleen, Balustraden und Sandsteinzwerge. Zwischen Schloss und
Obstgarten erstreckten sich die barocken Gärten, die durch den Bau der
öffentlichen Straße um 1900 zerstört wurden. Heute stellt sich dieser
Raum als Landschaftspark dar.

Neben dem Schloss, unter hohen Bäumen, geschützt durch eine dichte
Buschreihe verbirgt sich der Zwergengarten, in dem etwa 60 Jahre die
barocken Zwerge standen, bevor sie endgültig ins Schloss in Sicherheit
gebracht wurden. Heute ist dieser trockene Schattengarten für Kenner eine Fundgrube
botanischer Besonderheiten. Künstler haben hier Märchen und Sagen, in
welchen Zwerge eine tragende Rolle spielen, neu interpretiert.

Die erste Erwähnung einer kleinen Wehrburg, welche im Besitz der
Grellen war, stammt aus dem 12. Jahrhundert. Nach dem Aussterben der
Grellen um 1313 wechselte der Besitz mehrmals, unter anderem an die
Familien Dachpeckh und Volkra, bis Hans Lorenz von Kuefstein die Burg
im Jahre 1534 durch Kauf erwarb. Die Familie Kuefstein war
höchstwahrscheinlich im 13. Jahrhundert aus Kufstein in Tirol ins
Donautal gekommen, wo sie in Spitz an der Donau Pfleger waren und
später Besitzungen erwarben. Als Mitgift seiner Frau erhielt Hans Jacob
von Kuefstein 1414 die kleine Burg Feinfeld im Nachbarort von
Greillenstein. Damit wurde die Familie im Waldviertel ansässig.

Unter Hans Georg III. Freiherr von Kuefstein, Vicedom
(Landeshauptmann-Stellvertreter) und Vertreter der protestantischen
Stände in Niederösterreich, wurde die Festung Greillenstein abgerissen.
In den Jahren 1570 bis 1590 wurde das prächtige Renaissanceschloss mit
seinen Nebengebäuden erbaut und ist bis heute in seinen Ausmaßen
unverändert geblieben. Das Schloss diente dem Erbauer und seinen
Nachfolgern primär zur Repräsentation und als Sitz einer
Grundherrschaft. Trotz ihrer protestantischen Gesinnung blieb die
Familie stets dem Kaiser treu ergeben und bekleidete hohe Stellen in
der Verwaltung, bei Hof und im kaiserlichen Heer. Eine Auszeichnung,
die nur wenigen protestantischen Familien zuteil wurde.

Im Verlauf des Dreißigjährigen Krieges traten die Kuefsteins zum
katholischen Glauben über. In der Anfangsphase des Krieges musste
jedoch der protestantische Hans Jakob Freiherr von Kuefstein das
Schloss verlassen, als sich hier im Jahre 1620 Feldmarschall Graf
Bouquoy, Befehlshaber des kaiserlichen Heeres, mit Graf Tilly,
Feldmarschall des Herzogs Maximilian von Bayern, traf. Die beiden
Feldherren dürften das gemeinsame Vorgehen, welches schließlich zur
Schlacht am Weißen Berg führte, in Greillenstein geplant haben. Ein
Jesuitenpater im Gefolge Tillys berichtet in seinem Tagebuch, dass sie
während ihres Aufenthaltes in Greillenstein die protestantischen
Schriften aus der Bibliothek verbrannten. Vor den Übergriffen der
schwedischen Truppen, die um 1645 durch das Waldviertel zogen, blieb
Greillenstein verschont.

Nach dem Dreißigjährigen Krieg war das Land ausgeblutet. In Röhrenbach,
einem Dorf der Grundherrschaft mit etwa zwanzig Höfen, haben nur acht
Menschen die Gräuel des Krieges überlebt. Die Folge davon war eine
schwere wirtschaftliche Krise. Durch Umstellungen der Bewirtschaftung
des Landes konnte ein neuer Aufschwung und damit die Erhaltung der
Herrschaft Greillenstein gesichert werden. Das 18. Jahrhundert brachte
der Region lange Jahre des Friedens und Wohlstandes. In dieser Zeit
wurde dem Schloss durch harmonische Veränderungen und Ergänzungen im
barocken Stil ein neues Gesicht gegeben.

Eine weitere schwere Krise erlitten der Besitz und die Grundherrschaft
Greillenstein allerdings durch die Einquartierung französischer Truppen
von Juli bis Dezember 1809. 383 Stabs- und Oberoffiziere mit 639
Dienern, Unteroffizieren, Gemeinen und 1404 Pferden mussten versorgt
werden. In diesen Monaten wurden nicht nur ein Teil der Möbel zerstört,
sondern auch die Vorräte der Grundherrschaft erschöpft. Nach dem Abzug
der französischen Garnison war der Besitz in einem so beklagenswerten
Zustand, dass Johann Ferdinand III. Graf von Kuefstein den Besitz dem
Kaiser zum Kauf anbot. Dieser lehnte allerdings ab und beauftragte
Johann Ferdinand III., die Herrschaft Greillenstein wieder in Stand zu
setzen. Durch seine sehr bescheidene Lebensweise und sein
wirtschaftliches Geschick gelang ihm das auch.

Nach der Auflösung der Grundherrschaften verlor das Haus seine Aufgabe
als Amtsgebäude und seine Besitzer eine wesentliche Einkommensquelle.
Der oftmaligen Abwesenheit der Besitzer, bedingt durch ihre Tätigkeiten
im diplomatischen Dienst, verdanken wir heute den Erhalt der
Originaleinrichtung des Gerichtssaales und der Registratur.

Dass Greillenstein die russische Besatzung so schadlos überstand,
verdankte es dem Offizier, der das Kommando in Horn und Umgebung hatte.
Dieser besichtigte das ganze Haus und positionierte zwei mit
Maschinengewehren bewaffnete Wachen vor dem Schloss, mit dem Auftrag,
keinen russischen Soldaten ins Haus zu lassen.

Bis 1959 war das Schloss, welches auch heute noch im Besitz der Familie
Kuefstein ist, bewohnt. Schließlich entschied man sich, das Haus als
Museum zu öffnen und den Besuchern ein lebendiges Bild des Lebens und
des Verwaltungswesens bis zum Jahre 1848 zu vermitteln.

Zu wenig und zu viel verderbet alle Spiel
Spielen muss man brauchen wie das Salz, haben diese gesagt, also dass
kein Essen daraus werde. Vornehmlich aber muss bey forthander
zugelassen Lust das Absehen dahin gerichtet werden, daß solche ohne
Versäumung des Gottesdienstes, ohne Hintansetzung der ordentlichen
Beruffs Arbeit, ohne böse Gesellschaft, ohne Verletzung des Gewissens,
[...] ohne Verschwendung des Geldes, und nothdüfftiger Nahrungs Mittel
geschehen möge.
Überdise, ob gleich solch Spielen ein Glück menschlicher Freiheit, und
also ein weltlich Mittel-Ding ist, so muß doch haben auch eine gewisse
Ordnung, sonderbarer Regel und Lehr-Sätze jederzeit in acht genommen
werden.
Aus: „Palamedes Redivivus", Leipzig 1755

Das Schachbrett
Es besteht aus acht waagrechten und acht senkrechten Reihen. Also sind
es 64 Felder (8x8). Die Felder sind abwechselnd Weiß und Schwarz. Die
waagrechten Reihen werden von 1 bis 8 durchnummeriert und die
senkrechten Reihen werden als a bis h bezeichnet.
Die Grundstellung
Das Schachbrett sollte man immer so legen, daß rechts unten ein weißes
Feld ist. Der Spieler, der die weißen Figuren hat, sollte auch die
Nummerierung von 1 bis 8 anfangen. Also sollte das Feld links unten als
a1 bezeichnet sein. Die Grundstellung ist vor jedem Spiel die gleiche.
Von Weiß aus gesehen, stehen auf der zweiten Reihe die Bauern. Links
und rechts am Rand in der ersten Reihe stehen die Türme (Turmform).
Daneben kommen die Springer (Pferdekopfform). Dann kommen die Läufer.
Dann gibt es eine Regel für die Damen: Weiße Dame auf weißes Feld,
schwarze Dame auf schwarzes Feld. Neben die Dame kommt der König (der
König ist die größte Figur).

Spielen ist offensichtlich ein dem Menschen angeborener Zeitvertreib,
denn Spiele findet man schon sehr früh in allen Kulturen rund um den
Erdball. Das Würfeln mit kleinen Knochen (Astragalen) von Ziegen oder
Schafen lässt sich auf die Jungsteinzeit zurückverfolgen. Die ersten
Zeugnisse von in Stein geritzten Spielfeldern findet man in Kleinasien
und Ägypten. Das relativ junge Kartenspiel taucht erst im Mittelalter
auf. Die Spiele werden in drei Kategorien eingeteilt: Würfelspiele,
Brettspiele und Kartenspiele. Wobei es aber auch Mischformen gibt. In
Laufe der Zeit wurden Spiele immer wieder verändert.


Geschichte der Gerichtsbarkeit
Es war eine langsame Entwicklung über 2000 Jahre die zu unserem
heutigen Rechtsystem führte. Im Mittelalter urteilte man nach dem
Gewohnheitsrecht, das regional sehr unterschiedlich sein konnte. Erst
ab dem Hochmittelalter und vor allem in der Neuzeit gewann das römische
Recht zunehmend an Bedeutung.
Frühes Mittelalter: Im germanischem Recht galt die Fehde,
d.h. der Geschädigte selbst, seine nahen Angehörigen oder sein Stamm
übte Vergeltung. Bezahlte der Täter oder dessen Sippe ein Sühnegeld -
meist in Form von Vieh - konnte die verletzte Sippe versöhnt werden und
vor weiterer Vergeltung Abstand nehmen.
Ca. 740: Die Lex Baiuvariorum
ist eine erste Aufzeichnung von Strafbestimmungen und beinhaltet
vorwiegend das Gewohnheitsrecht in Anlehnung an das römische Recht
Ende des 11. Jh.: Im ewigen Landfrieden von Kaiser Maximilian wird das mittelalterliche Fehderecht im ganzen Heiligen Römischen Reich verboten.
1275: Der Schwabenspiegel, der
auch in den österreichischen Erblanden benutzt wurde, basiert auf
römischen und kanonischem Recht, sowie den Reichsgesetzen Karls des
Großen und zeigt viele Parallelen zum 50 Jahre früher herausgekommen
Sachsenspiegel.
1311: Erste Erwähnung einer festen Hinrichtungsstätte
in Wien am Wienerberg bei der Spinnerin am Kreuz. Hier wurde vorwiegend
gehängt und gerädert, es fanden aber auch Verbrennungen statt - 1747
wurde die Hinrichtungsstätte an den Rabenstein (in der Nähe des
Schottentors) verlegt, da Kaiserin Maria-Theresia auf ihrem Weg nach
Laxenburg nicht am Galgen vorbeifahren wollte.
1338: Erste Erwähnung der Folter
als Mittel zur Wahrheitsfindung in der Charte von Brüssel. Die oftmals
willkürlich angewandte Folter führte zu zahlreichen Beschwerden über
ungerechte Bestrafungen und Hinrichtungen.
1436: Als Antwort auf diese Beschwerden verfasste der Jurist Conrad Heyden in Schwäbisch Hall den richterlichen Clagspiegel,
das erste Rechtsbuch in deutscher Sprache, das auf dem
römisch-deutschen Recht basiert. Der Clagspiegel gilt als wichtigstes
Werk für die Entwicklung zu Anwendung des römischen Rechts im Römisch
Deutschen Reich. Ab 1512 gilt Prof. Dr. Sebastian Brand als Herausgeber
des Clagspiegels, des bis 1612 über zwanzig Mal nachgedruckt wurde.
1532: Constitutio Criminalis Carolina
- deutsch: Peinliche Halsgerichtsordnung - Kaiser Karl V. beschloss mit
dem Reichstag die Herausgabe eines für sein ganzes Reich geltendes
einheitliches Gesetzbuch.
1656: Ferdindea die
Landgerichtsordnung für das Land unter der Enns von Kaiser Ferdinand
III. blieb bis in die zweite Hälfte des 17. Jahrhunderts in Kraft.
1768: Peinliche Gerichtsordnung Maria-Theresias, genannt Constitutio Criminalis oder Nemesis Theresiana,
das erste einheitliche für ganz Österreich gültige Strafgesetz. Darin
wurde die Folter genau reglementiert, aber noch nicht abgeschafft.
1776: Abschaffung der Folter zur Wahrheitsfindung im Strafgericht.
Maßgebend waren die Bemühungen des Juristen Josef von Sonnenfels und
des Arztes Ferdinand von Leber, der sagte: „Weil Unschuldige,
überwältigt von der Heftigkeit der Schmerzen, sich zu Verbrechen
bekannten, die sie nie begangen hatten."
1777: Suplementum Codicis Austriaci von Kaiserin Maria-Theresia beendete die Doppelgleisigkeit Codex Karls V. und den Landgerichtsordnungen.
1787: Das Strafgesetz Josef II.
beinhaltet weitreichende Reformen, die von vielen Gruppierungen
abgelehnt wurden - die Zeit war noch nicht reif dafür - daher wurden
einige der neuen Gesetzte nach seinem Tod wieder rückgängig gemacht.
1812: Inkrafttreten des ersten bürgerlichen Gesetzbuches herausgegeben von Kaiser Franz I.
1848: Auflösung der Grundherrschaften. Mit der Neuordnung der Verwaltung wurden die Gerichte unabhängig.
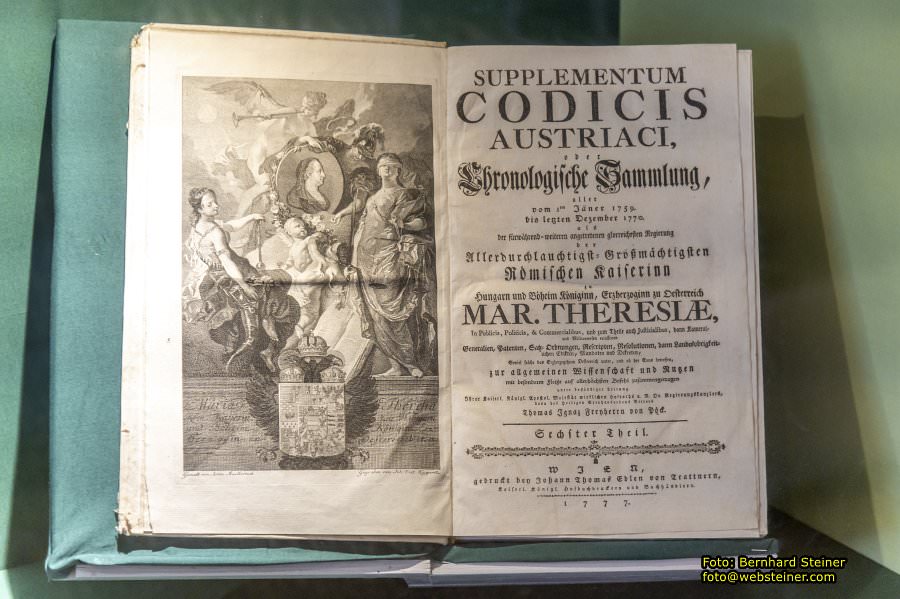
Urteil: 14 Tage in Ketten
Beim ersten Fall im Landgerichtsprotokoll von 1706, geht es um einen
Ehebruch: Georg Lackhner aus Röhrenbach hat sich mit der Witwe des
verstorbenen Pancraz Göbels aus Frankenreith fleischlich versündigt,
also einen einfachen Ehebruch begangen. Deshalb wurde er bei dem
Landgericht in Greillenstein verurteilt, in Eisen geschlagen und musste
14 Tage in Ketten arbeiten, weil er kein Geld besaß um die Strafe zu
zahlen. Danach wurde er wieder freigelassen.
Die Peinliche-Hals-Gerichtsordnung von Kaiser Josef I. widmete Ehebuch einen eigenen Paragraphen:
§24. Der Ehebruch ist eine Befleckung des fremden Ehebetts. Geschieht
es, dass ein Ehemann mit einer ledigen Weibsperson oder eine
verehelichte mit einer ledigen Mannsperson sündigt, werden diese je
nach Umständen willkürlich gestraft. Wenn sich aber eine Ehefrau mit
einem fremden Ehemann fleischlich zusammentun, dann sollen beide mit
dem Schwert vom Leben zum Tod gebracht werden. Weiters verlangt das
Gesetz, dass folgende Umstände bei einem Ehebruch zu hinterfragen und
bei einem Urteil zu berücksichtigen sind:
Wie oft?
Bei welcher Gelegenheit?
Ob jemand behilflich war?
Wie sie es gemacht haben nicht entdeckt zu werden?
Über die näheren Umstände erfahren wir in dem kurzen Eintrag im
Landgerichtsprotokoll nichts. Ein „einfacher Ehebruch" kann bedeuten,
dass es nur einmal passierte, oder dass nur Georg Lackhner als
Ehebrecher angesehen wurde, oder gar beides. In unserem Fall wird die
Witwe offensichtlich einer ledigen Frau gleichgesetzt. Daher passiert
ihr nichts und nur der Mann wird bestraft. Mildernde Umstände gab es
auch, wenn ein Mann zu einer Hure ging, auch wenn diese verheiratet
war. Noch etwas zeigt unser Fall: Schon damals gab es die Möglichkeit
ein Busgeld zu entrichten und damit die Strafe abzugelten, ähnlich
unseren heutigen Tagessätzen. Georg Lackhner hatte kein Geld, daher
bekam er 14 Tage Zwangsarbeiten in Ketten. Danach wurde er wieder
freigelassen, das heißt, nach abbüßen der Strafe war er wieder
rehabilitiert.

Das Landgericht in Greillenstein
Mit dem Kauf der Herrschaft Greillenstein 1534 übernahmen die
Kuefsteins die niedere Gerichtsbarkeit in der Grundherrschaft. 1634
belehnte Kaiser Ferdinand III Georg Adam Graf von Kuefstein mit dem
Blutbann, der hohen Gerichtsbarkeit. Das Landgericht Greillenstein
umfasste folgende Ortschaften: Greillenstein, Röhrenbach, Feinfeld,
Groß-Burgstall, Neubau, Fürwald, Wutzendorf, Frankenreith, Waiden,
Gobelsdorf, St. Marein, Atzelsdorf und zwei Mühlen. Nicht alle dieser
Ortschaften waren auch Teil der Grundherrschaft, denn die
Gerichtsbezirke waren nicht identisch mit den Grundherrschaften.
Wie es die Landgerichtsordnung vorschrieb war ein Justiziar, der die
Rechte studiert hatte, eingesetzt. Zugleich war der Richter auch der
Verwalter - Pfleger - in der Herrschaft Greillenstein. Wurde ein
Justiziar als Landrichter eingesetzt, so blieb er sein Leben lang an
diesem Landgericht. Als Landrichter und Pfleger war er in den Orten,
die zur Grundherrschaft und dem Gerichtsbezirk gehörten, für die
niedere und hohe Gerichtsbarkeit zuständig. In den Orten jedoch, die
nicht Teil der Grundherrschaft waren, wie Groß-Burgstall, war er nur
für die hohe Gerichtsbarkeit zuständig. Kam es zu einer Verhandlung,
dann musste ein Schreiber das Protokoll führen. Diese werden bis heute
in der Registratur aufbewahrt. Sie geben einen guten Einblick in die
Lebensweise des 18. Jahrhunderts und zeigen, dass die Urteile oftmals
viel milder ausfielen, als es das Gesetzbuch vorgab. So gab es in den
200 Jahren der hohen Gerichtsbarkeit in Greillenstein nur drei
Todesurteile. Folter ist gar keine nachzuweisen. Andererseits
erscheinen uns heute die Ehrenstrafen und Leibesstrafen in jedem Fall
als äußerst hart.
Das Gerichtsverfahren
Als Greillenstein ein Landgericht bekam, gab es bereits Regeln, wie ein Verfahren durchgeführt werden sollte.
Die Dokumentation der Verfahren wurde ausführlicher und umfangreicher.
In der Landgerichtsordnung „Ferdinandea" von 1656 wurde festgelegt, wie
ein Verhör abgehalten werden sollte und eine Oberbehörde der
Landesregierung sollte die Verfahren kontrollieren. Diese Behörde
musste ein peinliches Verhör genehmigen und nach der Kontrolle aller
Verhörprotokolle einen Urteilsvorschlag machen.
Begonnen wurde ein Verfahren mit der Anzeige einer Straftat. Diese
konnte von Klägern vorgebracht werden oder „ex officio", also durch das
Gericht selber. Nach der Verhaftung wurde eine summarische Aussage
aufgenommen, in der der Inquisit den Tatbestand aus seiner Sicht
erzählte. Danach verfasste der Richter eine Notanda mit den
Verhörfragen und den Zeugenaussagen oder Gutachten, die eingeholt
werden sollten. Am Beginn eines Verhörs sollte eine
Personalstanderhebung erfolgen: Wie er heisse?/ von wannen er
gebürtig?/ wer seine Eltern?/ wie alt?/ ob verheirath und Kinder habe?/
was seine Hantierung (Beruf)?/wo er sich aufhalte?/ was Religion?
- Ferdinandea -
Je nach Tatbestand gab es standardisierte Fragen, welche im Verhör
gestellt werden sollten. Der Angeklagte wurde mehrmals zu den
eingeholten Zeugenaussagen befragt. Das Kreuz auf der Gerichtsschranke
und der Schwur sollten die Verhörten zur Wahrheit verpflichten. In
Ermangelung kriminalistischer Hilfsmittel war ein Geständnis das
einzige und sichere Beweismittel. Die Furcht vor Strafen im „Jenseits"
sollten einen Meineid verhindern. Durchgeführt wurden die Verhöre von
einem Richter in Gegenwart von Beisitzern und von einem Schreiber. Im
Protokoll sollten möglichst die eigenen Worte des Verhörten
wiedergegeben werden. Nach drei Tagen wurde das Protokoll noch einmal
verlesen. Ein peinliches Verhör (Folter), mit genau festgelegten
Fragstücken, musste von der Oberbehörde der Landesregierung genehmigt
werden. Schließlich wurden die Protokolle zur Kontrolle an die Behörde
geschickt und diese kamen mit einem Urteilsvorschlag zurück. Nach der
Urteilsverkündung blieb dem Delinquent nur mehr die Möglichkeit ein
Gnadengesuch an den Landesfürsten zu stellen, um einer Strafe zu
entgehen.
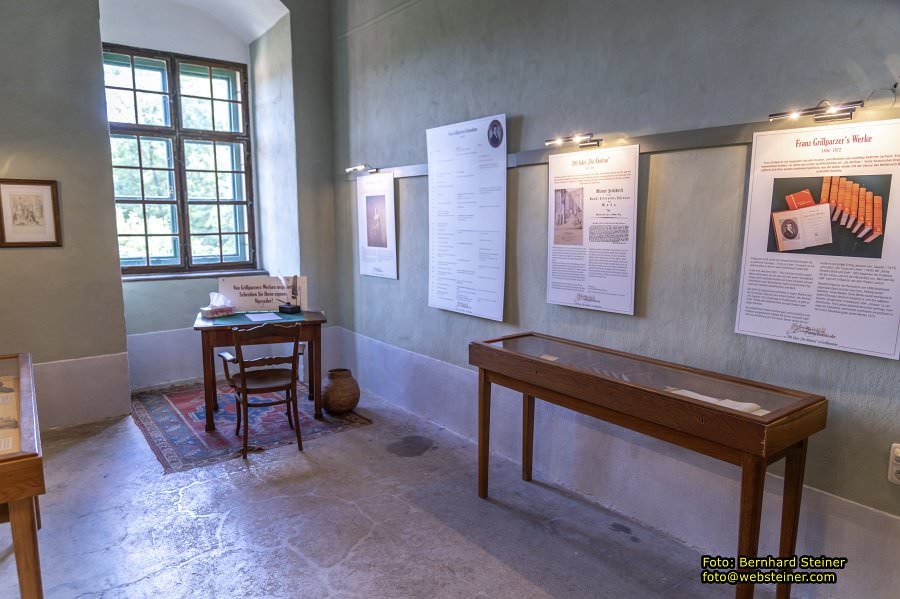
Franz Grillparzer's Werke 1804-1872
Franz Grillparzer hat insgesamt
vierzehn Dramen, zwei Novellen und unzählige Gedichte verfasst. Eines
der bekanntesten Dramen, vor allem sein erstes veröffentlichtes ist
„die Ahnfrau". Seine historischen Dramen und späteren Schriften wurden
zunehmend politisch, was ihn immer wieder mit der Zensur des Metternich
Regimes in Konflikt brachte.
Grillparzers Lyrik reicht von Gelegenheitsdichtungen bis zu politische
Aussagen. „Tristia ex Ponto" hingegen ist ein Gedichtzyklus in dem er
seine Gefühlswelt wiedergibt. In der Zeit zwischen 1820-1832 sind die
meisten seiner Werke entstanden, das ist auch die Zeit seiner
Verliebtheit. Einige seiner Gedichte wurden von Franz Schubert vertont.
Seine Reisen nach Deutschland, Italien Griechenland England und
Frankreich beeinflussten sein Werk. Den Stoff für seine Dramen entnahm
er Sagen, Mythen und der Geschichte. Stand bei den ersten Dramen „Die
Ahnfrau" und „Sappho" die Schuldfrage im Vordergrund, so geht es in der
Trilogie des Goldenen Vlies um das Streben nach etwas Höherem. Die
aufgeführten Dramen wurden ganz unterschiedlich vom Publikum
aufgenommen. Obwohl die Zensur versucht hatte 1830 die Aufführung von
"Ein treuer Diener seines Herren" ... wurde es ein großer Erfolg,
genauso wie „Sappho" (1819) und zuletzt „Der Traum ein Leben" (1840).
Mit „König Ottokars Glück und Ende" 1825 begannen die Probleme mit der
Zensur, und mit dem Misserfolg von „Weh dem der Lügt" zog sich
Grillparzer aus dem Theater zurück.
Obwohl Grillparzer der Revolution von 1848 ablehnend gegenüberstand,
brachte sein Epos „Feldmarschall Radetzky" einen Wandel. Seine Werke
wurde anerkannt er bekam Ehrungen dennoch weigerte er sich die späteren
Dramen „Bruderzwist in Habsburg" oder „Libussa" zu veröffentlichen.
Trotz seines testamentarischen Auftrags, man möge die Spätwerke,
verbrennen erschienen sie posthum in der ersten Gesamtausgabe seines
Werkes 1872.
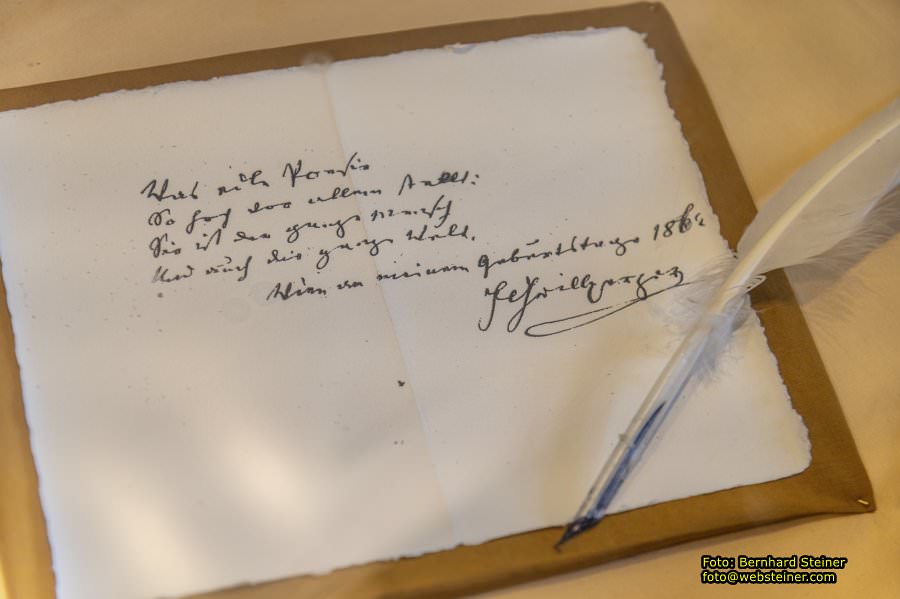
Franz Grillparzer auf Schloss Greillenstein 1807
Nur wenigen ist bekannt, dass Franz Grillparzer in seiner Jugend zu
Besuch im Waldviertel und Schloss Greillenstein war. Grund des Besuches
war die Krankheit der Mutter. Damit sie sich von ihrer Schwermütigkeit
erholen konnte wurden die Kinder zu Verwandten geschickt. Der älteste
Sohn Franz kam nach Greillenstein zu seiner Cousine Katharina Kroll.
Diese war mit dem Verwalter und Landrichter von Greillenstein, Franz
Xaver Cessner verheiratet. Wie Grillparzers Vater und Großvater
Christoph Sonnleither war der Verwalter Jurist. Wie lange Grillparzer
auf Schloss Greillenstein weilte, ist nicht bekannt Zeugniss seines
Besuches geben zwei Briefe an seine Eltern.
10. September 1807: Im Brief an seine Mutter schreibt er: ..[...] Es
gibt hier immer Unterhaltung. Theils kommen fremde Verwalter [...] zu
uns, und laden uns wieder ein. [...] so wie ich schon in der kurzen
Zeit, da ich hier bin, beim Hofrichter zu St. Bernhard, Pundschuh, der
den Papa gut kennt, und schon öfter mit Ihm zu thun gehabt hat,
eingeladen war, [...]"
15. September [1807?]: An seinen Vater schreibt er aus Burgschleinitz.
Greillenstein und Burgschleinitz waren damals im Besitz von
Johann-Ferdinand III. Graf von Kuefstein.

200 Jahre „Die Ahnfrau" 1817-2017
Die Ahnfrau, verfasst 1816 - 1817 ist sein erstes Drama in vier Akten.
Die Geschichte basiert auf einer Sage von dem französischen Räuber
Jules Mandrin und verschiedenen weiteren Schauergeschichten. Das
Trauerspiel „Die Ahnfrau" hatte am 31. Jänner 1817 im Wiener Theater an
der Wien seine Uraufführung. Die Kritiken zu diesem Stück waren sehr
kontrovers.
Wilhelm Hebenstreit, 1817: „Ich habe die Ahnfrau von der ersten
Vorstellung an für eine Verirrung eines poetischen Gemüts gehalten,
entstanden aus falschen Begriffen vom Wesen der Tragödie und ausgeführt
in der Meinung, das Hohe und Ansprechende in der Romantik getroffen zu
haben."
Das Werk „Die Ahnfrau" wurde in Wien, München, Dresden und Hamburg
aufgeführt. Grillparzer distanzierte sich in späteren Jahren selber von
seinem Werk.: „Wenn ich meine „Ahnfrau" jetzt lese mit all den
Gespenstern und Spukgestalten, so bin ich wohl geneigt, den Kritikern
recht zu geben, die diese Hinneigung zum Übernatürlichen tadeln; [...]"
Brief an Auguste von Littrow- Bischoff, Februar 1871.
Das Stück handelt von der „Ahnfrau", die zur Ehe gezwungen worden war,
sie konnte ihren früheren Geliebten nicht vergessen. Bei einem
heimlichen Treffen mit ihrem Geliebten, wurde sie vom Gatten ertappt
und aus Zorn mit einem Dolch ermordet. Mit dem selben Dolch ermordete
der Räuber Jaromir Graf Borotin. Erst durch den Diener Boleslav erfuhr
Jaromir, dass er mit Graf Borotin, seinen eigenen Vater ermordet hatte.
Nun erkannte Jaromir auch leidvoll, dass es sich bei seiner Geliebten
Berta, die er vor den Räubern bewahrte, um seine Schwester handelte.
Das Ende führt zum Tod aller beteiligten. Mit dem Untergang ihres
Geschlechtes findet auch das Schicksal der „Ahnfrau", ihr rastloses
Wandeln, ein Ende, zu dem sie auf Grund ihres Verbrechens verdammt war.

Johann Ferdinand III. Graf von Kuefstein (1752-1818)
In jungen Jahren hatte er verschiedene Ämter inne. Er war Landesrat in
Niederösterreich und Stadthauptmann von Wien, wofür er 1799 mit der
Ehrenbürgerschaft von Wien ausgezeichnet wurde. Die Umbauten der
Barockzeit haben den Betrieb fast in den Konkurs getrieben. Durch
geschicktes Taktieren und Verpachtung der Herrschaft gelang es Johann
Ferdinand III. den Konkurs abzuwenden, doch dann kam der Krieg gegen
Napoleon. Nachdem schon andere seiner Herrschaften durch
Einquartierungen feindlicher Truppen ruiniert waren, wurde
Greillenstein vom 20. Juli bis 20. Dezember 1809 von französischen
Truppen besetzt. 383 Offiziere, 639 Domestiken und 1404 Pferde mussten
versorgt werden. Danach waren alle Vorräte der Herrschaft aufgebracht.
Erst nach langem Kampf und durch eine extrem bescheidene Lebensführung,
gelang es Johann Ferdinand die Finanzen wieder in Ordnung zu bringen.
So führte er etwa in Greillenstein eine Bienenzucht ein und stellte die
Landwirtschaft um. Wahrscheinlich halfen ihm dabei seine
sozialökonomischen, wissenschaftlichen Arbeiten. Bei Hof war er
Direktor der Hofkanzlei und Hofmusikgraf, dieses Amt bekleidete er am
längsten.
Franz Seraphicus Graf von Kuefstein (1794-1871)
war Diplomat und die meiste Zeit seines Lebens im Ausland, die längste
Zeit war er österreichischer Gesandter in Dresden. Der Pachtvertrag
über die Herrschaft Greillenstein lief 1819 aus, woraufhin er die
Betriebsführung wieder selber übernahm, einen eigenen Verwalter
einsetzte und die Beamtenschaft austauschte. Mit der Auflösung der
Grundherrschaften 1848 fielen die bisher angefallenen
Verwaltungsaufgaben und Gerichtsangelegenheiten weg, aber auch die
Einnahmen aus dem Zehent. Das Schloss wurde zu einem Privathaus und
musste aus den Einkünften der Land- und Forstwirtschaft erhalten werden.
Karl Graf von Kuefstein (1838-1925)
Wie sein Vater, war auch Karl Diplomat und die meiste Zeit im Ausland
oder im Auswärtigen Amt in Wien tätig. Erst nach seiner Pensionierung
1903 zog er sich ganz nach Greillenstein zurück. Er legte ein neues
Archivverzeichnis an und verfasste die Familiengeschichte. Als
Arbeitszimmer diente ihm die große Bibliothek. Trotz allem Protest von
seiner Seite konnte er nicht verhindern, dass die öffentliche Straße
mitten durch den Garten vor dem Schloss gebaut wurde, wodurch die
schöne Anlage aus der Barockzeit unwiederbringlich zerstört wurde. Im
hohen Alter erlebte er noch das Ende der Monarchie.

Schloss Greillenstein zur Zeit Franz Grillparzers 1800-1818
Schloss Greillenstein war zu dieser Zeit im Besitz von Johann Ferdinand
III. Graf von Kuefstein (1752-1818). Als Hofmusikgraf war dieser
zuständig für die Spielpläne des Hoftheaters und die Hofmusik. Nebenbei
veröffentlichte er sozialökonomische Werke und verfasste auch ein
Türkisch-Deutsches Lexikon. Die Herrschaft Greillenstein war für die
Verwaltung der vierzehn zur Grundherrschaft gehörenden Dörfer
zuständig. Es gab das Landgericht in Greillenstein, dessen
Zuständigkeit über die Grenzen der Grundherrschaft hinausging. Bis zu
hundert Angestellte und Arbeiter waren im Schloss und den dazugehörigen
Betrieben beschäftigt. Neben dem Landwirtschaftlichen Betrieb gab es
auch eine Schmiede, Wagnerei, Bäckerei und Gärtnerei.
1809 Einquartierung von Franzosen im Schloss Greillenstein
Unter den damals herrschenden Napoleonischen Kriegen hatte auch
Greillenstein zu leiden. Von Dezember 1808 bis Juli 1809 waren im
Schloss 383 Offiziere, 639 Diener, Unteroffiziere und Gemeine mit 1404
Pferden einquartiert. Da Napoleon seine Truppen durch Requirieren aus
der jeweiligen Gegend verpflegte, war die Grundherrschaft Greillenstein
nach dem Abzug der französischen Truppen schwer erschöpft und ein
Großteil der Möbel im Schloss zerstört. Johann Ferdinand sah keine
andere Möglichkeit aus der finanziellen Krise herauszukommen, als das
Schloss zu verkaufen. Doch der Kaiser verbot den Verkauf. Im Bemühen
die Wirtschaft wieder zum Laufen zu bringen und die Schulden zu tilgen
gründete Graf Kuefstein eine Bienenzucht.

Der Zweispitz löste um 1790 den
Dreispitz als militärische Kopfbedeckung für Offiziere ab. Bis Anfang
des 20. Jahrhunderts war der Zweispitz Teil der Paradeuniform für
Offiziere aller Waffengattungen. Ein Zweispitz (auch Sturmhut) war ein
Hut mit an zwei gegenüberliegenden Seiten senkrecht aufgeschlagenen
Krempen, so dass zwei Spitzen entstanden. Er wurde sowohl mit einer
Spitze nach vorne und einer nach hinten (Wellingtonhut), als auch quer
getragen (Napoleonshut) und konnte auch zusammengeklappt unter dem Arm
getragen werden, daher die Bezeichnung Chapeau brisé oder Klapphut.
Möglich ist auch ein schräges Tragen. Bis heute wird der Zweispitz von
Admirälen, Sargträgern oder den Bereitern der Spanischen Hofreitschule
getragen. Der Zweispitz war aber nicht nur Teil militärischer Uniformen
sondern auch oft die Kopfbedeckung zum Livree von Kutschern adeliger
Familien. Genauso gehörte er zu manchen Uniformen der Chargen und
Würdenträger des Wiener Hofes.

Um 1300 Begründung der Osmanischen Herrschaft in West-Kleimasien
1353 Einbruch der Osmanen in Teile der BalKanhalbinsel
1453 EROBERUNG KONSTANTINOPELS
1459 Serbien wird osmanische Provinz
1460-1524 Ständige Einfälle ins Reich.... osmanischer Kriegszug durch Südsteiermark und Kärnten
1526 SIEG ÜBER DIE UNGARN BEI MOHACS König Ludwig II. fällt erbenlos - Habsburg stellt Erbansprüche
1529 SULTAN SULEMAN BELAGERT WIEN 150.000 Mann ziehen nach 3 wöchiger, vergeblicher Belagerung wieder ab
1532 Sultan Süleyman zieht neuerdings Richtung Wien, Belagerung von
Güns, Karl V. bietet ein Reichsheer auf, worauf die Osmanen durch
das Steinfeld abziehen
1533 Erster Waffenstillstand zwischen Habsburg und der Pforte
1541 Eroberung von Ofen Mittelungarn wind osmanisches Reichsgebiet
1547 und 1562 Waffenstillstand, Nordungarn verbleibt dem Kaiser, dafür jährl. 30.000 Dukaten Tribut
1566 Letzter Zug Süleymans gegen Wien wo er bei der Belagerung von Szigeth stirbt
1593-1606 „Der Lange Türkenkrieg"
1606 WAFFENSTILSTAND VON ZSÍTVA-TOROK
1628 Diplomatische Mission Hans Ludwig Kuefsteins
1664 Schlacht bei Mogersdorf Erste große Niederlage der Osmanen, Waffenstillstand von Vasvar
1683 ZWEITE TÜRKENBELACERING WIENS
1684 Gründung der Hl. Liga durch Kaiser, Papst, Polen und Venedig
1686 Eroberung von Ofen durch die Kaiserlichen Truppen
1688 Eroberung von Belgrad durch die Kaiserlichen Truppen
1690 Rückeroberung Belgrads durch die Türken
1697 SIEG PRINZ EUGENS BEI ZENTA
1699 FRIEDE VON KARLOWITZ Die Türken müssen Ungarn und Siebenbürgen abtreten
1717 Prinz Eugen erobert Belgrad
Erster TürkenKrieg Karls VI.
1718 FRIEDE VON PASSAROWITZ Banat, westt. Walachei, Teile von Serbien und Bosnien fallen an Österreich
1737-1739 Zweiter Türken Krieg Kaiser Karls VI.
1788-1791 Türken Krieg Kaiser Josefs II.

Die Anfänge
13. Jahrhundert, erste Erwähnung einer Burg im Besitz der Grellen in
den Zwettler Annalen. Leider weiß man heute nichts genaueres über diese
Burg. Es gibt weder Beschreibungen noch Pläne oder Bilder.
1313 Das Geschlecht der Grellen stirbt aus.
1499 Hans Dachpeckh stirbt. Damit ist das Geschlecht der Dachpeckhs,
das seit 1313 statt den Grellen in Greillenstein saß, ausgestorben.
1499-1534 Greillenstein im Besitz der Volkras
17. Jan 1534 Hans Lorenz von Kuefstein aus Feinfeld und seine Frau
Barbara Volkra kaufen die Veste und Herrschaft Greillenstein zum freien
Eigen.
Die Kuefsteins
Die Anfänge der Familie Kuefstein liegen im Dunklen. Vermutet wird,
dass die Familie aus Kufstein in Tirol stammt, doch gibt es keine
schriftlichen Aufzeichnungen, die das belegen könnten. Seit dem
ausgehenden 13. Jahrhundert sind die Kuefsteins in der Wachau als
Pfleger von Spitz und Vasallen der Kuenringer nachweisbar.
1414 Thomas von Frauenhofen überschreibt die Veste Feinfeld, im
Nachbarort von Greillenstein, an seinen Schwager Hans Lorenz Kuefstein.
Die Veste Feinfeld wird, wie Greillenstein, im 13. Jahrhundert in den
Zwettler Annalen erwähnt und war etwa 300 Jahre im Besitz der
Frauenhofener.

Leopold Graf Collonitsch Bischof von Wiener Neustadt, später Kardinal,
holt nach der Belagerung Wiens im Jahre 1683 aus dem verlassenen
türkischen Lager die Kinder der ermordeten christlichen Gefangenen
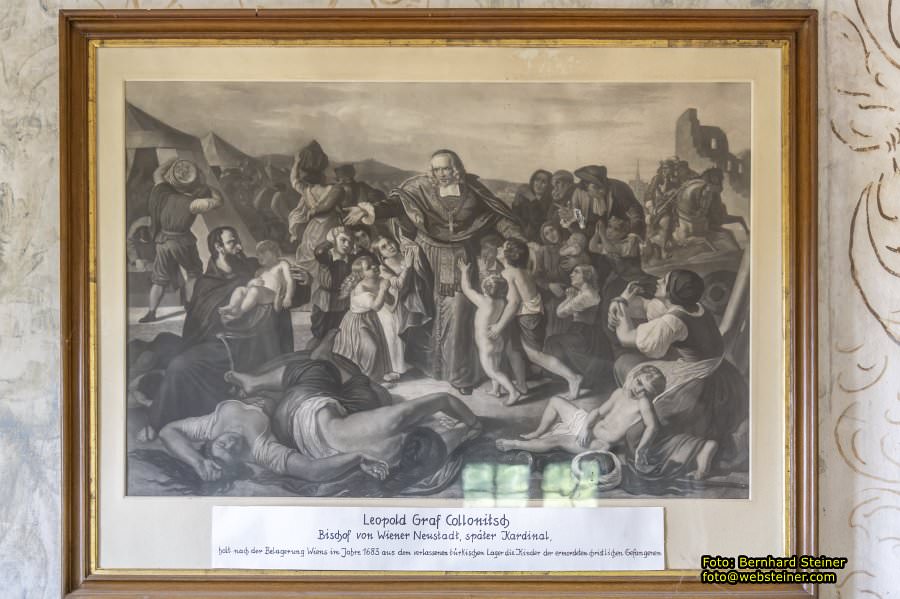


BADESTUBE - Hans Georg III. Freiherr von Kuefstein (1536-1603) ließ dieses Warmbad um 1590 erbauen.
Das geflügelte Wort: „Der kann den Dreck jetzt ausbaden" weist darauf
hin, daß auch rangniedere Personen nachfolgend das Bad mit schon
dreckigem Wasser benutzten, diese aber nachher reinigen „Ausbaden"
mußten.

Einziger Zugang zum Verlies war
das eisenvergitterte Loch im Boden. Die Tiefe beträgt 4,8 m. Dahinter
befindet sich ein kleinerer Raum der als Gefängnis diente.

Seit dem 15. Jahrhundert tritt die Gestalt des Hofzwerges im höfischen
Leben auf. Als der dann im europäischen Barock zur Mode wird, hielt man
sich an nahezu allen Fürstenhöfen Zwerge ähnlich wie Hunde; sie
gehörten wie diese zum Inventar und wurden oft gemeinsam dargestellt.
Die Gesellschaft stand noch immer unter dem starken Einfluß des
mittelalterlichen Volksaberglaubens, der den Zwerg als Glücksbringer
ansah. Andererseits diente seine körperliche Deformation als Kontrast,
der die erhabene Schönheit des Fürsten, seine wohlgestalte Größe umso
überzeugender hervortreten ließ.
Zwergenkabinett

Der Zwerg in Literatur und bildender Kunst
In der nordischen Literatur, besonders in der Märchen- und Sagenwelt
der Germanen, hat das Geschlecht der Zwerge seine älteste Tradition.
Sie reicht zurück bis ins 13. Jahrhundert. Zwerge sind von Anfang an
Begleiter des Menschen und die Vorstellung des winzigen Bergmanns mit
Zipfelmütze und Laterne war und ist das beliebteste Bild vom Zwerg.
Häufig erschienen Zwerge im Märchen als Helfer in der Not, als Tröster
nach erlittenem Unrecht und zutrauliche Gefährten in der Einsamkeit.
Die Heinzelmännchen sind bis heute der Inbegriff von Fleiß,
Schnelligkeit und Hilfsbereitschaft. Der Böse Zwerg, der voller
Hinterlist seine Macht ausnutzt, geht in seiner Urgestalt wohl auf
König Laurin zurück, der im mittelalterlichen Heldenepos durch Dietrich
von Bern besiegt wird und danach als Gaukler auftreten muß. Hier liegt
wohl auch der Ursprung der späteren Doppelfunktion des Verwachsenen als
Spaßmacher und Hofnarr an den Fürstenhöfen.

Die literarische Figur taucht sehr bald in der bildenden Kunst auf, so
dass man den echten Zwerg, die Darstellung des zwergenwüchsigen
Menschen gegen Ende des Mittelalters in Kunst und Leben überall
vordringen sehen kann. Seit dem 15. Jahrhundert tritt die Gestalt des
Hofzwerges im höfischen Leben auf.
Die Verwendung des Callotto als Gartenskulptur brachte thematische
Veränderungen im Sinne der barocken Ikonographie mit sich. Es entsprach
ganz dem barocken Stilwillen, jeder künstlerischen Gestaltung ein
möglichst geistreiches Programm zu unterlegen, das die Bildung des
Betrachters ansprechen sollte.

Die berühmtesten Zwergengruppen stehen im Schloss Weikersheim, im
Salzburger Mirabell-Garten und in Stift Gleink/Stmk und hier in Schloss
Greillenstein. Die Figuren gehen zumeist auf die lebensvollen Gestalten
des Callotto zurück, erfuhren aber manchmal Änderungen und
Erweiterungen durch neue Typen, die sich je nach der Begabung des
Bildhauers oft als bedeutsame Neuschöpfungen, zuweilen deutlich unter
lokalen Einflüssen darstellten.
Die Greillensteiner Gartenzwerge entstanden um 1720 im Zuge der
Schaffung des Barockparkes. Sie sind aus Sandstein gefertigt und
stellen unter anderem die typischen Berufsgruppen der damaligen
Bevölkerung in dieser Gegend dar.

Um 1720 wurde rund um Schloß Greillenstein ein etwa 40 ha großer Park
angelegt, der sowohl als Nutzgarten, als auch als barocke
Lustgartenanlage konzipiert war. Der Park wurde durch mehrere Alleen
gegliedert und am Ende einer Kastanienallee befanden sich die
Wasserspiele, die von einem Forellenteich gespeist worden waren. Das
Wasser floß durch das Maul des Drachen, der heute im Schloßhof
aufgestellt ist, über 67 Granitstufen und danach über einen Wasserfall
in die kleine Taffa. Rechts und links der Treppe waren 24 Zwerge
aufgestellt. Betrachtet wurde das Schauspiel des hinabplätschernden
Wassers von einem gegenüberliegenden Hügel aus, wo ein
Aussichtspavillon stand.
Da die Figuren von Besuchern und Vandalen immer wieder beschädigt und
gestohlen wurden, sind sie vor einigen Jahren gemeinsam mit dem Drachen
ins Schloss gebracht worden. Gemeinsam mit den Überresten der einstmals
aufsehenerregenden Anlage ist ein Märchen über die Zwerge überliefert
worden.
DRACHE - Die Sandsteinplastik diente als Wasserspeier in der barocken Gartenanlage.

Den Zeichner und Radierer Jacques Callot
(1592 – 1635) kann man den eigentlichen Initiator der Zwergenmode in
der bildenden Kunst nennen. Er stammte aus Nancy und war fast
ausschließlich für den lothringischen Hof tätig, nachdem er seine
Jugendjahre in Italien verbrachte hatte und 1622 in die Heimat
zurückgekehrt war. Der größte Teil seines Werkes sind groteske
Einzelfiguren: Komödianten, Krüppel, Tänzer, Angehörige des fahrenden
Volkes, die er in übersteigerter Bewegtheit mit verrenkten Gliedern und
verzerrten Gesichtern darstellte.
1616 erschien die 24 Blätter umfassende Radierfolge der „Varie figure
gobbi di Jacobo Callot, fatto in Firenza l'anno 1616 excudit Nancey",
„gnomenhafte Krüppel und Bucklige, die sich trotz ihrer grausamen
Gebrechlichkeit als Komödianten, Musikanten, Tänzer und Bettler, in
einer graziösen Geschraubtheit aufblähen, die trotz der bauchigen
Umrisse manchmal gespenstisch wirkt." Dies ist der Ursprung des
„Callotto", des „Callot-Zwerges", der zum festen Begriff der
spätbarocken Ikonographie wurde. Er wurde zahlreich nachgeahmt, nicht
nur kopiert, nachgestochen und vergröbert, sondern als Idee abgewandelt
und für das Kunsthandwerk nutzbar gemacht. Am berühmtesten wurde der
Callotto als Gartenzwerg. Bald tauchten andere Variationen auf: er
erschien als musizierender Zwerg in kompletten Kapellen, als Komödiant,
als Tafelaufsatz in Bronze oder Porzellan, ja sogar als Backform und
Model für Butter und Marzipan. Er wurde in Holzintarsien und als
Ofenkachel verewigt, als Wachsfiguren und Lebkuchen. Er war eines der
beliebtesten Modeobjekte des 18. Jahrhunderts.

Die Greillensteiner Ahnfrau 1570-1615
Der Familientradition nach ist das Bild im Treppenhaus vor der
Bibliothek das Porträt der Anna von Kirchberg (ca. 1565-1615)
verheiratet mit Hans-Georg III. Freiherrn von Kuefstein (1536-1603).
Sie ist die Stammmutter aller Kuefsteins, die Ahnfrau.
Legende: Es wird erzählt, dass der 16jährige Franz Grillparzer während
seines Greillensteiner Aufenthaltes die Bibliothek des Schlossherrn
benutzen durfte. Der junge Dichter las gerne und viel. Wohlerzogen
fragte er stets, bevor er ein Buch aus der Bibliothek lieh. Doch eines
Abends hatte er vergessen rechtzeitig um ein neues zu fragen. Der
Verwalter und auch der Graf hatten sich schon zur Ruhe begeben, daher
beschloss der Jugendliche leise in die Bibliothek zu schleichen, um ein
weiteres Buch zu holen. Nur mit einer Kerze als Lichtquelle schlich er
die Treppen hinauf zur Bibliothek. Da trat die Ahnfrau aus dem Bild vor
der Bibliothek und versperrte Ihm den Weg. Erschreckt floh er in sein
Zimmer zurück. Diese Geistererscheinung verstärkte sein Interesse an
Geistergeschichten.
AHNFRAUGROTTE - "Öffne dich du stille Klause, denn die Ahnfrau kehrt nach Hause" - Grillparzer

Selbst ein entfernter Vorfahre der Familie Kuefstein fiel dem Glick am
Spieltisch zum Opfer - ein spannender Kriminalfall der nie ganz geklärt
wurde. Dessen Konsequenz war, dass eines der beliebtesten Glückspiele
dieser Zeit, „Bassette", vom Kaiser verboten wurde! Graf Ferdinand
Leopold Hallwyl, geboren im Jahr 1649, gehörte als Kammerherr zum
engsten Kreis um den Kaiser. Im Anschluss an offizielle Empfänge,
Bankette oder Konzerte war es Usus, dass man sich beim Glücksspiel
vergnügte.
Ein damals beliebtes Kartenspiel war „Bassette". Und so kam es, dass im
Jahr 1696 der portugiesische Botschafter mit Graf Hallwyl am Spieltisch
saß. Im Laufe des Abends verlor der Botschafter gegen Graf Hallwyl über
12.000 Golddukaten. Spielschulden sind Ehrenschulden und sollten sofort
bezahlt werden, doch der Portugiese bat immer wieder um
Zahlungsaufschub. Bis hin zu jenem historischen 10. August 1696 an dem
der Botschafter die Hälfte der Schuld begleichen wollte. Ein Treffen
auf dem Landgut bei Gablitz im Wienerwald wurde vereinbart. Und wie
damals üblich, wollte man sich vor der Auszahlung bei der Jagd
vergnügen. Angeblich um die Pferde zu schonen, ließ der Botschafter nur
den leichten Wagen anspannen, daher musste der Diener Graf Hallwyls am
Gut zurück bleiben. Der Botschafter kutschierte den Wagen selbst und
der polnische Lakai des Botschafters, Johann Mustriki, sollte die
Bewirtung der beiden Herren übernehmen. Abends kam der Botschafter
alleine zurück und erzählte Graf Hallwyl wäre nach Baden gefahren um
einer Dame seine Aufwartung zu machen. Hallwyls Diener sollten nach
Wien zurückkehren. Der Botschafter seinerseits erschien noch am selben
Abend sowie den darauf folgenden bei Hofe und feierte, dinierte und saß
wieder am Spieltisch, als ob nie etwas passiert wäre!
Nachdem Graf Hallwyl nicht mehr auftauchte, startete dessen Vater eine
Suchaktion. Die Wirtsleute einer Schenke nahe Gablitz erzählten, der
junge Graf sei in Begleitung des Lakaien nochmals in den Wald gegangen
um ein angeschossenes Wild „nach zu suchen", aber beide kehrten nicht
wieder zurück. Die Unwetter der letzten Tage hatten mögliche Spuren
vernichtet, dennoch fand man schließlich in einem entlegenen Waldstück
den nur notdürftig verscharrten Leichnam des Grafen. Auch eine
Untersuchung vom kaiserlichen Geheimdienst konnten keine eindeutigen
Beweise gegen den Botschafter feststellen. Der Botschafter wurde zwar
mit einem Hausarrest belegt, konnte aber in einer Nacht und Nebelaktion
das Land verlassen. Noch im selben Jahr wurde als Konsequenz dieses
Unglückfalles, dessen Ursache das Glückspiel „Bassette" gewesen war,
dieses Kartenspiel per kaiserlichem Edikt von jenem Tag an verboten. Im
Jahre 1698 tauchte ein schriftliches Geständnis eines Polen, Johann
Mustriki, auf, er habe im Auftrag eines Edelmannes, der beim Glückspiel
sein gesamtes Vermögen verloren hatte, den Grafen ermordet.

Vor vielen, vielen Jahren lebte in einem versteckten Tal, nahe dem
Schloss Greillenstein ein Zwergenvolk. Im Tal wuchsen hohe Bäume und in
ihrem Schatten blühte manch seltenes Kraut, das Kranken Linderung
verschaffte. Mitten durch das Tal floss ein munter plätschernder Bach,
welcher ein Mühlrad antrieb. Der Müller und seine Tochter waren von
Sonnenaufgang bis spät in der Nacht an der Arbeit. Der Müller wachte
über die Mühlsteine und die Tochter erledigte die Hausarbeit und half
dem Vater, wo sie nur konnte.
In der Mühle wurde ein besonders feines Mehl gemahlen, aus welchem die
anderen Zwerge Kuchen buken. Diese Kuchen tauschten sie bei den Bauern
in der Umgebung gegen Säcke, die mit bestem Weizen gefüllt waren, ein.
Aus dem harzigen Holz der Kiefern und Fichten machten sie Kienspäne,
die sie auf dem Markt verkauften und eine Zwergenfrau verstand sich auf
das Brauen eines heilsamen Kräutertrunkes, den sie an jeden verkaufte,
der seiner bedurfte.
Die besten Kuchen konnte Frau Roswitha backen. Deshalb erhielt sie von
den Bauern nicht nur Weizen, sondern auch klingende Münzen. Davon
kaufte sie sich schöne Kleider und für den Winter einen warmen Muff.
Ein anderer Zwerg aß für sein Leben gerne Hühnerkeulen. Daher half er
den Bauern in der Umgebung bei der Feld- und Stallarbeit und als Lohn
erhielt er so viele Hühnerkeulen, wie er wollte. Auch die übrigen
Zwerge litten keine Not und es ging allen gut.
Da kam eines Tages spät am Abend ein Fremder an der Mühle vorbei und
klopfte an das Fenster des Müllers um ihn nach dem richtigen Weg und
einem Nachtlager zu fragen. Der Müller war schon zu Bett begangen, weil
er von der Arbeit des Tages müde war. Er öffnete das Fenster und schrie
den Fremden an und beschimpfte ihn wegen der späten Störung seiner
Nachtruhe. Auch die Müllerstochter erwachte und verspottete den späten
Gast wegen seines seltsamen Aussehens.
Der Fremde aber war ein Zauberer, der sich über diese schlechte
Behandlung sehr ärgerte. Er zauberte einen Drachen herbei und befahl
ihm, die Zwerge nicht aus den Augen zu lassen. Der Drache baute sich in
der Nähe der Mühle eine Höhle. Von dort aus beobachtete er die Zwerge
und spielte ihnen von Zeit zu Zeit einen Streich. Als die Zwerge wieder
beim Kuchenbacken waren, wälzte er sich herbei und begrub den Backofen
samt der Kuchen unter seinem massigen Körper.
Da erschien ein Ritter in schimmernder Rüstung und zückte seine Lanze
gegen den Drachen. Die Zwerge liefen herbei und jubelten, weil sie sich
schon gerettet glaubten. Aber der Drache stieß einen giftigen Dampf
aus, der die Zwerge einhüllte und zu Stein erstarren ließ. Die
Giftwolke hüllte auch den Drachen und den Ritter ein, genauso wie die
Müllerstochter, die sich hinter einem Gebüsch verborgen hatte. Alle
erstarrten so, wie sie gerade waren und so sind sie auch heute noch zu
sehen. ENDE


KÖNIG LAURINS ROSENGARTEN
Der Zwergenkönig Laurin liebt Kühnhilde und schickt Boten als
Brautwerber zu ihrem Vater. Diese werden nicht nur abgewiesen und
schlecht behandelt, sondern auf dem Heimweg verfolgt. Der erzürnte
Laurin entführt mit Hilfe einer Tarnkappe Kühnhilde und hält sie in
seinem unterirdischen Palast gegen ihren Willen fest. Er behandelt sie
zwar gut, aber Kühnhilde kann ein Zwergenwesen, das in einer
palastartigen Höhle unter der Erde wohnt, nicht lieben. Laurin hat
große Freude an seinem prächtigen Rosengarten. Diesen Rosengarten
zerstören einige Ritter, darunter auch Dietrich von Bern, die
ausgezogen sind, um Kühnhilde zu befreien. In heftiger Erregung fordert
König Laurin die Ritter zum Kampf. Mit Hilfe eines Zaubergürtels, der
ihm die Kraft von 12 Männern gibt, scheint er sie fast zu besiegen,
aber als Dietrich von Bern den Zaubergürtel zerreißt, unterliegt Laurin.
Im Zwergenpark wird dargestellt, wie Laurin seinen zerstörten
Rosengarten erblickt. Weil die Zwerge die meiste Zeit unter der Erde
verbringen, wird er in unglasierter Keramik in verschiedenen Erdfarben,
also Brauntönen, dargestellt. Sein Gesichtsausdruck ist fassungslos und
voll Rachedurst. Sein Zwergenwuchs, d.h. großer Kopf, gedrungener
Körper und kurze Gliedmaßen sind stark hervorgehoben. Man erkennt,
warum Kühnhilde ihn nicht lieben kann. Der unterirdische Palast wird
durch einige Steinmauerteile in einem von Efeu überwachsenen
Wurzelstock angedeutet.


Das Schloss Greillenstein wurde 1570-1590 im Stil der Renaissance
erbaut und blieb weitgehend unverändert. Besonderheiten von
Greillenstein sind der Gerichtssaal und die barocken Zwerge. Gleich
neben dem Schloss, in einem ehemaligen Gebäude des Schlosses, ist das
Gemeindeamt und der, von der Gemeinde errichtete, Gastronomiebetrieb,
die „Schlosstaverne Greillenstein", untergebracht. In der
Schlosstaverne wird nach gutbürgerlicher Art gekocht und ein
geschmackvoll renovierter Saal mit einem Fassungsvermögen von 300
Personen lädt auch zu größeren Feiern ein.

Wem der viele Text zu lange war und lieber Bewegtbilder mit Musik mag,
kann sich gerne dieses Video antun: