web steiner
Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen
Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.
+43/2624/54014 - office@websteiner.com
Schloss Wilfersdorf
Liechtenstein-Schloss, Wilfersdorf, September 2023
Im Stammschloss der regierenden Familienlinie erfahren Sie alles über die Familiengeschichte der Fürsten. Die Dauerausstellung über die Geschichte der Fürstlichen Familie Liechtenstein und deren Verbindungen zum Weinviertel, ist das Herzstück des Schlosses. Die heimatkundliche Sammlung im Seitentrakt bietet Einblicke in vergangene Lebensweisen im Weinviertel.Im Erdgeschoß sehen Sie zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler der Region.

Wilfersdorf ist das Stammschloss der regierenden Linie der Familie
Liechtenstein. Fürst Gundaker (gest.1658) lebte mit seiner Familie im
Schloss Wilfersdorf. Auf ihn geht jene Familienlinie zurück, die heute
im Fürstentum Liechtenstein ihren Sitz hat. Das Staatswappen des
Fürstentums Liechtenstein ist das Wappen des Fürsten Gundaker.
Gundakers Sohn Fürst Hartmann (1613 - 1686) und seine Gattin Elisabeth
Sidonia (1623 - 1688) haben mit ihrem Kindersegen das Bestehen der
Familie bis heute ermöglicht. Sie waren Eltern von 24 Kindern, der
Großteil von ihnen wurde in Wilfersdorf geboren.
Die Geschichte der Marktgemeinde Wilfersdorf ist untrennbar mit der
Familie der Fürsten von Liechtenstein verbunden. Zahlreiche Denkmäler
und Bauwerke im Ort zeugen von der bewegten Vergangenheit der einzig
überlebenden Familienlinie. Das interessanteste und hervorstechendste
Merkmal der Marktgemeinde ist das Schloss Wilfersdorf. Dieses
Wahrzeichen wird oftmals als Brücke zu den vielbesuchten mährischen
Liechtenstein-Schlössern bezeichnet.

Porträt Fürst Johann I. Joseph von Liechtenstein (1760-1836)
1816. Teilkopie nach einem Original von Johann Lampi im Heeresgeschichtlichen Museum Wien
Fürst Johann I. Joseph von Liechtenstein erwarb 1807 die Herrschaft
Liechtenstein-Mödling mit der damals bereits zur Ruine verfallenen Burg
Liechtenstein, dem mittelalterlichen Stammsitz der Fürsten von
Liechtenstein. Johann I. Joseph gestaltete einen großen Naturpark um
die Burgruine und errichtete 1820 am Fuße des Burgfelsens das
klassizistische neue Schloss Liechtenstein. Auch in der Umgebung von
Burg Liechtenstein, wie auch in Greifenstein und Seebenstein hinterließ
er Spuren. Schon als 22jähriger diente er als Leutnant in der
kaiserlichen Armee, in der er bereits acht Jahre später als Oberst an
den Türkenkriegen teilnahm. Der Fürst kämpfte dann auch in den
Napoleonischen Kriegen und griff auch am Verhandlungstisch wesentlich
in die Geschicke Österreichs ein - etwa beim Zustandekommen des
Friedens von Pressburg (1805). Im Jahr 1810 schloss er seine
militärische Karriere im Rang eines Feldmarschalls ab und betätigte
sich in der Folge nur mehr auf ökonomischem Gebiet.

Der Liechtensteinische Herzogshut
Daniel de Bries, Gottfried Nick und Jost von Brüssel (1623-1626)
Rekonstruktion nach einer aquarellierten Zeichnung von 1756 Hans Huysza (Karkasse), Eleonore Gloss (Schmucksteinbesatz)
Die Krone symbolisiert die Macht des Herrschers. So bestellte Karl von
Liechtenstein im Jahr 1623 beim Juwelier und Händler Daniel de Briers
in Frankfurt den Liechtensteinischen Herzogshut. In Frankfurt
verfertigte der Goldschmied Gottfried Nick die Karkasse (=Kronenreif).
In Prag wurden dann vom Juwelier Jost von Brüssel jene Edelsteine und
Perlen aus dem Vorrat Karls von Liechtenstein eingesetzt. Diese goldene
Lilienzackenkrone mit spanischem Hut, Diamanten, Rubinen und Perlen
wurde spätestens im Herbst 1626 fertig. Die Auswahl der Steine dürfte
der Hofarzt Rudolfs II., Anselm Boethius de Boodt, beeinflusst haben,
der Diamanten zum Schutz vor Zauberei und bösen Geistern, die Rubine
gegen Krankheit und Gift sowie Perlen zur Stärkung der Gesundheit
empfahl. Diese vermochten sie aber nicht vor ihrem Verschwinden
schützen: Vielleicht hat sie Fürst Franz Josef I. im Jahr 1772 an Maria
Theresia verkaufte, da er für ein nicht näher bezeichnetes Schmuckstück
22.000 Gulden erhielt.

DER AUFSTIEG DER LIECHTENSTEINER
Die Liechtensteiner gehören zu den ältesten Adelsgeschlechtern
Mitteleuropas. Ihr Ursprung liegt auf der Burg Liechtenstein (NÖ), die
von Hugo von Petronell-Liechtenstein um 1130 erbaut wurde. Er nannte
sich nach der Fertigstellung von und zu Liechtenstein, wobei der Name
auf die aus dem Römersteinbruch in St. Margarethen typischen lichten
Steine zurückgeführt wird, die man von dort als Baumaterial für die
Burg bezog. Dieses Geschlecht findet sich in der Folge an
entscheidenden Wendepunkten der Geschichte Österreichs: So kämpfte
Heinrich I. von Liechtenstein 1246 in der Schlacht an der Leitha an der
Seite des kinderlosen Babenbergers Friedrich II. von Österreich gegen
die Ungarn. Friedrich II. fiel im Kampf, wodurch das österreichische
Interregnum seinen Anfang nahm. Weil er während der böhmischen
Adelsrevolte von 1248 König Ottokar Přemysl unterstützte, erhielt
Heinrich I. 1249 das südmährische Nikolsburg (Mikulov) mitsamt einigen
Dörfern. In der Schlacht auf dem Marchfeld (1278) zogen seine Söhne
Heinrich II und Friedrich I. hingegen auf Seiten von Rudolf von
Habsburg gegen den Přemysliden ins Feld. Das Schicksal des Hauses
Liechtenstein ist seitdem mit dem Haus Habsburg eng verknüpft. Diesem
verdankt auch der im mährischen Feldsberg (Valtice) geborene Karl von
Liechtenstein seinen beispiellosen Aufstieg: Seit 1600 Obersthofmeister
Kaiser Rudolfs II, wurde er 1608 in den Fürstenstand erhoben, 1614 mit
der schlesischen Herzogswürde von Troppau bedacht und 1622 zum
Vizekönig von Böhmen erhoben. Bereits 1623 gab er den
Liechtensteinischen Herzogshut als Hauskrone in Auftrag, der wie viele
andere Errungenschaften im Laufe der Zeit wieder verloren ging.
Modell der Burg Liechtenstein bei Mödling, Maria Enzerdorf
Die Burg Liechtenstein bei Maria Enzersdorf (NÖ.) wurde um 1130 als
Wehranlage von Hugo von Petronell-Liechtenstein erbaut. Dieser nannte
sich nach der Fertigstellung von und zu Liechtenstein und gilt somit
als Stammvater des Fürstenhauses Liechtenstein. Der Name wird auf das
Baumaterial der Burg bezogen: Den aus dem Römersteinbruch in St.
Margarethen typischen lichten Steinen. „Huc de Lihtensteine", wie Hugo
von Liechtenstein in manchen Urkunden bezeugt ist, hatte auch bereits
Besitzungen im Weinviertel: So übergab er 1136 seinen Besitz,
Prinzendorf an der Zaya, an das Stift Klosterneuburg. Im 13.
Jahrhundert verloren dann die Liechtensteiner auf dem Erbwege die Burg
Liechtenstein, die im Laufe des 14. Jahrhundert auf die heutige Länge
und nach den Zerstörungen im Zuge der Türkenbelagerungen von 1529 und
1683 erneut aufgebaut wurde. Am Weihnachtstag des Jahres 1807 erwarb
schließlich Fürst Johann I. Joseph Fürst von Liechtenstein Burg und
Herrschaft wieder für die Familie.

Fahne des Militär-Veteranen-Vereines Fürst von und zu Liechtenstein Wilfersdorf und Umgebung
Österreichischen Kameradschaftsbundes - Ortsverband Wilfersdorf - Hobersdorf
Der Verein wurde laut Statuten am 28. Mai 1900 gegründet. Als
Proponenten haben unterschrieben: Paul Zuschmann, Josef Hienerth, Josef
Reihs).
Zur Erinnerung an die Fahnenweihe am 21. Juni 1903 hat sich eine
Ansichtskarte erhalten. Fahnenmutter war Frau Gutsverwaltersgattin von
Eybler. Anton Bammer, der letzte Fahnenjunker bewahrte die Vereinsfahne
bei sich auf und konnte diese während der NS-Zeit und der
Besatzungszeit vor Fremdzugriff schützen. Die Gründungsversammlung des
Österreichischen Kameradschaftsbundes - Ortsverband Wilfersdorf -
Hobersdorf als Nachfolgeverein, fand am 29. Mai 1986 statt. Wegen
Verschleißerscheinungen an der Fahne wurde eine neue Fahne erworben und
die historische Fahne dem Museum zur Aufbewahrung übergeben.

Gemälde „Schlacht bei Austerlitz/Slavkov" 1805
Österreichischer Maler, um 1810 Eigentum Museum Wilfersdorf
In der Schlacht bei Austerlitz am Montag, dem 2. Dezember 1805 besiegte
Napoleon I. von Frankreich die österreichischen und russischen Truppen.
Fürst Moritz Joseph Johann Baptist von Liechtenstein (1775-1819) nahm
als Feldmarschall-Leutnant der österreichischen Armee daran teil. Nach
dem blutigen Waffengang entsandte Kaiser Franz I. Fürst Liechtenstein
mit dem Angebot der Kapitulation zu Napoleon. „Es gibt für Eure
Majestät nichts mehr zu erobern", sprach Liechtenstein, „zum Ruhm
können Sie nur noch den Frieden hinzufügen". Der russische Zar wollte
jedoch mit dem Sieger nicht verhandeln und bemühte sich, mit dem Rest
seiner Armee schnellstens ungarisches Gebiet zu erreichen. Die Verluste
der Schlacht waren unermesslich. Innerhalb eines kurzen Wintertages
fielen auf beiden Seiten ungefähr 15.000 Mann. Genaue Zahlen stehen
nicht zur Verfügung. Ausserdem begann sich eine Typhusepidemie
auszubreiten, die ausser Soldaten auch die Zivilbevölkerung erfasste.
Der Winter war Anfangs Dezember sehr mild, so verbreitete sich die
Ansteckung sehr rasch. Sie ließ erst um Weihnachten nach, als endlich
Frost eintrat. Das hier ausgestellte Gemälde befand sich ursprünglich
im Schloss Feldsberg (Valtice), wo es Teil einer Schlachtengalerie war.
Aus dieser Serie befinden sich noch die Gemälde „Die Schlacht bei
Wagram" im Schloss Eisgrub und „Schlacht bei Hohenlinden", sowie
„Schlacht bei Regensburg" im Schloss Feldsberg. In den Kriegswirren des
Jahres 1945 wurde das Gemälde vermutlich von russischen Soldaten aus
dem Schloss Feldsberg entwendet. Es ist anzunehmen, dass es diese
Soldaten waren, die in einem Ort in der Nähe von Wilfersdorf, einem
Landwirteehepaar das letzte Pferd weggenommen haben. Da die Bäuerin aus
Verzweiflung bitterlich zu Weinen begann, wurde ihr von einem der
Soldaten das Gemälde mit den Worten übergeben: „Mutter, weine nicht,
hier hast Du eine Entschädigung für Dein Pferd" Die Tochter der Bäuerin
sah das Bild nie als ihr Eigentum an und hatte immer den Wunsch, dass
dieses Gemälde wieder in ein Schloss des früheren Besitzers
zurückkehren soll. Durch dem Erwerb des Gemäldes erhielt es einen
Ehrenplatz im Liechtenstein Schloss Wilfersdorf.

Die Schlacht bei Deutsch-Wagram 1809
Am 5. und 6. Juli 1809 zwischen dem Franzosenheer unter Napoleon und
der österreichischen Armee mit Fürst Johannes und Moritz von
Liechtenstein.
Spende vom Gestalter des Dioramas Alfred Frühwirth / Althöflein.

Napoleon Bonaparte spielt in
der Geschichte des Fürstentums Liechtenstein eine widersprüchliche
Rolle: Zum einen wurde er als militärischer Feind bekämpft. So wurde
Liechtenstein zum letzten Mal in seiner Geschichte zum
Kriegsschauplatz, als die Franzosen unter Napoléon Bonaparte das
Fürstentum 1799 durchquerten, um das nahe gelegene Feldkirch zu
belagern. Im Kampf gegen Napoleon sollte sich in weiterer Folge vor
allem Johann von Liechtenstein als besonders kampfesmutig erweisen. Er
nahm unter anderem mit der österreichische Kavallerie an der
Dreikaiserschlacht bei Austerlitz am 2. Dezember 1805 teil, aus der
Napoleon als Sieger hervorging. Als Napoleon dann am 1806 das Alte
Deutsche Reich auflöste und Rheinbund gründete, wurde darin
Liechtenstein am 12. Juli 1806 als souveräner Staat aufgenommen. Nach
Napoleons Niederlage bei Waterloo wurde auf dem Wiener Kongress 1815
eine neue politische Ordnung für Europa gesucht. Liechtenstein wurde
als selbstständiger Kleinstaat in den Deutschen Bund aufgenommen und
somit langfristig zum einzigen deutschen Kleinstaat, der seine
Selbstständigkeit bewahren konnte.
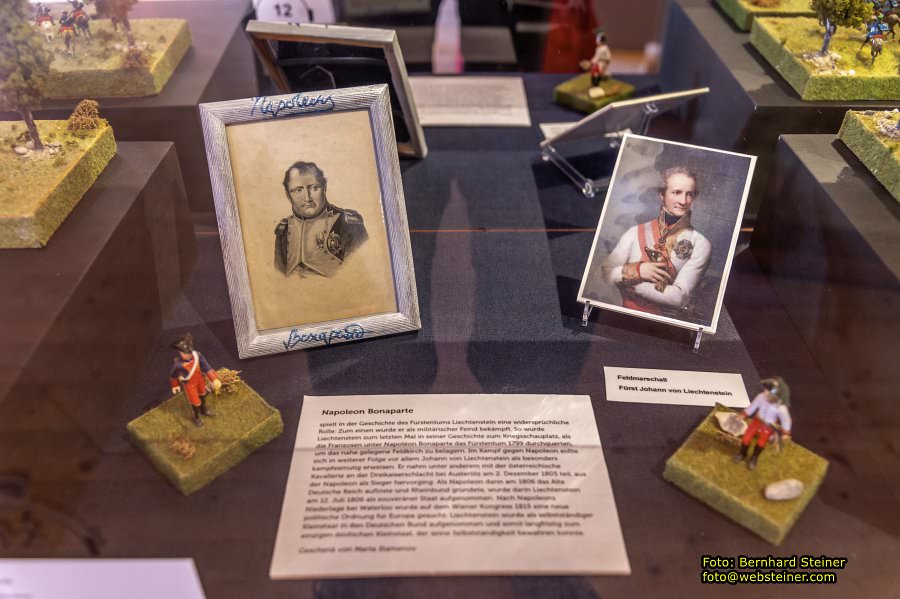
Fürst Hans Adam wurde 1945 in Zürich geboren und auf Johannes Adam
Ferdinand Alois Josef Maria Marko d'Aviano Pius getauft. Er erhielt
seinen Namen nach seinem Vorfahren Fürst Johann Adam Andreas (Hans-Adam
I.) und nach seinem Taufpaten Papst Pius XII. Er wuchs bei den Eltern
im Fürstenhaus in Vaduz auf und absolvierte die Volksschule in Vaduz,
ehe er an das Schottengymnasium in Wien ging. 1960 ging er nach Zuoz
auf das Gymnasium Lyceum Alpinum, wo er mit der Schweizer Matura und
dem deutschen Abitur abschloss. Er absolvierte anschliessend ein
Praktikum bei einer Bank in London. 1969 schloss er das Studium an der
Universität St. Gallen mit Erlangen des Lizentiats in Betriebs- und
Volkswirtschaft ab. Er ist seit 1989 regierender Fürst und
Staatsoberhaupt Liechtensteins sowie Chef des Fürstenhauses
Liechtenstein.

Das Staatswappen Liechtensteins
ist das Wappen des Fürstenhauses von Liechtenstein und wurde am 4. Juni
1957 eingeführt. Die aktuelle Form folgt dem Gesetz vom 30. Juni 1982
über Wappen, Farben, Siegel und Embleme des Fürstentums Liechtenstein
(Wappengesetz).
Der Wappenschild des grossen Staatswappens ist geviert mit unten
eingepfropfter Spitze und belegt mit von Gold und Rot geteiltem
Herzschild.
Feld 1: In Gold ein mit kreuzbesetztem silbernen Kleeblattmond belegter, gekrönter, goldbewehrter, schwarzer Adler.
Feld 2: Von Gold und Schwarz achtmal gestreift, mit grünem Rautenkranz belegt.
Feld 3: Von Rot und Silber gespalten.
Feld 4: In Gold ein gekrönter, goldbewehrter, schwarzer Jungfernadler mit silbernem Kopf.
In der blauen Spitze ein goldenes Jagdhorn an gleichfarbiger Schnur.
Den Schild umgibt ein mit dem Fürstenhut gekrönter Fürstenmantel (Wappenmantel) in Purpur, innen mit Hermelin gefüttert.

Fürst Anton Florian von Liechtenstein wurde nicht nur auf Schloss
Wilferdorf geboren, er entwickelte hier auch ein strenges
Kontrollsystem. So wies er seine Herrschaftsbeamten an, mündlich oder
schriftlich über Visitationen der Herrschaften zu berichten und
Gutachten sowie Verbesserungsvorschläge vorzubereiten. Der Sitz seines
Wirtschafts-, Raitrat- und Oberbuchhalteramtes befand sich auf Schloss
Wilfersdorf, zum Leiter ernannte er Lorenz Joseph Schallamayr als
höchster Kontrollinstanz aller Hauptleute, Verwalter und
rechnungsführenden Beamten. Ihm wurde aufgetragen, in seinem Amt eine
ordentliche Wirtschaftskanzlei zu halten und auch „auf unsern
herrschafften und güttern dergestalten stäts darob seyn und fleißig
dahin trachten, daß die würthschafft und alle einkommen vermehret und
die abgekommene wider aufgerichtet, hingegen aber die unnothwendigen
und überflüssigen ausgaaben abgethann oder gemindert werden."
Der Talerfund von Poysdorf 1995
Zur Untersuchung eines angemorschten, mächtigen Holztrams, eines
Unterzuges der Balkendecke zum Dachboden, machte am 2.12.1995 der
Besitzer des Hauses, Franz Thiem diesen bedeutenden Fund. Er löste
einige Ziegel aus der Wand und stieß dahinter auf einen querliegenden,
innenglasierten Henkeltopf mit grauem Deckel. Gefunden wurden 218
Großsilbermünzen, 182 Taler- und 36 Halbtalermünzen im Umrechnungswert
von 200 Talermünzen, im Gesamtgewicht von etwa 6 Kilogramm. Schlußmünze
1634 - Vergrabungszeitpunkt nach 1634. Der Fund belegt die Angst der
Bevölkerung vor Plünderungen in der Mitte des 30jährigen Krieges. 12
Stück Kopien von Münzen aus dem „Schweden- Münzschatz", sowie 2
Gußformen.
Leihgabe vom Weinstadt-Museum Poysdorf.

Modell der Anlage von Schloss Vaduz, Karton, grundiert Modellbau Rudolf Stur
Schloss Vaduz (früher auch Hohenliechtenstein) geht auf eine
mittelalterliche Burganlage zurück. Im Jahr 1322 wurde das Schloss zum
ersten Mal erwähnt, als sie samt Untertanen an Vogt Ulrich von Matsch
verpfändet wurde. Am 3. Mai 1342 fiel sie samt Herrschaft an Graf
Hartmann III. von Werdenberg. Im Zuge des Schwabenkriegs wurde die Burg
Vaduz am 12. Februar 1499 von den Eidgenossen niedergebrannt. Bis 1712
war sie dann im Besitz der Grafen von Hohenems, die sich zunehmend
verschuldeten und schließlich gezwungen waren, die Grafschaft Vaduz und
die benachbarte Herrschaft Schellenberg zu verkaufen. Bereits 1699
erwarb Fürst Johann Adam von Liechtenstein Schellenberg und 1712 Vaduz.
Seit 1712 befindet sich auch das Schloss im Besitz der Fürsten von
Liechtenstein. Unter Fürst Johann II. wurde die Burg in den Jahren 1905
bis 1912 umfassend saniert. Fürst Franz Josef II. ließ sie dann
wohnlich ausbauen und bestimmte sie ab 1939 zum ständigen Wohnsitz des
Fürstenhauses Liechtenstein.
Liechtensteinwappen aus Ton
Die Herstellung erfolgte durch die ehemalige Liechtensteinische
Tonwarenfabrik PKZ Keramika Postorna - Unter-Themenau im Jahr 2013 für
das Raumleitsystem im Liechtensteinmuseum im Schloss Wilfersdorf

Samowar - Nachweislich verwendet von Fürst Johannes II. von
Liechtenstein und von seinem Haushofmeister Johann Muster bei ihren
Gesprächen

ZEITFENSTER EINER FÜRSTLICHEN FAMILIENGESCHICHTE
Der Aufstieg des Hauses Liechtenstein zeichnete sich an der Wende zum
17. Jahrhundert ab. Ihre Akteure waren die Brüder Karl, Maximilian und
Gundaker, die noch einem protestantischen Elternhaus entstammten. Erst
durch ihre Konvertierung zum Katholizismus war der Weg für
Spitzenpositionen im Umfeld des Kaiserhauses geebnet. Gleichzeitig
stieg ihr Einfluss in den böhmischen Ländern: Karl unterstützte Kaiser
Ferdinand II. bereits während des böhmischen Ständeaufstandes. Er
leitete nach der Schlacht am Weißen Berg auch die Exekution der
Aufständischen in Prag (21. Juni 1621). Der Kaiser überließ ihm
daraufhin Besitzungen von geflohenen evangelischen Adeligen. Diese
Neuerwerbungen wie auch eine taktisch ausgerichtete Heiratspolitik
ließen die Liechtensteiner bald zu einer der reichsten Familien in
Böhmen und Mähren aufsteigen. In der fürstlichen Familiengeschichte
spielt auch Schloss Wilfersdorf, das seit 1436 im durchgehenden Besitz
der Familie Liechtenstein ist, eine besondere Rolle. Gundakar hat die
spätgotische Burg um 1600 in ein vierflügeliges Wasserschloss
umgewandelt. Sein Sohn Hartmann, dem seine Frau Elisabeth Sidonia
insgesamt 24 Kinder schenkte, baute das Schloss zu seiner Residenz aus.
Das Fürstenhaus Liechtenstein schuf sich im Barock und Biedermeier
nicht nur weitere Schlösser, sondern wurde in Kunst, Kultur und
Wirtschaft tonangebend. Der Bogen lässt sich von der als barocke
Kochbuchautorin in Erscheinung getretenen Fürstin Eleonore über
Kontakte zu Prinz Eugen oder Goethe bis hin zum Graupapagei aus dem
Nachlass Joseph Haydns spannen, den Fürst
Johann Joseph I. ersteigerte. Aber dafür konnte das Tier die Kaiserhymne pfeifen...
Stammtafel des fürstlichen Hauses Liechtenstein
Der umfassende Stammbaum der Liechtensteiner lässt uns vieles über die
Fürstenfamilie lernen. Die Stammtafel ist ein absolutes Unikat. Sehr
übersichtlich aufgebaut bietet sie einen einzigartigen Überblick über
den Stammbaum der Fürstenfamilie und ist ein Spiegelbild der
österreichischen und europäischen Geschichte.
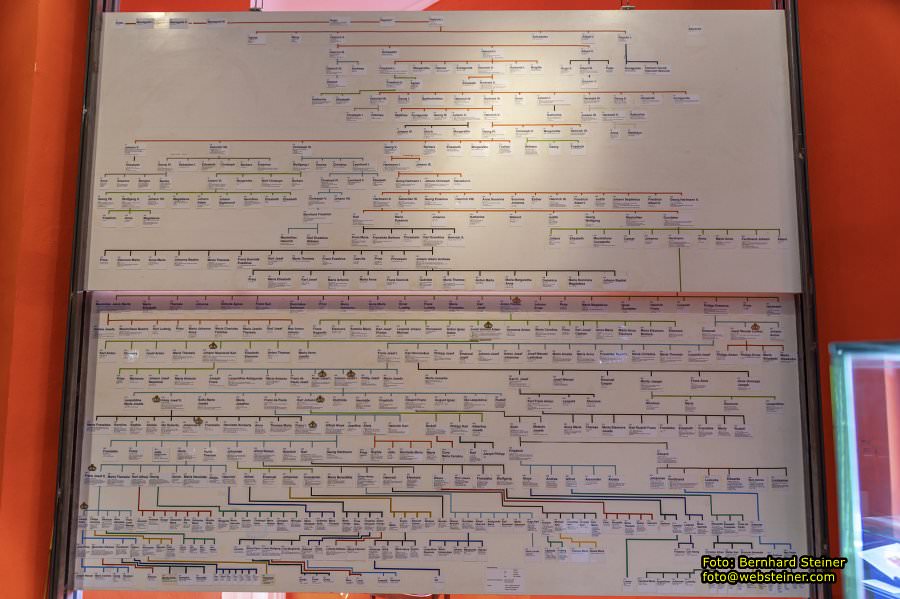
Polsterstühle und Sessel (Armlehnsessel à la reine)
Aus Schloss Feldsberg, 1. Viertel 20. Jh.
Buche, weiß und grün gefaßt, Bezug: Olivgrüner Seidenstoff mit vegetabilen Ornamenten,
LIECHTENSTEIN MUSEUM. Die Fürstlichen Sammlungen, WIEN
WIENER TAFELSERVICE
1784-1787, Imitation des 19. Jahrhunderts, Porzellan, Gold
LIECHTENSTEIN MUSEUM. Die Fürstlichen Sammlungen, WIEN
Büste Fürst Alois II. von Liechtenstein, 19. Jh. Gips
LIECHTENSTEIN MUSEUM. Die Fürstlichen Sammlungen, WIEN

Muschelschlitten ca. um 1880 aus Schloss Wilfersdorf
Der Schlitten war sowohl einspännig als auch mehrspännig zu fahren.
Kutschiert wurde durch die Herrschaften - der Lakai saß auf dem
rückwärtigen „Lakaiensitz". Herr Rabenseifner (ehemaliger
Pferdefleischhauer) aus Mistelbach kaufte den Schlitten von der
Verwaltung des Gutes in Wilfersdorf. Er hatte den Schlitten danach auch
in Verwendung.
Leihgabe Dir. Wolfgang Satzer, Kutschenmuseums Laa/Thaya

AUF DEN SPUREN DER LIECHTENSTEINER - IHRE BURGEN UND SCHLÖSSER
Der sprichwörtliche Grundstein des Hauses Liechtenstein wurde mit der
Stammburg Liechtenstein bei Maria Enzersdorf gelegt, die nach
mehrfachem Besitzerwechsel erst 1807 wieder in Besitz der Fürsten von
Liechtenstein kam. Unter Johann I. entstand 1820 in Burgnähe auch das
Schloss Liechtenstein als Sommerresidenz. Mit dem repräsentativen
Wiener Gartenpalais, das Fürst Johann Adam Andreas ab Juli 1689 von
Domenico Martinelli erbauen ließ, setzten die Liechtensteiner auch in
der kaiserlichen Residenzstadt ein sichtbares Zeichen ihres Ranges. Auf
den Spuren nordwärts liegt das Schloss Wilfersdorf, in dem jene
Liechtensteiner-Linie begründet wurde, auf die sich heute die
regierende Fürstenfamilie von Liechtenstein in Vaduz zurückführen
lässt. Aus der Herrschaft Wilfersdorf flossen auch Gelder in den Ausbau
der südmährischen Residenzen wie etwa für Schloss Feldsberg (Valtice).
Karl Eusebius ließ es anstelle einer seit dem 13. Jahrhundert in
Familienbesitz befindlichen Anlage nach Plänen Giovanni Giacomo
Tencallas errichten. Im dazugehörigen Natur- und Landschaftsgarten hat
Joseph Hardtmuth die mächtige Reistenkolonnade (1811 und 1823) sowie
den Diana-Tempel (1812) im klassizistischen Stil errichtet. Im
benachbarten Lundenburg (Břeclav) kamen „Veste und Herrschaft
Lunthenburch" 1384 an die Familie Liechtenstein, die hier ein Schloss
errichtete. Auf Karl Eusebius geht auch das ursprüngliche Barockschloss
Eisgrub (Lednice) zurück. Es wurde jedoch zwischen 1846 bis 1858 im
Stil der Neugotik umgebaut. Dem Traum von fernen Welten entspringt auch
das 1797-1804 im Park errichteten Minarett als exotisches Bauwerk ohne
kultischer Funktion.

Im Jahre 1436 wird durch Otto von Maissau die Burg und die Herrschaft
Wilfersdorf dem Christoph II. von Liechtenstein als landesfürstliches
Lehen vermacht. Die Liechtensteiner machten Wilfersdorf zum Mittelpunkt
einer großen Herrschaft, der auch Mistelbach und Poysdorf eingegliedert
waren. Gerade an die Zeit des Barock werden wir bei jedem Spaziergang
durch den Ort erinnert. Sei es durch die schönen Giebel bzw. Fassaden
aus dieser Zeit oder durch die Kapellen und Steindenkmäler.
Die zweigeschoßige schlichte Westfassade des Schlosses erhebt sich über
einem hohen Sockel. Der dreiachsige Mittelrisalit ist durch
Doppelpilaster sowie Rahmen gegliedert und umfasst das rechteckige
Portal mit der Bauinschrift 1608, über dem ein Balkon mit
Schmiedeeisengitter angeordnet ist. Der Risalit wird durch einen
breiten geschweiften und gesprengten Giebel mit einer Uhr und darüber
dem Wappen der Familie Liechtenstein abgeschlossen; seitlich befinden
sich die allegorischen Figuren „Ruhm“ und „Tapferkeit“. – Die
Innenräume sind weitgehend umgebaut.

Kutsche, Frühes 19. Jh.
Diese historische Kutsche wurde erworben im Rahmen des ETZ- Projektes
„Auf den Spuren der Liechtensteiner in Südmähren und Niederösterreich".
Um die Herrschaften zu visitieren und die Beamten zu kontrollieren,
sollte der Fürst einen Aufenthaltsort mehrmals jährlich wechseln. Denn
wenn er nicht alles selbst mit straffer Hand leite, werde er von seinen
Beamten bei jeder Gelegenheit betrogen und bestohlen werden. Auf jeder
Herrschaft sollte er „etliche vertraute personen haben, von denen er
auch sonst allerley erfahren kann." (Aus den Instruktionen des Karl
Eusebius von Liechtenstein für seinen Sohn Johann Adam).

Das Gartenpalais in Wien - Fassade gegen die Fürstengasse, um 1816
Ferdinand Runk (1764-1834), Sammlungen des Fürsten von und zu Liechtenstein, Vaduz (Faksimile)
Im Jahr 1687 erwarb Fürst Johann Adam Andreas von Liechtenstein einen
Garten mit benachbarten Wiesen des Grafen Weikhard von Auersperg in der
Rossau in Wien. Im südlichen Teil des Grundstücks ließ der Fürst ein
Palais errichten, im Norden gründete er eine Brauerei und eine
Grundherrschaft, aus der sich die Vorstadt Lichtental entwickelte. Für
den Bau des Palais lobte Johann Adam Andreas 1688 einen Wettbewerb aus,
an dem unter anderem auch der junge Johann Bernhard Fischer von Erlach
teilnahm. Dessen wenig funktionales, „durchlässiges" Projekt wurde vom
Fürsten aber verworfen. Den Wettbewerb gewann schließlich Domenico
Egidio Rossi, der aber schon 1692 durch Domenico Martinelli ersetzt
wurde. Auftragsbeginn war der 4. Juli 1689. Der Rohbau wurde 1700
fertig. Gebaut wurde eine Mischung aus Stadt- und Landhaus im römischen
Stil, ein Palazzo in villa. Der Garten wurde im Sinn eines klassischen
Barockgartens angelegt und um1820 nach Plänen von Joseph Kornhäusl
klassizistisch umgestaltet. In der Fürstengasse befand sich einst
gegenüber dem Palais auch die 1700 erbaute Orangerie.

Statuette Fürst Alois Josef II. von Liechtenstein, 19. Jh., Gips
LIECHTENSTEIN MUSEUM. Die Fürstlichen Sammlungen, WIEN
Fürst Alois Josef II. wurde am 25. Mai 1796 in Wien geboren und 1831
mit Franziska (de Paula) Kinsky von Wchinitz und Tettau verehelicht. Er
trat vor allem als Bauherr von Schloss Eisgrub in Erscheinung und
betrieb auch den Innenumbau des Liechtensteinpalastes in der Wiener
Bankgasse. Im Jahr 1836 erfolgte sein Regierungsantritt im Fürstentum
Liechtenstein. Mit ihm endet zugleich die Reihe der Gutsherren, denn
das Jahr 1848 brachte mit der Auflösung des Untertanenverbandes auch
die Lösung von der Gutsherrschaft.
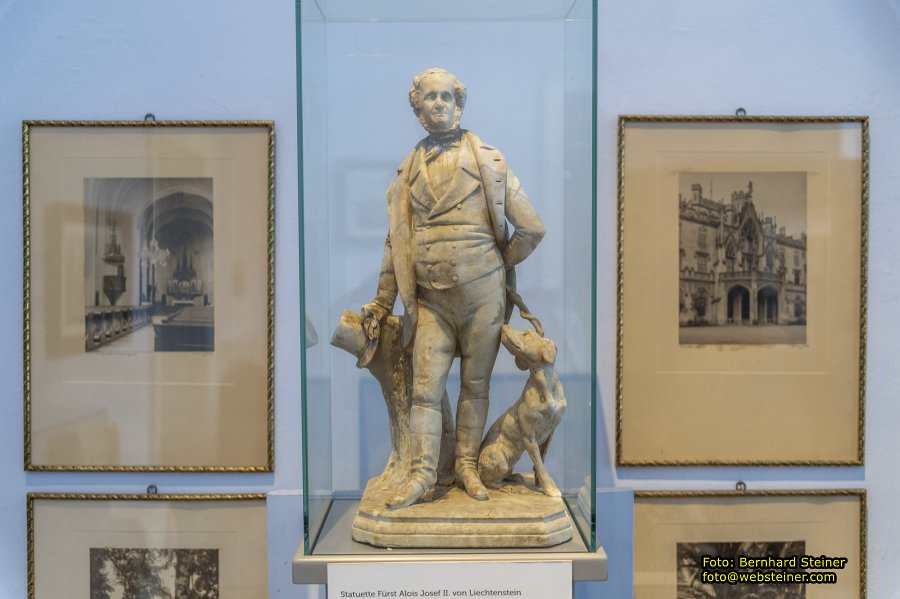
Orgeltisch und Sitzbank Aus der Kirche Kettlasbrunn und Foto der heutigen Orgel mit dem Liechtensteinwappen

Der Ambo ist ein erhöhter Ort
in der Kirche, von dem aus gottesdienstliche Lesungen und
Zwischengesänge vorgetragen werden., Verwendet in der Pfarrkirche
Staatz seit ca. 1970. Erworben von einer Pfarre im Raum Mödling. Spende
Pfarre Staatz 2019
Wandkreuz, 1700-1780, Holz, Corpus: Bildhauerarbeit polychrom gefasst, partiell vergoldet, Leihgabe Pfarre Wilfersdorf

DIE LIECHTENSTEINER ALS VERTEIDIGER UND NUTZNIESSER DES „RECHTEN GLAUBENS"
Die Familiengeschichte des Hauses Liechtenstein wird im 16. und 17.
Jahrhundert von den konfessionellen Umbrüchen geprägt. Wie viele andere
Adelsgeschlechter wurden auch die Liechtensteiner im 16. Jahrhundert zu
Anhängern der neuen Lehre Martin Luthers. Doch erst ihre Konvertierung
im Zuge der Gegenreformation ermöglichte ihren rasanten Aufstieg. Sie
beteiligten sich nun auch selbst aktiv an der Rückführung ihrer
Untertanen zum katholischen Glauben. So wies Gundaker von Liechtenstein
seinen Buchhalter der Wirtschaftskanzlei auf Schloss Wilfersdorf an, zu
überwachen, ob die officirer (=Herrschaftsbeamten) und underthannen den
gottesdienst fleissig besuechen, offt beichten und comunicim, den
processsionibus fleyssig beywohnen, nicht offentlich gottloß leben."
Gundakar, der selbst erst 1602 zur römisch-katholischen Kirche
konvertiert war, erschien zwecks Religionsreformation im Januar 1603
mit dem späteren Kardinal Melchior Klesl an der Spitze in seinem
Schloss Wilfersdorf und folgte so dem Vorbild seiner Brüder Karl und
Maximilian. Erschwert wurde diese Offensive jedoch durch den
Priestermangel dieser Zeit. Sprachbarrieren erschwerten zusätzlich die
Suche. So schreibt Gundakar 1631 an Kardinal Dietrichstein, er wolle...
einen pfahrrer haben, der auch deutsch predigen kunde oder aber neben
der böhmischen sprach der deutschen so vill kündig were, daß er deutsch
leicht zu hören (...) wüsste (). In weiterer Folge unterstützten die
Liechtensteiner in ihren Herrschaftsgebieten den Um- und Neubau von
Kirchen und karitativen Einrichtungen, förderten das Wallfahrtswesen
und trugen so wesentlich zum Sieg der Gegenreformation bei.
Heilige Rosalia - Aus der Grabkapelle am „Heiligen Berg" - beim Friedhofseingang in Wilfersdorf

Beichtstuhl, Ende 19. Jh.
In den Instruktionen des Gundaker von Liechtenstein für den Regenten
Hans Fritz, dem Sohn eines fürstlichen Untertanen, wird besonders der
gegenreformatorische Druck spürbar, der seitens des Fürsten für die
Rekatholisierung ausgeübt wurde: So hatte der Buchhalter als Chef der
Wirtschaftskanzlei des Fürsten Gundaker von Liechtenstein in Schloß
Wilfersdorf auch zu überwachen, ob die officirer (= Herrschaftsbeamten)
und underthannen den gottesdienst fleissig besuechen, offt beichten und
comunicim, den processsionibus fleyssig beywohnen, nicht offentlich
gottloß leben." Zu Weihnachten 1630 schlug der um Dienstentlassung
bittende Pfleger von Wilfersdorf, Hans Fritz, dem Fürsten Gundaker von
Liechtenstein den Wiener Gregor Kharner als seinen Nachfolger vor. Er
empfahl ihn als einen Mann, der „etwas studtiert" habe und auch sonst
ein fein wiziger man" sei, „der alle gerichtsbreuch woll waiß;
verstehet sich auch fein auf den ackher- und weingarthpau, dan er
selbst weingartten hat". Der Wilfersdorfer Pfleger wurde daraufhin auf
eine 100 Punkte umfassende Instruktion vereidigt. So sollte er unter
anderem die Kontrolle über die Osterbeichte und -kommunion der
liechtensteinischen Untertanen übernehmen.

Modell „Wilfersdorf um 1800", Modellbau: Hans Huysza
Nachbau eines Modells aus dem Kunsthistorischen Museum. Originalmodell 1: 500.
Das Modell zeigt das Ortszentrum von Wilfersdorf um 1800. Das Schloss
ist noch im Originalzustand mit Basteien und Wassergraben umgeben.
Westlich des Schlosses befindet sich das Tummelhofgebäude mit dem
Arrest und den Schafstallungen. An den nördlichen Seitentrakt
anschließend ist die ehemalige „Obere Hofmühle" zu sehen, an die der
Meierhof anschließt, der 1824 einem Brand zum Opfer fiel. Am
nordöstlichen Ortsrand ist der 1725 erbaute Schüttkasten des Fürsten
von Liechtenstein das markanteste Bauwerk. Die braunen Markierungen die
vom Schüttkasten wegführen, deuten die unterhalb befindlichen
Kellergewölbe der Fürstlichen Hofkellerei. Das Schloss wurde 1802 zu
einem Großteil abgetragen.

HERRSCHAFT UND WIRTSCHAFT
Der wirtschaftliche Aufstieg des Hauses Liechtenstein begann um 1600,
verbunden mit dem massiven Vorstoß in die böhmischen Länder. Das
Sprichwort „Schäferei, Brauhaus und Teich machen die böhmischen Herren
reich" traf im Besonderen auch auf die Familie Liechtenstein zu, die
neben dem Mühlenwesen auch auf andere landwirtschaftliche
Nebengewerbszweige in Böhmen und Mähren setzte. Ihre Monopolstellung in
diesen Bereichen bescherten den Fürsten bald große Gewinne. So verfügte
Hartmann von Liechtenstein (1613-1686) über hohe Einkünfte, die er in
Wien, Wilfersdorf und Ebergassing in mehreren Gewölben, Kassen, Truhen
und Fässern verwahren ließ. Herrschaftsbeamte hatten, wie es Karl
Eusebius 1680 formulierte, die Einkünfte der Herrschaften „durch
billiche und zulässige mittl, jedoch ohne ruin der unterthanen, zu
vermehren".
Trotzdem waren die Bauern als liechtensteinische Untertanen einer
doppelten Belastung ausgesetzt: Als Konsumenten wie auch als
Arbeitskräfte. Neben der Abnahmeverpflichtung für einige
herrschaftliche Erzeugnisse wurden sie durch den Mühlenzwang genötigt,
ihr Korn nur in den herrschaftlichen Mühlen mahlen zu lassen. Durch die
willkürliche Preisfestsetzung führte dies zu einer enormen Belastung
der Untertanen. Die Bauern waren aber auch billige Arbeitskräfte des
Fürsten. Sie wurden immer mehr mit Robotleistungen belastet, die man
nach dem Dreißigjährigen Krieg oft nur als Provisorium betrachtete. Sie
wurden bald aber von der Herrschaft als bewährtes Mittel zur Senkung
der eigenen Betriebskosten eingesetzt. Die Bauernbefreiung von 1848
sollte dann nachhaltig die Beziehung zwischen Herrschaft und Untertanen
ändern.
Im Souterrain ist ein gemütlicher Schlosskeller untergebracht.

Das Liechtenstein-Schloss Wilfersdorf steht im niederösterreichischen
Weinviertel in der Gemeinde Wilfersdorf. Es ist seit 1436 im
durchgehenden Besitz der Familie Liechtenstein und dient bis heute der
Verwaltung der fürstlichen Güter in Niederösterreich, zu denen auch die
bekannte fürstliche Hofkellerei gehört.

In einem Seitentrakt des Schlosses bietet das Heimatmuseum Einblicke in
längst vergangene Lebensweisen: Eine alte Bügelmaschine bestaunen, die
ehemalige Bäckerei und die Werkstätte des Sattlers besuchen.

Gegründet wurde das Heimatmuseum 1984 von Hans Huysza und seither wurde
Raum um Raum renoviert und eingerichtet. Immer mehr Fundstücke der
Gemeinde finden in den mittlerweile 16 kleineren und größeren Räumen
Platz und warten darauf, entdeckt zu werden.

Das Wilfersdorfer Heimatmuseum hat in einem der Nebengebäude Platz gefunden.





Heimatmuseum Wilfersdorf
1981: Beginn mit Urgeschichtsforschung im Gemeindebereich durch Hans Huysza. Grundlage für die Museumsgründung
1983: Beginn der Renovierungsarbeiten in den Ausstellungsräumen
1985 13. 10.: Offizielle Eröffnung des Heimatmuseums.
1985/86 Winter: Anfertigung des Modells Wilfersdorf um 1800.
1986/87 Winter: Anfertigung der Stammtafel des Fürstlichen Hauses Liechtenstein.
1995: 1. Schlosskirtag
1997: Eröffnung der Sonderausstellung „Spuren der Liechtensteiner im Weinviertel"
1999: 3. Schlosskirtag mit grenzüberschreitendem Radwochenende in der Region „Weinviertler Dreiländereck".
2000: Eröffnung der Sonderausstellung „Grenzen-los!" Die Liechtensteinregion zwischen Thaya, March und Zaya.
2000 26. und 27. 08.: 15 Jahre Museum Wilfersdorf und „Startfest zur
Gründung des „Kultur- und Tourismusverei-nes Liechtenstein Schloss
Wilfersdorf".






Das Schloss ist ein schlicht gegliedertes barockes Wohnschloss, dessen
Westflügel zusammen mit den Wirtschaftstrakten einen ehrenhofartigen
Vorplatz bilden. In der Hauptachse der Westfassade ist ein dem Schloss
vorgelagerter, durch Nebengebäude und Umfriedung mit mittlerem
Pfeilerportal gebildeter Ehrenhof. Davor befindet sich die Zufahrt, die
auf einer Brücke den früheren Graben überquert. Der Vorplatz nördlich
und südlich der Hauptfassade ist durch zwei eingeschoßige traufständige
Wirtschaftsgebäude mit Mansardwalmdächern und auf der Westseite
zweigeschoßigen Giebelfronten mit großer Doppellisenengliederung sowie
zwei quer dazu verlaufenden eingeschoßigen traufständigen Anbauten mit
lisenengegliederten Eingangsachsen begrenzt.

Wem der viele Text zu lange war und lieber Bewegtbilder mit Musik mag,
kann sich gerne dieses Video antun: