web steiner
Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen
Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.
+43/2624/54014 - office@websteiner.com
Benediktinerstift Göttweig
Furth bei Göttweig, Juni 2023
Seit 1094 beten und arbeiten Mönche auf dem Göttweiger Berg, der auch für seine Gäste Kraftquelle und Ort der Begegnung ist. Das UNESCO-Welterbe Göttweig zählt zu den ältesten Klöstern Österreichs. Im Museum erleben Sie die barocke Pracht und das epochale Troger-Fresko über der monumentalen Kaiserstiege.

Stift Göttweig wird wegen seiner Lage auf einer Anhöhe über der Donau
gerne als "Österreichisches Montecassino” bezeichnet und wurde 1083 vom
Passauer Bischof Altmann gegründet. Seit 1094 beten und arbeiten
Benediktiner am Göttweiger Berg.

Berthold von Garsten (+1142) - Prior von Göttweig und erster Abt von Garsten

Seit mehr als 900 Jahren leben und beten Mönche auf diesem Berg. "Ora
et Labora et Lege", also "Bete und Arbeite und Lies" lautet das Motto
der Benediktiner. Stift Göttweig ist ein lebendiges Kloster. Derzeit
gehören 43 Mönche dem Konvent an. Die Mehrzahl von ihnen lebt und
arbeitet in den über 30 Pfarreien in den Diözesen St. Pölten und Wien.
Ihre Hauptaufgabe besteht in der Seelsorge, auch in Krankenhäusern,
Gefängnissen und Schulen. Als besonders wichtig wird seit jeher die
Gastfreundschaft empfunden, schreibt doch schon der Hl. Benedikt in
seiner Ordensregel, dass alle Gäste, die zum Kloster kommen, wie
Christus aufgenommen werden sollen.

Seit mehr als 900 Jahren beten und arbeiten Benediktinermönche auf dem
Göttweiger Berg. Ziel ihres Lebens ist die Verherrlichung Gottes,
basierend auf der Regel des heiligen Benedikt. Dem Stift gehören 35
Mönche an, von denen mehr als die Hälfte in der Pfarrseelsorge in den
Diözesen St. Pölten und Wien tätig sind. Im Jahr 2000 wurde das Stift
Göttweig zusammen mit der Kulturlandschaft
Wachau zum Schutz des Kultur- und Naturerbes für zukünftige
Generationen in die UNESCO-Weltkulturerbeliste aufgenommen eine
besondere Auszeichnung der überregionalen Bedeutung des Stiftes und
seiner Kunstsammlungen.
Die Stiftskirche als Ort des Gebetes ist auch der bauliche Mittelpunkt
des Klosters, das seit dem Jahr 1083 als geistliches und kulturelles
Zentrum stark in seine Umgebung ausstrahlt. Ein Besuch der barocken
Stiftskirche und der romanischen Krypta ist für viele ein tiefes
Erlebnis.

Die Stiftskirche ist im Langhaus in ihrem Kern romanisch (aus der
Bauzeit des Klosters, ein Vorbau aus dem 11. Jahrhundert ist
nachgewiesen). Die Rekonstruktion der romanischen Anlage zeigte einen
Achsknick, wobei sich möglicherweise die Achse des Chores auf den
Sonnenaufgang des 4. Fastensonntags 1072 orientiert (damals der 18.
März), das Langhaus auf dessen vorangehenden Dienstag, den 13. März
1072.

Das Hochaltarbild „Mariä Aufnahme in den Himmel" (1694) stammt von
Andreas Wolff; der Hochaltar (mit Statuen von den hll. Petrus, Paulus,
Gregor, Altmann, Katharina, Barbara und der Gottesmutter Maria), der
mit Kanzel und Teilen des Orgelprospekts ein Ensemble bildet, von
Hermann Schmidt (1639). Das intarsierte Chorgestühl fertigte Franz
Staudinger 1766 an; die beiden Kaiserstühle (heute als Ambo verwendet)
dürften schon etwas früher in derselben Werkstatt entstanden sein.



Die Orgel wurde im Jahre
1982/1983 von der Firma Walcker-Mayer unter Verwendung wertvoller
Register der vorigen Rieger-Orgel aus 1922 errichtet. Sie ist ein rein
mechanisches Werk mit 45 Registern, das auf drei Manuale und Pedal
verteilt sind. Das Rückpositiv ist neobarock dispositioniert, während
das Schwellwerk eher romantisch ist.

Das über der Krypta erhöht liegende frühgotische Presbyterium wurde
1401 bis 1430 errichtet. Im 17. Jahrhundert und – nach einem Plan
Johann Lukas von Hildebrandts zur Umgestaltung der Fassade aus dem
ersten Drittel des 18. Jahrhunderts – wurde die Kirche weitgehend
barockisiert. Die Stuckaturen (1665 bis 1681) sind von
oberitalienischen Meistern verfertigt.


Krypta

In der Hauptkrypta unter dem Presbyterium der Stiftskirche befindet
sich auf dem Gnadenaltar (Empirezeit 1804) die Göttweiger Pietà, eine
Holzskulptur aus der Mitte des 15. Jahrhunderts, 1880 überarbeitet. Die
1784 unterbrochene Wallfahrtstradition wurde 1988 wieder aufgenommen.

Im südlichen Kryptenraum („Altmanni-Krypta“) steht der
Altmanni-Schrein, ein 1668 angefertigter Reliquienschrein mit
Silberfiligrandekor und den Reliquien des Heiligen, am Boden ein 1540
von Konrad Osterer geschaffenes Epitaph.

Liegefigur des hl. Altmann. Das Deckengemälde des Kremser Schmidt, die
Vision Ezechiels, passt thematisch zur darunter liegenden Konventgruft
von 1638.

Die Kaiserstiege im Nordwesten
des Stiftshofes ist das größte Barocktreppenhaus Österreichs. Sie
erhebt sich über drei Geschoße und wurde 1739 von Paul Troger mit einem
Deckenfresko versehen, das in seinem Zentrum Kaiser Karl VI. als
Helios-Apoll mit Musengefolge zeigt. Die figurale Ausstattung mit
Statuen der Jahreszeiten, Monatsvasen und Künstlerbüsten stammt von
Johannes Schmidt, dem Vater des Kremser Schmidt. Die daran
anschließenden Fürsten- und Kaiserzimmer – zum Großteil mit
beachtenswerten Tapetenmalereien – dienen als Museumsräume, ebenso der
Altmanni-Saal mit dem Deckenfresko Hochzeit zu Kana von Johann Rudolf
Byß und Johann Baptist Byß.

Stift Göttweig - Deckenfresko
Das herrliche Deckengemälde wurde vom Künstler Paul Troger im Jahr 1739
geschaffen. Er arbeitete nur wenige Monate an diesem Fresko, das auf
den frischen Putz gemalt wurde.
Das Bild zeigt die Verherrlichung Kaiser Karls VI. als Sonnengott.
Pallas Athene und der als Adler dargestellte Göttervater Zeus
vertreiben das Böse in den dunklen Hintergrund. Links vom Sonnenwagen
sitzen die sieben Künste auf einer Wolke. Die Architektur im rot-grünen
Kleid trägt die Gesichtszüge von Maria Theresia, Tochter Karls. Daneben
mit umgehängter Maske, mit Palette und Pinsel die Malerei, die
Bildhauerei mit Meißel, am linken Rand die Poesie mit Flügelohren und
Schriftrolle. Darüber die Numismatik mit einem Münzstempel und die
Musik mit einer Laute. Die Astronomie blickt auf den goldenen
Himmelsglobus. Chronos, der Gott der Zeit, vervollständigt das Ensemble.

Stift Göttweig wurde 1083 vom Passauer Bischof Altmann gegründet. Er
starb 1091 in Zeiselmauer, seine Reliquien befinden sich im sogenannten
Altmanni-Schrein in der Krypta der Stiftskirche. Abt Hartmann I.
übernahm 1094 mit Benediktinermönchen aus St. Blasien im Schwarzwald
das Kloster. Die Göttweiger Mönche leben bis heute nach der Regel des
heiligen Benedikt von Nursia. Seit 2009 steht Abt Columban Luser dem
Konvent vor.
Die Abbildung (Fresko von 1682 in der Stiftskirche Göttweig) zeigt eine
Episode aus der Lebensbeschreibung des heiligen Altmann. Die Jünglinge
Altmann (später Bischof von Passau), Adalbero (später Bischof von
Würzburg) und Gebhart (später Erzbischof von Salzburg) treffen am Fuß
des Göttweiger Berges zusammen und sagen sich gegenseitig ihre Zukunft
als Bischöfe voraus. Im Hintergrund ist die mittelalterliche Göttweiger
Klosteranlage sichtbar, die 1718 durch einen Brand fast komplett
zerstört wurde.

Barocker Neubau nach 1718
Nach dem verheerenden Stiftsbrand 1718 entschied sich der Konvent des
Stiftes Göttweig unter Abt Gottfried Bessel (1714-49), die gesamte
Klosteranlage nach Plänen von Johann Lucas von Hildebrandt (1668 -
1745) neu zu errichten. Der 1744 gedruckte monumentale Kupferstich von
Salomon Kleiner (1700 - 61) zeigt den geplanten Klosterbau, der jedoch
bis Ende des 18. Jahrhunderts nur zu rund zwei Dritteln realisiert
werden konnte.

Stift Göttweig - Benediktuszimmer
Die Kaiser- und Fürstenzimmer im Stift Göttweig sind mit bunten
Leinentapeten ausgestattet. Jeder Raum im Kaisertrakt ist farblich und
motivisch unterschiedlich gestaltet. Schöpfer dieser einzigartigen
Wandbespannungen sind die Gebrüder Byß, Experten der illusionistischen
Malerei.
Die Grundausstattung der Appartements ist fast einheitlich. Das lässt
auf eine gemeinsame Planung und Durchführung der Innenausstattung
schließen. Die Böden sind aus Nußholz gefertigt und mit Einlegarbeiten
verziert. Die bunt gemalten Wandtapeten bilden einen fließenden
Übergang zu den mit Stuck dekorierten Decken. Einen besonderen Akzent
setzen die Kachelöfen. Die Öfen konnten mit Holz vom Gang aus durch
kleine Türchen beheizt werden.


Hl. Anna Selbdritt - Lindenholz, gefasst, um 1520
Von der Ausstattung der zahlreichen mittelalterlichen Kirchen am
Göttweiger Stiftsberg, die beim Brand 1718 zerstört wurden, haben sich
nur sehr wenige Stücke erhalten. Diese Gruppe könnte Bestandteil eines
kleinen Seitenaltars in einer Kirche gewesen sein.

Im Museum im Kaisertrakt mit den Fürsten- und Kaiserzimmern erleben Sie
die barocke Pracht des kaiserlichen Hofarchitekten Johann Lucas von
Hildebrandt. Die monumentale Kaiserstiege mit dem Deckenfresko von Paul
Troger (1739) zählt zu den schönsten und größten barocken
Treppenhäusern Europas.

Die Göttweiger Naturaliensammlung
Bereits unter Abt Gottfried Bessel (1714-49) wurden in Göttweig
naturkundliche Objekte gesammelt. Ab 1720 legten die Mönche ein großes
Kunst- und Naturalienkabinett an. Diese Sammlung gleicht in ihrem
Aufbau den Kunst- und Wunderkammern des 16. und 17. Jahrhunderts. Neben
Fossilien, Muscheln und Schnecken war auch eine große Anzahl an
Tierpräparaten und Mineralien in der Sammlung vertreten. Einen
bildlichen Eindruck dieser Sammlung gibt eine großformatige
Reproduktion eines Kupferstiches von 1744 im nächsten Raum. Der
Göttweiger Abt hatte Kontakt zu vielen anderen Sammlern seiner Zeit. So
war er auch mit Johann Jakob Scheuchzer (1672-1733), dem berühmten
Schweizer Arzt und Naturforscher, in Briefkontakt. Aus diesen Briefen
geht hervor, dass Scheuchzer Teile seiner Fossiliensammlung dem
Göttweiger Abt übergeben hat.
Mineralien und Fossilien
Das Stift Göttweig verfügte einst über eine große Naturaliensammlung.
Dazu gehörten auch Mineralien und Fossilien. An vielen dieser Objekte
sind alte Inventarnummern erkennbar. Die ältesten dieser Nummern weisen
in die erste Hälfte des 18. Jahrhunderts und zeigen damit eine
intensive Beschäftigung mit Mineralien und Fossilien in der Barockzeit.

Salomon Kleiner (1700-61) - Kaiserstiege aus der Göttweiger Veduten-Serie Kupferstich, gedruckt 1744
Der Kupferstich aus der Kleiner-Serie zeigt die repräsentative
Kaiserstiege mit dem berühmten Deckenfresko von Paul Troger (1739).

Die ehemalige Kunst- und Wunderkammer
Der vergrößerte Kupferstich von Salomon Kleiner (1700-61) aus der
Göttweiger Vedutenserie - entstanden zwischen 1743 und 1745 - gibt den
Einblick in die Kuriositätensammlung des Abtes Gottfried Bessel
(1672-1749) wieder, die ursprünglich im ersten Stock des sogenannten
Frauenturmes (N-O Turm) untergebracht war. Diese Kunst- und
Wunderkammer umfasste eine Münzsammlung, archäologische Artefakte aus
der Antike, Elfenbeinschnitzereien aber auch naturkundliche Objekte wie
Muscheln, versteinerte Pflanzen und Tierpräparate in Alkohol. Nur
wenige der im Kupferstich abgebildeten Exponate haben sich bis heute
erhalten. Im linken Bereich der Abbildung sind geschnitzte
Holzskulpturen zu erkennen, einige davon befinden sich in der
Mittelvitrine.

Hl. Sebastian, Maria Immaculata, sitzende Jünglinge - Schnitzarbeiten aus Buchsbaumholz, um 1700
Der sogenannte „Dornauszieher", ein berühmtes antikes Motiv eines
Jünglings, der einen Dorn aus einem Fuß zieht, ist auch auf Salomon
Kleiners Kupferstich der Sammlung (großformatige Reproduktion nach dem
Stich von 1744) erkennbar.

Elfenbeinkruzifix - Art des Furienmeisters (1651-1732), um 1725

Triumph Kaiser Karl VI. als Musengott Apollon
Entwurf („Ricordo") für das Kaiserstiegen-Fresko, Öl auf Leinwand, Paul Troger (1698-1762) /Johann Jakob Zeiller (1708-83)

Wer war der Kremser Schmidt?
Martin Johann Schmidt wurde 1718 in Grafenwörth an der Donau, etwa 20
Kilometer von Göttweig entfernt, geboren. Er verbrachte sein gesamtes
Leben in Stein bei Krems und verließ nur selten sein Atelier in der
Landstraße. Bereits Schmidts Vater war für das Stift Göttweig als
Bildhauer tätig. Von ihm stammt unter anderem die skulpturale
Ausstattung der Kaiserstiege. Die Auftraggeber des Kremser Schmidt
waren vor allem Klöster und Pfarren. Darum zeigen seine Arbeiten primär
christliche Inhalte. Für das Stift Göttweig und seine Pfarren malte der
Künstler ca. 150 Bilder, großformatige Altarbilder genauso wie kleine
Gemälde zur privaten Andacht. Martin Johann Schmidt schuf in seinem
Leben eine unglaubliche Anzahl an Kunstwerken. Sein Werkverzeichnis
umfasst weit über 1.100 Objekte, zu einem großen Teil Ölbilder auf
Leinwand und Zeichnungen, aber auch Fresken und Radierungen. Schmidt
starb 1801 als einer der letzten großen Barockkünstler Österreichs.

Stift Göttweig verfügte bereits im Mittelalter
über eine Vielzahl an Weingärten. Bischof Altmann von Passau
(1065-1091) hatte seine Stiftung großzügig mit Rieden bedacht und
dieser Besitz wurde kontinuierlich erweitert, insbesondere durch
Schenkungen, aber auch durch Tausch sowie gezielte Ankäufe. Um die
Rechtsansprüche Göttweigs an seinen Gütern zu wahren, handelten hohe
geistliche und weltliche Würdenträger regelmäßig im Interesse des
Klosters und nahmen urkundliche Besitzbestätigungen vor.
Barock - Die Äbte Berthold Mayr
(reg. 1689-1713) und Gottfried Bessel (reg. 1714-1749) führten die
Göttweiger Weinwirtschaft in ein neues, florierendes Zeitalter. Der
Stiftswein etablierte sich als sehr beliebtes Handelsprodukt, aus den
Verkäufen konnten immer höhere Gewinne erzielt werden. Mehrere gute
Weinjahre brachten überdurchschnittliche Erträge mit sich. Mit dem Bau
eines riesigen Sammelkellers in Furth konnte die nötige Zentralisierung
der Weinlagerung erreicht werden. Nach dem Tod Bessels verfügte Stift
Göttweig über eine Gesamtmenge von rund 2 Millionen Liter Wein.

Das Benediktinerstift verfügt über Rebflächen im Ausmaß von rund 26
Hektar. Die Weingärten befinden sich in sechs Bezirken
Niederösterreichs: Krems-Stadt, Krems-Land, St. Pölten-Land, Tulln,
Hollabrunn, Waidhofen a.d. Thaya
Stiftskeller Furth - SW-Foto, 1980er-Jahre
Der im Jahr 1702 vollendete Sammelkeller bildet bis heute das Herzstück des stiftseigenen Kelleramtes in Furth.
Fassboden - Eiche, 1745
Allianzwappen Abt Gottfried Bessels (reg. 1714-1749)
Fässer - Eiche, 19. Jh., Fassungsvermögen: 57,8 1
Vorderdeckel mit Stiftswappen sowie Trauben- und Weinrankendekor.
Aufschrift „Convent" (links) und „Heuriger" (rechts). Solche Fässer
fanden im Klosteralltag Verwendung.

Kasel mit Hl. Urban - Rotes Tuch, aufgesetztes gesticktes Kreuz, Ende 15. Jh.
Die Kasel weist den in der Spätgotik typischen, im Schulterbereich
verkürzten Schnitt auf. Prägendes Element des liturgischen Gewandes ist
das Kreuz mit Heiligenfiguren: Wirbelrosetten aus Goldfäden bestimmen
den Hintergrund, die Gestaltung der Heiligen erfolgte mit Seidenfäden.
Heiligenfiguren: Urban, mit Traube / Konrad, Christophorus, Nikolaus / Altmann / Koloman


Stehende Gottesmutter mit Jesuskind - Unbekannter Meister, polychrom gefasstes Holz, 3. Viertel 15. Jh.
Die Statue stammt nach der Dokumentation im kremsmuseum aus dem
ehemaligen Lesehof des bayrischen Zisterzienserklosters Raitenhaslach
in Krems-Weinzierl, der ab dem 13. Jahrhundert urkundlich überliefert
ist. Sie gehörte wohl zur Ausstattung der 1458 neu geweihten
Georgskapelle. Die Skulptur stellt eine zeitgenössische Kopie der 1466
geschaffenen Gnadenstatue „Unserer Lieben Frau von Einsiedeln"
(Schweiz) dar. Da für den mit Raitenhaslach eng verbundenen Gnadenort
Altötting erst ab 1489 Wunder überliefert sind, dürfte sich das Kloster
davor nach Einsiedeln orientiert haben.

Von der Rebe ins Glas
Der Weinbau war Jahrhunderte lang die bedeutendste Wirtschaftsdisziplin
Stift Göttweigs. Entsprechend große Aufmerksamkeit galt der
Kultivierung der Weingärten, der Lese und schließlich der Herstellung
des Weins. Die Weinproduktion nahm in den Göttweiger Lesehöfen ihren
Anfang, wo die Traubenernte gepresst und der entstandene Most in Fässer
gefüllt wurde. Sofern die vorhandenen Kellerräumlichkeiten keine
ausreichende Größe aufwiesen, kam es zum Abtransport der Mostfässer in
geräumigere klösterliche Weinkeller. Die Weinqualität variierte sehr
stark, zu den besten „Tropfen" zählte der Wein aus Königstetten.

Göttweig - Altmanni-Saal
Der Altmannisaal dient heute als Festsaal. Ursprünglich hätte im Trakt
gegenüber der Stiftskirche der Kaisersaal errichtet werden sollen -
dieser Gebäudeteil wurde aber nicht vollendet, wodurch der Altmannisaal
aufgewertet wurde. Das Deckengemälde zeigt die Hochzeit zu Kana, die
großen Gemälde an den Seiten stellen die Ansicht des Klosters vor dem
Stiftsbrand und die Idealansicht der Pläne für den barocken Neubau dar.
Die vier kleinen Gemälde bilden die ehemaligen Göttweiger Gutshöfe ab.

Stift Göttweig - Die vier Gutshöfe - Die vier Gemälde zeigen die ehemaligen Gutshöfe im Jahr 1733.
Brandhof in Nieder-Ranna (links oben) 1723 erworben, umgestaltet 1726.
Gurhof bei Gansbach (rechts oben) Erbaut 1483-93, 1629 erworben, umgebaut 1723-1731.
Meidling im Thale (links unten) Gutshof nahe Göttweig.
Unternalb (rechts unten) Erweitert 1723-1727.




Stift Göttweig - Gobelinzimmer
Das Gobelinzimmer ist mit großen Tapisserien, also gewirkten Bildern
für Wände, ausgestattet. Die Technik ist mit der Weberei verwandt. Die
drei großen grünblauen Tapisserien sind um 1700 vermutlich in Flandern
entstanden und wurden zur Ausstattung der Räume angekauft. Ein Fragment
einer Petit-Point Stickerei, links neben der Tür zum nächsten Zimmer,
stammt aus der gleichen Zeit und begeistert aber durch die zahlreichen
sehenswerten Details.






Déjeuner des Göttweiger Abtes Leonhard, Grindberger (1798-1812),
bemaltes Porzellan, Marke „Wiener Blau", um 1800

Verherrlichung des hl. Nepomuk
Entwurfsmodell für den Johann Nepomuk-Seitenaltar in Krems St. Veit, um 1740/42, Joseph Matthias Götz (1696-1760)


Unübersehbar thront das Benediktinerstift Göttweig - aufgrund seiner
großartigen Berglage auch das „Österreichische Montecassino" genannt in
429 m Seehöhe am östlichen Rand des weltberühmten Donautales der
Wachau. Seit Jahrhunderten ist der Göttweiger Berg für seine Besucher
und Bewohner Kraftquelle und Ort der Begegnung. Heute ist das Stift
nicht nur Anziehungspunkt für Gäste und Pilger (Jakobsweg) aus aller
Welt, sondern auch spirituelles Zentrum im Herzen Niederösterreichs.
Die wirtschaftliche Basis des Klosters bilden von der Gründung an
Forstwirtschaft und Weinbau. Heute stehen den Besuchern zahlreiche
spirituelle, kulturelle und touristische Angebote zur Verfügung.

Ein Streifzug durch die Graphische Sammlung und die Bibliothek des Stiftes Göttweig
Die Grafische Sammlung des Stiftes Göttweig
Die Göttweiger Grafiksammlung zählt mit rund 32.000 Blättern zu den
größten Sammlungen dieser Art in Österreich. Die Sammlung beinhaltet
großteils Druckgrafik (meist Kupferstiche und Radierungen) aber auch
Handzeichnungen, historische Architekturpläne und barocke Druckplatten.
Unter Abt Gottfried Bessel wurde ein Großteil der Druckgrafik zwischen
1720 und 1740 angekauft und geordnet. Ein Kupferstich des Jahres 1744
zeigt, wie die Sammlung in 200 buchförmigen Kasetten in einem
Turmzimmer neben allerlei Kuriositäten aufgestellt war. Diese Sammlung
diente zur (Aus-)Bildung der Mönche, Repräsentationszwecken sowie durch
ihre Fülle an Motiven und Themen als Vorlagenmaterial für Künstler und
Handwerker. Grafiken waren im 18. Jahrhundert auch oft Bestandteil
einer größeren klösterlichen Sammlung („Kunst- und Wunderkammer").
Heute wird nur mehr vereinzelt gesammelt, aber auch zeitgenössische
Blätter finden immer wieder Eingang in die Sammlung.

Die Graphische Sammlung ist mit ca. 30.000 Blättern – nach der Wiener
Albertina – die zweitgrößte grafische Sammlung Österreichs. Erste
Nachrichten gibt es in einem Inventar des Jahres 1612 – Abt Georg
Schedler ließ einige „Täfelein aus Kuperstich“ als Wanddekoration
anschaffen. Im 17. Jahrhundert wuchs die Sammlung langsam an; Abt
Gottfried Bessel, der eine umfassende Grafische Sammlung anstrebte,
schaffte mehr als 20.000 Blätter an; P. Vinzenz Werl (1810–1861) nahm
die Neuaufstellung der Sammlung vor und verfasste 1843 den zweibändigen
Katalog. Der größte Teil der Grafiken stammt aus der Barockzeit mit
Werken von deutschen, niederländischen, italienischen, französischen
und englischen Meistern; ihr weites thematisches Spektrum reicht von
Andachts- und Heiligenbildchen, Herrscherporträts über mythologische
Sujets bis zu Architektur und Ornamenten, die nach dem Brand von 1718
als Vorlage für Architektur und Ausstattung des Neubaus genutzt wurden.
Idealansicht des Stiftes Göttweig - Kupferstich von Salomon Kleiner (1700-1781), 1744
Als diese Kupferstiche zu Beginn der 1740er in Auftrag gegeben wurden,
war dem Bauherren Abt Gottfried Bessel klar, dass er die Vollendung des
1719 begonnenen Klosterneubaues nicht mehr erleben würde. Bis heute
zeigt uns diese Stichserie, wie das unvollendet gebliebene Kloster
eigentlich geplant war.
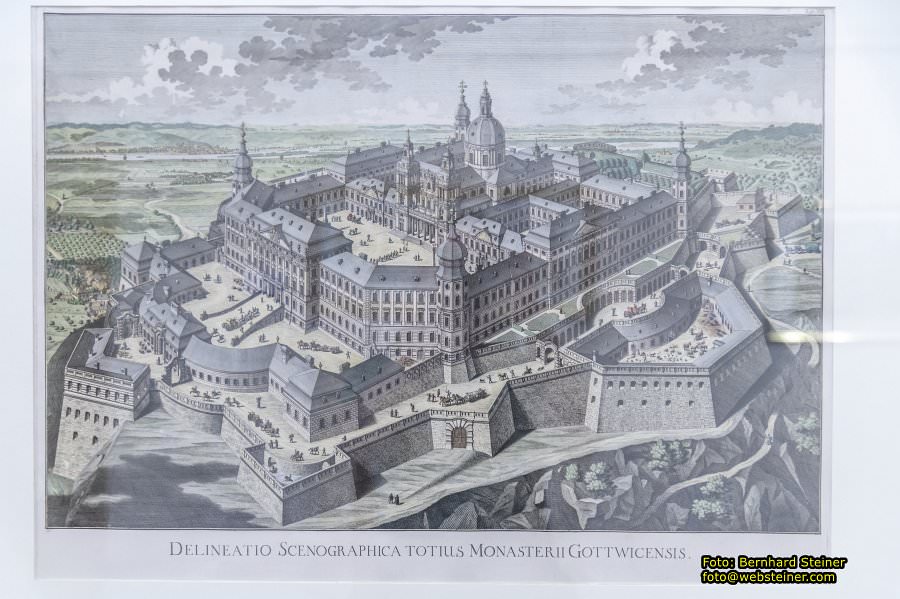
Die Göttweiger Stiftsbibliothek
Der barocke Bibliothekssaal befindet sich im nicht zugänglichen
Klausurbereich des Klosters, dem Wohnbereich der Mönche. Das große Foto
am Ende dieses Saales gibt einen Eindruck von der monumentalen Größe
dieses barocken Raumes. Zusammen mit der Depotbibliothek und den
modernen Handbibliotheken umfasst der Göttweiger Bücherbestand
insgesamt ca. 150.000 Bände, darunter 1.100 teils mittelalterliche
Handschriften und eben soviele Inkunabeln (frühe gedruckte Bücher bis
zum Jahr 1500).
Klosterbibliotheken bilden seit ihrer Gründung den Wissensstand
verschiedener Zeiten ab. Nicht nur theologisches, rechtliches oder
historisches Wissen wurde hier „gespeichert", sondern auch praktisches
und technisches Know How war hier immer am aktuellen Stand der Zeit
vorhanden. So findet sich in dem 1678 in Amsterdam gedruckten Buch
„Museum Kircherianum" von Georgio de Sepibus die Darstellung einer
optischen Projektionsmaschine, ähnlich einem Diaprojektor oder Beamer.
So ein modernes technisches Gerät („Lucerna Magica") wurde um 1724 in
Göttweig angekauft. Damit konnten Bilder an die Wand projiziert werden.

Einblick in die Göttweiger Bibliothek
Kupferstich von Salomon Kleiner (1700-1781), Blatt aus der 1744 geduckten Vedutenserie
Der barocke Bibliotheksraum hat sich seit der Fertigstellung um 1730
kaum verändert. Der Entwurf der Einrichtung geht vermutlich auf den
Architekten der Klosteranlage Johann Lucas von Hildebrandt (1668-1745)
zurück.
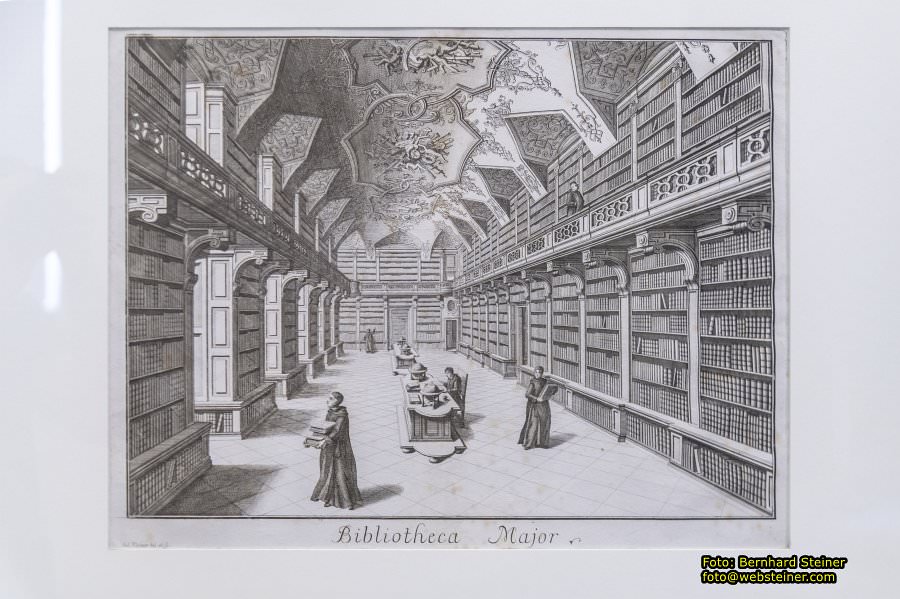
Die Doppelturmfassade wurde erst in den Jahren 1750 bis 1755 errichtet;
die Turmhelme kamen nicht zur Ausführung, daher blieben die
provisorischen stumpfen Kirchturmzeltdächer. Auch die unteren Fenster
der Türme und die Uhren des Südturms sind nur aufgemalt.


Stift Göttweig - Marillengarten
„Das Kloster soll, wenn möglich, so angelegt werden, dass sich alles
Notwendige, nämlich Wasser, Mühle und Garten, innerhalb des Klosters
befindet und die verschiedenen Arten des Handwerks dort ausgeübt werden
können." Benedikt von Nursia: Regula Benedicti, Kapitel 66.
Klostergärten haben eine sehr lange Tradition und entstanden
ursprünglich als Nutzgärten für die Versorgung der Mönche. Sie spielten
auch in der Entwicklung der Heilpflanzen eine wesentliche Rolle. Neben
dem Kräuter- und Gemüsegarten gab es natürlich auch einen Baumgarten,
in dem regionale Früchte gepflegt wurden. So wurde in den Gärten nach
dem Prinzip der Nachhaltigkeit gearbeitet und somit dauernde Werte
geschaffen. Erstmals ist der alte Marillengarten von Stift Göttweig in
seiner naturbelassenen, ursprünglichen Form zugänglich. In diesem
Nutzgarten gibt es rund 50 Bäume aus zwölf verschiedenen, in der Wachau
beheimateten, Sorten. Im Glashaus dem „Marillenbaumkindergarten"
befinden sich einjährige Jungbäume, die Sie auch im Klosterladen
erwerben können.

Herzlich willkommen im Marillengarten von Stift Göttweig, in dem seit
der Mitte des 18. Jahrhunderts die „Original Wachauer Marille" wächst!
In unserer Region sind die rund 200 Marillenbauern die "Hüter des
goldenen Schatzes". Die Original Wachauer Marille ist eine besondere
Frucht, weshalb diese Ursprungsbezeichnung von der Europäischen Union
geschützt wurde. Dafür sind die herrlich geschmackvollen Marillensorten
verantwortlich, die in unserem Gebiet auf traditionelle Art und Weise
kultiviert und verarbeitet werden. Seit 2006 ist das Gebiet der
„Original Wachauer Marille" auch offiziell „Genuss-Region". Somit
repräsentieren wir gemeinsam mit rund 100 ausgewählten Gebieten den
Feinkostladen Österreich". Auf Grund der außergewöhnlichen klimatischen
Bedingungen entstehen ausnehmend intensive Fruchtaromen. Überzeugen Sie
sich selbst!
Marillengebet
Herr, unser Gott, du Freund des Lebens, du bist unser Schöpfer und der
Ursprung von allem Guten. Wir danken dir für das, womit du uns Tag für
Tag umsorgst.
In dieser wunderbaren Landschaft haben wir unsere Wurzel und unseren
Lebensraum. Du lässt so viel Kostbares und Wertvolles an Pflanzen und
Früchten wachsen. Mit Freude und Dankbarkeit staunen wir über die
Gaben, die du uns durch die Natur schenkst.
Besonders danken wir dir für unsere Marille und die guten klimatischen
Bedingungen, die sie hier so hervorragend gedeihen lassen. Die Marille
gibt unserem Leben Sonne und Freude und lässt unser Herz höher
schlagen. Wir bewundern ihren Geschmack und freuen uns an all dem,
womit sie unseren Alltag angenehm und froh macht.
Wir bitten dich: Nimm unseren Dank entgegen. Gib, dass wir dich in
deiner Schöpfung erkennen und dir in Ehrfurcht begegnen. Sei gepriesen
in Ewigkeit. Amen.

Geographisch gesehen befinden wir uns am östlichen Zipfel des
„Dunkelsteiner Waldes". Entlang der Donau reicht dieser sagenumwobene
Wald mit seinen keltischen Kultstätten und mystischen Kraftplätzen von
Schönbühel unterhalb von Melk bis zur Wetterkreuzkirche, die über dem
alten Winzerort Hollenburg thront. Das Südufer der Donau war einst die
Grenze des römischen Reiches (Donau-Limes). Im gesamten
Dunkelsteinerwald sind die Spuren ehemaliger Römerstraßen zu finden. In
Mautern (Favianis) befand sich ein bedeutendes Römerkastell. Die Römer
waren es, die aus ihrer Heimat Früchte wie Mandel, Maroni, Pfirsich und
die Marille in die Wachau brachten. Besonders an den zur Donau hin
abfallenden Hängen gediehen der Wein und die Wärme liebenden Früchte
besonders gut.
Die Landschaft mit ihrer hügeligen Struktur, den fruchtbaren Lössböden
und den außergewöhnlichen klimatischen Bedingungen hat die Menschen,
die sich hier ansiedelten, deren Lebensweise und Kultur entscheidend
geprägt. Es ist eine reiche Landschaft - Nährboden für Kunst, Kultur,
Religion, Genuss und Tradition. Die MARILLE ist der größte Fruchtschatz
unserer Region. Die einzigartige Qualität der hier kultivierten Sorten
ist weit über die Grenzen der Wachau bekannt und sucht ihresgleichen.
Kulinarische Köstlichkeiten rund um Wein und Marille und die
zauberhafte Landschaft mit ihren vielen Kulturdenkmälern machen diese
unsere Heimat sehr anziehend für Gaste aus aller Welt.

Wem der viele Text zu lange war und lieber Bewegtbilder mit Musik mag,
kann sich gerne dieses Video antun: