web steiner
Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen
Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.
+43/2624/54014 - office@websteiner.com
Stift Herzogenburg
Herzogenburg, Juni 2023
Das Stift Herzogenburg ist ein Kloster der Kongregation der österreichischen Augustiner-Chorherren in Herzogenburg in Niederösterreich. Die Ausstellung „Zeitzeuge der Ewigkeit“ gibt Einblick in das Leben der Gemeinschaft der Augustiner-Chorherren und die über 900-jährige Geschichte des Stiftes. Neben der Prälatenstiege, dem Festsaal, der Chorkapelle, der Schatzkammer und der Bibliothek ist auch die barocke Stiftskirche zu sehen.

Die Stiftskirche wurde von Kaiser Heinrich II. um 1014 gegründet, sie
trägt als Pfarrkirche das Patrozinium des Erzmärtyrers Stephanus (nach
dem Patron der Domkirche in Passau). Im Jahre 1112 wurde das
Chorherrenstift St. Georgen gegründet. Zu seinem Unterhalt erhielt es
die Pfarren Herzogenburg und Traisenburg. 1244 fand die Übertragung des
Stiftes von St. Georgen nach Herzogenburg statt. Bis 1783 lag das
Kloster im Bistum Passau, danach gehörte es zu der durch Joseph II.
neugegründeten Diözese St. Pölten.

Im Altarraum weist alles auf das Zentrum hin, den Altar. Hier geschieht
das Mysterium, Gott kommt in der Eucharistiefeier zu den Menschen.
Gott, der als kleines Kind zu den Menschen gekommen ist, er wird auf
dem Hochaltarbild auf dem Schoß Mariens sitzend dargestellt, umgeben
von den Glaubenszeugen Georg und Stephan. Der Himmel wird gleichsam
offen für die Begegnung mit dem Menschen. Links und rechts bezeugen
dies die Aposteln Petrus und Paulus.
Zelebrationsaltar in der Stiftskirche von Prof. Wander Bertoni und den zugeordneten Kunstwerken Ambo und Vortragekreuz.

Der Altarabschluß oben weist auf die Bedingung dieser Gottesbegegnung hin: Glaube, Hoffnung und Liebe.

Diese gotische Kirche war das erste Projekt des jungen Architekten
Franz Munggenast (Sohn von Joseph Munggenast), das er bald nach der
Übernahme des väterlichen Betriebes am 9. Mai 1742 realisierte und mit
dessen Bau am 26. April 1743 begonnen wurde. Einer der wesentlichen
Künstler der Innenausstattung war der Bildhauer Johann Joseph Resler.
Nach mehr als vier Jahrzehnten Bauzeit wurde die Kirche am 2. Oktober
1785 eingeweiht. Es ist der letzte bedeutende Kirchenbau des Barock in
Österreich. Der Patron des Stiftes ist der hl. Georg, die Stiftskirche
Herzogenburg hat somit ein Doppelpatrozinium.

Blick zur Kanzel, von wo auch heute noch Impulse zur christlichen
Lebensgestaltung gegeben werden. Christus, als Sieger über das Kreuz
dieser Welt, steht auf dem Kanzeldach.
Gleich daneben (links vorne) ist der Schutzengelaltar. Der gute Geist
soll den jungen Menschen durch eine Welt voller Geldgier, Macht und
oberflächlicher Lust hindurchführen (Ovalbild: HI. Dreifaltigkeit).

Dreht man sich um, so erblickt man das Glanzstück der Kirche, die Orgel
von Johann Henke aus dem Jahr 1752. Die gelungene Kombination von
zartem Grün und Gold, die kunstvoll geschnitzte Verzierung und das
prachtvolle Orgelprospekt möchte noch einmal die Botschaft all dieser
Kunstwerke zusammenfassen: die Kirche möchte im Sehen, Hören, Empfinden
und Leben einen Weg eröffnen zu den Schönheiten dieser Welt, aber
zugleich auch über diese Welt hinausweisen.

Deckenfresken der Stiftskirche von Daniel Gran und Bartolomeo Altomonte

Unter der Mittelkuppel links erhebt sich der wuchtige Augustinusaltar.
Noch einmal wird man auf den Ordensvater hingewiesen, diesmal schreibt
er die Ordensregel für seine Kleriker und ist Bischof, Aszet, Theologe
und Seelsorger. Ihn umgeben die Vertreter der Orden, die nach seinen
Regelvorschriften leben.

Darunter, in einem kunstvollen Holzschrein, die Gebeine des Märtyrers
Urban, die im Jahre 1740 aus der Kalixtuskatakombe in Rom übertragen
wurden.
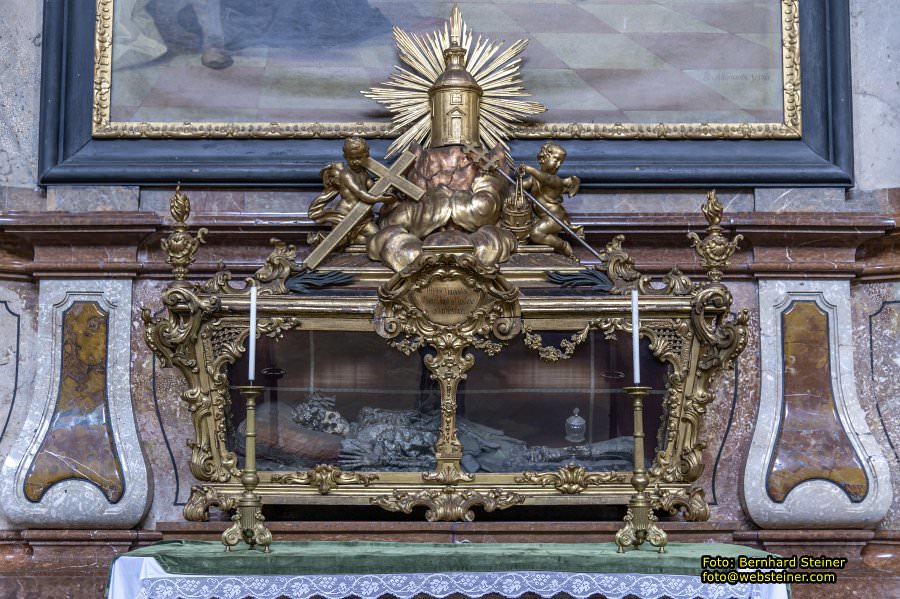
Gegenüber ist der Marienaltar mit dem Zentrum barocker Wallfahrten, dem
Gnadenbild. Dieses Marienbild soll durch den kaiserlichen Kurier
Michael Molinari 1656 nach Wien und später durch seinen Verwandten nach
Herzogenburg gebracht worden sein. Das Altarbild oberhalb zeigt den
Chorherrenheiligen Petrus Fourier, einen vorbildhaft sozial und
karitativ tätigen Seelsorger, wie er jungen Menschen das Evangelium
verkündet.

Gegenüber der Kanzel ist der hl. Josef, der Patron der Arbeiter,
dargestellt. Durch der Hände Arbeit gestaltet er die Welt und begegnet
Gott als Vater (Ovalbild: hl. Leopold).

Johann-Hencke-Orgel
Das Augustiner-Chorherrenstift Herzogenburg besitzt mit seiner
Hencke-Orgel aus dem Jahr 1752 eine der bedeutendsten Orgeln unseres
Landes. Bereits 1749, im Jahr der Fertigstellung der neuen barocken
Stiftskirche, erteilte der damalige Propst den Auftrag zum Bau einer
völlig neuen Orgel. Der Auftrag erging an Johann Hencke, der aus der
Stadt Geseke in Westfalen stammte und sich in Wien als „bürgerlicher
Orgelmacher“ niedergelassen hatte, von wo aus er weite Teile der
Donaumonarchie mit Orgeln versorgte. Die Herzogenburger Orgel war
wahrscheinlich Henckes summum opus, jedenfalls ist von ihm keine
größere Orgel bekannt. Am 18. Dezember 1752 erklang die Orgel zum
ersten Mal feierlich beim Gottesdienst. Der prächtige Prospekt der
Orgel, die grüne Fassung des Gehäuses und das goldene Rankenwerk
strahlen Harmonie und Ruhe aus.
Blick auf die historische Orgel von 1752

Deckenfresko in der Stiftskirche: „Das Martyrium des hl. Stephanus“ “ von Bartolomeo Altomonte (1753).
Die Orgel wurde 1752 von dem Orgelbauer Johann Hencke erbaut. Das
Instrument hat 40 Register auf drei Manualwerken und Pedal. Das zweite
Manualwerk, das Großpositiv, ist ähnlich einem Hauptwerk disponiert.

Wer die Stiftskirche durch das gotische, noch aus dem 15. Jahrhundert
stammende Hauptportal betritt, befindet sich in einem Kirchenraum, der
als Thronsaal Gottes gestaltet ist: Der Himmel steht offen! Die
Errichtung der Kirche wurde durch den St. Pöltner Baumeister Franz
Munggenast 1743 begonnen und war im Rohbau 1748 vollendet. An der
inneren Ausgestaltung wirkten viele Künstler mit: Bartolomeo Altomonte
malte die Fresken im Kirchenschiff und die Bilder der Seitenaltäre. Die
dekorative Wandmalerei wurde von Domenico Francia und Thomas Mathiowitz
geschaffen. Der Hochaltar stammt von Jakob Mösl, das Altarblatt und die
Fresken im Altarraum von Daniel Gran. Die einzigartige Orgel wurde von
Johann Hencke im Jahr 1752 fertiggestellt. Mit der Kirchweihe im Jahr
1785 findet die barocke Bautätigkeit ihren Abschluss: Zur Ehre Gottes
und zur Freude der Menschen wurden die Kirche und das Stift so prächtig
erbaut und gestaltet. Der Grundgedanke des offenen Himmels zieht sich
durch die gesamte Ausgestaltung des Kirchenraumes. Christus hat die
Trennung von Himmel und Erde aufgehoben: Als triumphierender Erlöser
steht er auf der Kanzel. Durch ihr Vorbild und ihre Fürsprache leiten
die Heiligen den Menschen zu Gott hin – sie sind auf den Seitenaltären
und in den vielen Gemälden des Kirchenraumes zu sehen. Himmel und Erde,
Engel und Menschen jubeln Gott, dem Herrn, zu!


Der Blick hinauf zu den Fresken sollte uns zugleich auch den Blick für
den Himmel eröffnen, für einen Zustand der Erlösung nach diesem Leben.
Und so erblickt der Besucher zunächst den Patron der Kirche, den hl.
Stephanus, der im Leben mutig seinen Glauben bekannt hat und dafür
gesteinigt wird. In der Mittelkuppel erlebt man gleichsam den
energischen Ordens-vater der Chorherren, den hl. Augustinus, wie er
symbolisch Blitze aus seiner Schreibfeder auf die Häretiker seiner Zeit
schleudert. Der Heilige ist umgeben von Päpsten, Bischöfen und
Priestern des Chorherrenordens. Das dritte Fresko vor dem Altarraum
zeigt den Stiftspatron, den hl. Georg: er hat gesiegt über das Böse in
der Welt (symbolisiert durch den toten Drachen) und so kann er ohne
Furcht für seine Überzeugung sein Leben hergeben. Diese drei Fresken
und die nun folgenden Seitenaltarbilder und Ovalbildnisse malte
Bartolomeo Altomonte zwischen 1753 und 1764.

Wenn der Besucher nun langsam in Richtung Hochaltar geht, so begleiten
ihn auf seinem Weg wieder eine Reihe von Heiligen, die sich in ihrem
Leben bewährt haben. Gleich links Sebastian, der in seinen Schmerzen
sich Kraft von oben holt (Ovalbild: hl. Anna mit Maria); ihm gegenüber
Ubald, Prior des Chorherrenstiftes Gubbio, ein eifriger Seelsorger,
der gegen das Böse im Menschen ankämpft (Ovalbild hl. Antonius). Unter
der Mittelkuppel links erhebt sich der wuchtige Augustinusaltar, rechts
der Marienaltar.


In den Fresken versucht nun Daniel Gran, der auch das Hochaltarbild
malte, diesen Geist Gottes im Pfingstgeschehen und in der
Verherrlichung der Kirche sichtbar zu machen.



Hochaltarbild von Daniel Gran (Madonna mit den Patronen Georg und Stephanus, 1746).

Als Raum für Gebet und Andacht steht den ganzen Tag über die moderne Osterkapelle
zur Verfügung. Sie wurde 1999 geweiht. Der kühle Raum besticht durch
seine Einfachheit im Kontrast zur barocken Pracht der Gesamtanlage. In
die Wand eingelassen ist eine Nische, die das Heilige Grab
symbolisiert. Davor liegt der Stein, der vom Grab weggerollt worden war
– er ist zum Eckstein, zum Stein des Lebens, zum Altar geworden.
Daneben findet sich der Ambo aus Glas. Darin ist auch das Ewiglicht
integriert: Hier wird das Evangelium, das Licht für die Welt,
verkündet. Ein 15 m langer Glasfries zeigt, von links begonnen, die
Erschaffung der Welt aus dem Chaos, den Fortgang der Schöpfung,
Christus, den guten Hirten. Zentralfigur ist der tanzende Christus, der
dem Kreuz in der Leichtigkeit eines gelösten, eben eines tanzenden
Menschen entgegengeht. Unter ihm ist das Grab – aus der Perspektive von
Ostern ist er der Auferstandene, der aus dem Grab geht. Der Fries wird
gestört durch das Kreuz, das wuchtig und kompromisslos dasteht. Doch:
Hier kommt eine Biegung in das fortlaufende Band. Durch das Kreuz
ändert sich die Richtung der Welt: Die Querseite zeigt ein Gesicht, in
das das Kreuz eingeschrieben ist. Jeder von uns trägt dieses Zeichen
Christi in sich. Die Welt ist vollendet. Der Dreischritt der
christlichen Heilsordnung Schöpfung – Erlösung – Vollendung ist auf
eindrucksvolle Weise von Prof. Wolfgang Stifter, Linz, gestaltet worden.

Seit über 900 Jahren leben und wirken die
Augustiner-Chorherren im Unteren Traisental. Unter dem Motto „Zeitzeuge
der Ewigkeit“ bietet der Rundgang Einblicke in das Barockstift und den
Orden. Die Führung bringt die Besucher:innen unter anderem in den
Festsaal, die Chorkapelle, die Bibliothek und einen der letzten
vollständig erhaltenen barocken Bildersäle. Krönender Abschluss jedes
Besuches ist die Stiftskirche.

Das Kloster wurde 1112 durch Ulrich I. von Passau in St. Georgen an der
Traisen am Zusammenfluss der Traisen mit der Donau gegründet und 1244
wegen der häufigen Überschwemmungen 10 km traisenaufwärts nach
Herzogenburg verlegt. Dadurch entstand dort auch der „Obere Markt“, der
durch das Chorherrenstift grundherrschaftlich verwaltet wurde, während
der „Untere Markt“ als bairische Gründung bis zu seinem 1806 erfolgten
Kauf durch das Chorherrenstift im Besitz des Klosters Formbach verblieb.

Vorwerk am Nordtor
Die repräsentativste Zufahrt zum Stift liegt an der Nordseite. Dies
findet seinen Grund möglicherweise darin, dass dies jene Seite ist, die
der Richtung Krems zugewandt ist. Diese Stadt war früher der
unbestrittene Mittelpunkt der ganzen Gegend. Die Gestaltung stammt von
Joseph Munggenast. Die noble Färbelung in weiß und grau und die davor
liegende Platzgestaltung lassen den Vorbau in richtiger Weise zur
Geltung kommen, Putten geben ihm ein verspieltes Aussehen. In der Mitte
des Giebels findet sich, von Engeln gehalten, das Zeichen des hl.
Augustinus, das brennende Herz.

Der Schwerpunkt der Kunstsammlung liegt auf spätgotischen Werken, wie
Tafelbildern, Skulpturen und Glasfenstern. Der große Festsaal, die
Schatzkammer und die Klosterbibliothek, mit ihren Handschriften und
Inkunabeln, sowie das Münzkabinett unterstreichen die kunsthistorische
Bedeutung des Stiftes innerhalb Niederösterreichs. Erwähnenswert ist
auch der barocke Bildersaal, der nicht nur religiöse Motive
thematisiert. Als Besonderheit gilt ein gut erhaltener römischer
Gesichtshelm, der in einer Schottergrube in der Umgebung gefunden wurde
und ungefähr auf das Jahr 150 n. Chr. datiert wird.

Ab 1714 wurde das Stift Herzogenburg durch Jakob Prandtauer, Johann
Bernhard Fischer von Erlach und Joseph Munggenast barockisiert. Der
josephinischen Aufhebungswelle der Klöster konnte das Stift entgehen,
die aufgelösten Chorherrenklöster Dürnstein und St. Andrä an der
Traisen wurden mit ihren vielen Pfarren nach Herzogenburg inkorporiert,
sodass das Stift materiell deutlich gestärkt aus den Josephinischen
Reformen hervorging.

Gartenanlagen
Ab dem Jahr 1714 wurde das Stiftsgebäude von Jakob Prandtauer neu
errichtet. Unmittelbar dazu geplant wurden auch die Gärten, die je nach
ihrer Bestimmung ebenso funktionell wie repräsentativ zu sein hatten.
Neben den der Eigenversorgung dienenden Anlagen wie Kräuter- oder
Obstgarten, wurde, der klösterlichen Hierarchie entsprechend, ein
Garten für den Prälaten, einer für den Dechant, den Stellvertreter des
Prälaten, sowie ein Garten für die Mitbrüder, der Kapitelgarten,
gestaltet.

Im Zuge der Stiftsrenovierung war es eine Notwendigkeit, für den
wiedererstehenden barocken Gesamteindruck des Klosters die bedeutenden
Teile der Gärten wieder zu errichten. Dies wurde in unserem Haus ab dem
Jahr 2002 in Angriff genommen. Nachdem die Folgen des Klimawandels und
eingeschleppte Schädlinge den Gärten große Schwierigkeiten bereiteten,
konnte im Jahr 2022 der Barockgarten umfassend in Stand gesetzt werden.
Die bunten Elemente des Staudenbeets wurden dem Klima der Region
entsprechend auswählt und sind langlebig, pflegeleicht und
insektenfreundlich. Mit ihrer guten Fernwirkung, können sie von den
Räumen der ersten Etage bestens betrachtet werden, was dem barocken
Gestaltungsgedanken entspricht.

Die Gestaltung der Fassaden wurde von Jakob Prandtauer geplant. Er
achtete auf größtmögliche Homogenität und versuchte, durch die für ihn
typischen Fassadengliederungen ein ansprechendes Äußeres zu gestalten.
Insgesamt befinden sich am Stiftsgebäude knapp 460 Fenster, die
teilweise als Kastenfenster ausgeführt sind. Die Ostfassade, deren
Mächtigkeit sich daraus ergibt, dass durch das abfallende Gelände an
dieser Gebäudeseite ein zusätzliches Stockwerk (die Sala terrena) zu
Stande kommt, wird im Zuge des Festsaalbaus durch Johann Bernhard
Fischer von Erlach geplant. Ihm gelingt es, die Fassadengestaltung in
den klassizistischen Stil weiterzuführen. Besondere Feinfühligkeit und
Rücksichtnahme gegenüber der Fassadengliederung von Jakob Prandtauer
kann man ihm jedoch dabei nur schwer unterstellen.
Architektur
Eine Palastfassade stellt sich im Osten vor, in deren Mitte sich drei
Säle aufeinander türmen: Unten die Sala terrena - der Gartensaal als
Hauptzugang zum Prälatengarten. In der Etage darüber der Theatersaal,
welcher der Bildung und kulturellen Unterhaltung diente. Bekrönt wird
das Ensemble durch den Festsaal, der sich über zwei Etagen erstreckt
und in dem die Gäste des Stiftes begrüßt wurden. Seine Fenster sowie
der kleine Balkon offenbaren den lohnendsten Blick auf den Garten! Im
Giebel über dem Festsaal ist der heilige Georg zu sehen, der seit mehr
als 900 Jahren der Patron des Stiftes ist; ganz oben schließlich die
Weltkugel, bekrönt mit dem Kreuz. Im Bereich der Übergänge nimmt man an
der Fassade gewisse Unstimmigkeiten wahr: Die seitlichen Teile wurden
durch Jakob Prandtauer geplant und gebaut, während der Mitteltrakt von
Johann Bernhard Fischer von Erlach wie ein mächtiges Gartenpalais
entworfen und erst im Lauf des Bauvorganges eingefügt wurde.

Unentbehrlich sind fließendes Wasser und ein Brunnen: Wasser ist Leben!
Gleichzeitig zeigen diese Wasserquellen an, dass das Paradies keine
autarke Maschinerie ist: Wie das fließende Wasser des Mühlbaches und
das aus den Tiefen kommende Brunnenwasser den Garten biologisch am
Leben erhalten, so geschieht das im Leben der Schöpfung durch die
unablässige liebende Zuwendung Gottes.

Zu den barocken Räumen führt die Haupt- oder Prälatenstiege, die ab
1732 eingebaut wurde. Das Fresko im Mittelfeld der Decke schuf
Bartolomeo Altomonte 1779. In einer barocken Allegorie zeigt es die
Übertragung des Stiftes von St. Georgen nach Herzogenburg im Jahre
1244. Den Stuck schuf der St. Pöltner Balthasar Pöck. Im Jahre 2009
konnten die Prälatenstiege und der daran anschließende Gang einer
Restaurierung unterzogen werden, bei der die barocke Färbelung des
Stucks wieder hergestellt wurde.
Deckenfresko über der Prälatenstiege: „Felix Transmigratio“ von Bartolomeo Altomonte

Auf außenstehende Personen wirkt das Stift riesig und unübersichtlich.
Doch bei genauerer Betrachtung zeigt sich, dass die großzügige Bauweise
der Barockzeit einen anderen Umgang mit Raum hatte, als wir ihn heute
gewöhnt sind. So wird nahezu ein Drittel der gesamten verbauten Fläche
von Gängen in Anspruch genommen, ein weiteres Drittel durch
repräsentative Räume und Säle, die nicht für eine permanente Nutzung
gedacht waren und sind.

Das Stift Herzogenburg ist ein Gesamtkunstwerk. Im Rahmen einer
Führung, die ca. 75 Minuten dauert, bekommen Sie Einblick in die
Geschichte und das Leben der Gemeinschaft der Augustiner-Chorherren. Im
Rahmen der Ausstellung „Zeitzeuge der Ewigkeit“ sind auch zu sehen:
Prälatenstiege, Festsaal, Sammlungen, Chorkapelle, Schatzkammer und
Bibliothek.

Eine durchdachte Klosteranlage erhob zudem den Anspruch, die große Welt im Kleinen abzubilden:
Alles, was zum Leben gebraucht wurde, sollte innerhalb der
Umfassungsmauer zu finden sein. Auch in Herzogenburg versuchte man das
zu verwirklichen. Davon legt z.B. der Meierhof Zeugnis ab, welcher im
Nordosten der Anlage zu finden ist, aber auch die Mühle (das heutige
Elektrizitätswerk) im Südosten. Entsprechend der inneren Ordnung des
Stiftes wurden verschiedene Gärten mit unterschiedlichem Charakter und
Zweck errichtet:
Der Kapitelgarten entlang der Nordfassade zur Erholung der Mitbrüder,
der große Nutzgarten im Südosten mit dem Gärtnerhaus, der Dechants- und
der Hofrichtergarten im Süden als private Rückzugsorte für Dechant
(Stellvertreter des Propstes) und Hofrichter (oberster Beamter des
Stiftes) sowie der prächtige Prälatengarten im Osten. Der Aufenthalt in
diesem Garten war zur Barockzeit eher zweitrangig. Vorrangig sollte und
konnte das Gartenparterre aus den Räumen der ersten Etage (Festsaal,
Prälatur, Gästezimmer) betrachtet werden. Es sollte den Gästen und
Besuchern ein farbenfrohes Bild vor Augen stehen. Im Rahmen einer
Stiftsführung können Sie diesen Anblick genießen!
Nachdem das Barockparterre des Prälatengartens Anfang der 2000er Jahre
wiederhergestellt worden war, wurde es nun, 20 Jahre später, wieder
Zeit, die Bepflanzung anzupassen. Der Buchs war dem Buchsbaumzünsler
zum Opfer gefallen, die klimatischen Veränderungen hatten dem Garten
zugesetzt. Klimafit und nachhaltig sollte er nun werden! Statt eines
weißen Kiesbandes und der Bepflanzung mit Buchs ist nun ein Staudenbeet
eingezogen. Die bunten Zierelemente bestehen aus langlebigen Stauden
und Zwiebelpflanzen, deren Schema sich rhythmisch wiederholt. In voller
Sonne besteht bei der neuen Bepflanzung nur wenig bis mittlerer Wasser-
und Nährstoffbedarf, die Pflanzen sind für die Region ausreichend
winterhart. Sie besitzen eine kompakte Wuchsform bis max. 80 cm Höhe,
sind pflegeleicht, robust und unter normalen Umständen schädlingsfrei.
Soweit als möglich wurde auch auf die Insektenfreundlichkeit geachtet.
Das Beet ist mit Hortensien- (Hydrangea paniculata Phantom) bzw.
Fliederhochstämmen (Syringa meyeri Palibin) gegliedert. Anstelle von
Buchskegeln wird kugelförmig geschnittene Frühlingsduftblüte (Osmanthus
burkwodii) verwendet. Durch ihre Form und die geometrische Gliederung
sind die gewählten Pflanzen ein schon im Barock übliches
Gestaltungsmittel, die jeweilige Blühzeit lässt unterschiedliche
Blickfänge entstehen. Durch möglichst kräftige Farben und große Blüten
üben sie eine gute Fernwirkung aus, denn das Parterre ist dazu gemacht,
von den höher gelegenen Fenstern des Gebäudes aus betrachtet zu werden.
Folgende Gattungen wurden daher ausgewählt: Fetthenne (Sedum),
Schwertlilie (Iris), Schleifenblume (Iberis), Storchschnabel
(Geranium), Aster (Aster), Minzen (Calamintha, Nepeta), Witwenblume
(Knautia), Salbei (Salvia), Narzissen (Narcissus), Hyazinthen
(Hyazinthus), Kaiserkrone (Fritillaria), Zierlauch (Allium), etc.

Den durch zwei Stockwerke aufragenden Festsaal plante der kaiserliche
Architekt Johann Bernhard Fischer von Erlach. Die majestätische
Raumgestaltung nimmt keine Rücksicht auf das ursprüngliche Konzept von
Jakob Prandtauer. Der früher für Empfangs- und Repräsentationszwecke
genutzte Saal ist vor allem mit Ornamentmalerei in den Farben altrosa,
apfelgrün und königsblau gestaltet.
Mittleres Bild: Propst Frigdian Knecht war an der Barockisierung des Stiftes beteiligt

Das Deckenfresko stammt von Bartolomeo Altomonte (1772). Es zeigt in
der Mitte die Allegorie der Kirche von Passau, die mit dem Bibelzitat
„ite et vos in vineam meam“ („Geht auch ihr in meinen Weinberg“) auf
die Wappen einiger Chorherrenstifte deutet – ein deutlicher Hinweis auf
deren Aufgabe in der Seelsorge.


Die Ölgemälde stellen Bischöfe und Pröpste dar, die sich um das Stift in besonderer Weise verdient gemacht haben.


Gotische Sammlung
Das Stift Herzogenburg besitzt eine der bedeutendsten Sammlungen an
gotischen Tafelbildern in Niederösterreich. Das Hauptaugenmerk liegt
auf Werken der Donauschule. Heute sind die Exponate nach
topographischen Gesichtspunkten aufgestellt. So finden Sie im „Garser
Zimmer“ bemalte Tafeln und Glasfenster aus der alten Pfarrkirche von
Gars/Thunau.

Das „Aggsbacher Zimmer“ enthält Werke aus der von Kaiser Joseph II.
aufgelassenen Kartause Aggsbach/NÖ. Hier befindet sich der Höhepunkt
der Sammlung: Die vier doppelseitigen Tafelbilder des ehemaligen
Aggsbacher Hochaltares, von Jörg Breu dem Älteren im Jahre 1501
geschaffen, zeigen das Leiden des Herrn und das Marienleben in
vorzüglicher Komposition und Farbtechnik. Der ebenfalls in diesem Raum
ausgestellte Marientod zählt zu den bedeutendsten Plastiken Österreichs
aus der Zeit um 1500.

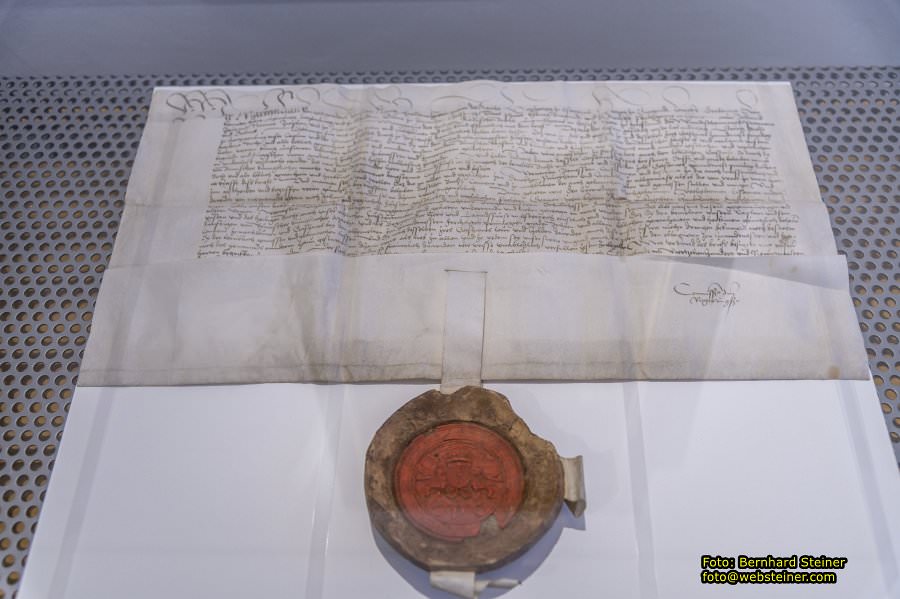
Chorkapelle
In diesem Raum treffen sich die Mitglieder der Gemeinschaft des Hauses
am Morgen, zu Mittag und am Abend zum Gebet. Das Altarblatt von
Martin Altomonte führt den Freskenzyklus weiter indem es die
Verkündigung Mariens darstellt.

Ähnlich den Gewölben der Stiftskirche ist die Kapelle mit ornamentaler
Architekturmalerei ausgestaltet. Sie stammt von Domenica Francia
(1756). Das Zentrum der Kuppel zeigt das Monogramm Mariens, in den vier
Kartuschenfeldern befinden sich Fresken von Martin Johann Schmidt, der
der „Kremser Schmidt“ genannt wird. Sie stellen Szenen aus dem Leben
Mariens dar. Im Osten beginnt der Zyklus mit der Geburt, es folgt im
Westen der Tempelgang, im Norden die Vermählung und im Süden die
Darstellung als Immaculata.

Von Beginn an schmückten die Chorherren ihr Kloster mit heiligen
Bildern. Deren Mode ist weitgehend zeitgebunden, womit sich ein Ansatz
für die Gestaltung einer Sammlung ergibt: Das Ziel besteht darin, die
Kunstwerke aus früheren Zeiten aufzubewahren. Selbiges gilt für
„heiliges Gerät“ aus den Sakristeien, die entweder nicht mehr benötigt
oder nicht mehr verwendbar waren. Auch diese Gegenstände fanden Eingang
in die Kunstsammlungen. In Herzogenburg machten sich die Chorherren
Ludwig Mangold (1786-1833)
und Theodor von Patruban (1805-1872) um das Zustandekommen der
Kunstsammlungen besonders verdient. Ihnen ist der Erwerb der
bedeutendsten Werke der heutigen gotischen Sammlung zu verdanken.
Erst nach der Aufklärung entstand in den Klöstern ein gezieltes
Sammlerinteresse in unserem heutigen Sinn: Gegenstände wurden erworben,
die Sammlungen systematisch auf- und ausgebaut. So besteht auch der
größte Teil der heutigen Sammlung von Objekten eingenommen, die im 19.
Jh. erworben wurden. Einiges davon stammt aus „Restbeständen“ der
Stiftspfarren, die ihre Erhaltung überhaupt dem Umstand verdanken, in
das Stift verbracht worden zu sein. Die heutige Darstellung der Sammlung versucht, diese als
selbstverständlichen Teil der Geistesgeschichte des Hauses zu
präsentieren. Ihr Zustandekommen verdankt die Sammlung keinem
repräsentativen Anspruch, sondern dem Gedanken des Erhaltens und
Bewahrens. Dieser Grundgedanke soll auch in die Zukunft weisen:
Sammlungen sind ein wichtiger Bestandteil des „kollektiven
Gedächtnisses“ der Kulturnation Österreich.

Schatzkammer
Hier sind kirchliche Geräte und Paramente untergebracht, deren Gebrauch
für besondere Festtage vorgesehen ist. Teils verschönern sie heute noch
die Gottesdienste des Stiftes, teils wurden sie durch die
Liturgiereform des II. Vatikanischen Konzils (1962-65) außer Dienst
gestellt oder werden mit Blick auf ihren historisch-künstlerischen Wert
und die durch den Gebrauch zu erwartenden Beschädigungen nicht mehr
verwendet.
Unter den ausgestellten Kunstwerken ragt die Monstranz aus dem Jahr
1722 hervor. Die ovale Mittelkapsel, die der Präsentation des
Allerheiligsten dient, wird umrahmt von einem reich geschmückten
Kronenbaldachin. Der Entwurf stammt vom Wiener Architekten Matthias
Steindl. Gefasste Halbedelsteine und Emailbilder zieren die Monstranz,
die nach wie vor zu Fronleichnam verwendet wird.

Monstranz aus dem Jahr 1722

Stiftsbibliothek
Zu den Schätzen eines Klosters zählt häufig auch ein reichhaltiger
Bücherbestand. Er ist der geistige Schatz eines Klosters. Deshalb
wurden für die Aufbewahrung der Bücher kostbare Bibliotheksräume
geschaffen.

Die spätbarocke Bibliothek des Stiftes Herzogenburg ist kein
übertriebener Prunkraum, sondern eher ein eleganter schlichter
Studiersaal. Die Ornamentmalerei an Decke und Wänden stammt von
Domenico Francia. Die Bücherschränke entwarf Johann Hencke, der auch
die prachtvolle Orgel der Stiftskirche geschaffen hat.

Dieser Teil der Stiftsbibliothek, die insgesamt 60.000 Bände umfasst,
ist mit ca. 20.000 Werken aus dem 18. Jh. bestückt. Die älteste
Handschrift ist ein Psalterium aus dem 12. Jh. Künstlerisch wertvoll
sind auch drei Prunkbände mit einem Werk Gregors des Großen, die
„Moralia in Hiob“.

Klostergang

Die Ausstellung „900 Jahre Stift Herzogenburg – Zeitzeuge der Ewigkeit“
lädt die Besucherinnen und Besucher ein, in die Welt des klösterlichen
Lebens einzutauchen. Zu sehen sind die renovierten Stiftsgebäude und
die wertvollen Kunstsammlungen, die das Stift aufzuweisen hat. Die
bedeutenden gotischen Tafelbilder und zahlreiche andere Kostbarkeiten
werden in zeitgemäßer Weise präsentiert. Die Stuckarbeiten an der Decke
und in den Fensternischen stammen aus
der Barockzeit, die romantische Dekormalerei und der Kamin aus dem
vorigen Jahrhundert.

Dem Auge des heutigen Betrachters ist der Bildersaal
schon beim Eintreten ungewohnt: Das Ideal einer barocken Galerie lag
darin, einen Raum mit Bildern quasi „auszutapezieren“. Um eine gewisse
Symmetrie in der Gestaltung der einzelnen Wände zu erreichen, wurden
Bilder zurechtgeschnitten, zerteilt oder auch ergänzt. Nicht dem
Einzelkunstwerk kommt bei dieser Galerie ein besonderer Wert zu,
sondern der Gesamtheit des Eindruckes. Die 144 Gemälde sind teilweise
sehr kostbar. Viele der Bilder sind Kopien bzw. Nachempfindungen von
Werken, deren Originale sich z.B. in den kaiserlichen Sammlungen
befanden. Das schmälert ihren Wert für diesen Raum keineswegs: Beim
heutigen Museumsbesuch kauft man sich Ansichtskarten oder Poster von
Werken, die einem gut gefallen. In der Barockzeit musste man sie
nachmalen lassen, um sich das Kunstwerk nach Hause holen zu können. In
vielen Schlössern und Stiften wurden in der Barockzeit vergleichbare
Bildersäle eingerichtet, doch schon im 19. Jh. trafen sie nicht mehr
den Geschmack der Zeit und wurden oftmals aufgelöst, so dass man
wirklich von einem Glücksfall sprechen muss, dass der Herzogenburger
Bildersaal zur Gänze erhalten blieb.

Dieser Raum ist das seltene Beispiel einer barocken Galeriegestaltung.
Die Wände dieses bezaubernden Raumes wurden vermutlich schon um 1737
mit Bildern „austapeziert". Die Gemälde wurden nach einem geometrischen
Schema angeordnet - ein zentrales Mittelstück, von kleineren Gemälden
umrahmt, die manchmal verkleinert, vergrößert oder auch geteilt wurden,
um die Flächen vollständig zu bedecken.

Dieser Galerie kommt nicht nur wegen ihres kulturgeschichtlichen Wertes
Bedeutung zu, sondern es befinden sich unter den 144 Bildern auch
hervorragende Kunstwerke: Ein Gemälde mit der Darstellung der Heiligen
Familie wird Vincenzo di Biagio Catena zugeschrieben; ein auf Holz
gemaltes deutsches Männerporträt mit der Signatur „H. H. 1521" wird als
Werk Hans Holbeins des Jüngeren bezeichnet; zwei Landschaftsbilder
stammen aus der Hand von Alessandro Magnasco (Genua 1677-1749); eine
bedeutende niederländische Tafel stellt eine Marktszene von D.
Vinckeboons dar. Unter den Werken österreichischer Barockmaler sind vor
allem ein Marienbild von Paul Troger und eine Ölbergszene
hervorzuheben, die ein Werk F. A. Maulbertschs sein dürfte.

Hl. Georg


Stiftsturm
Das Wahrzeichen des Stiftes und der Stadt Herzogenburg ist zweifellos
der Kirchturm. Seine Geschichte geht zurück in die Zeit, als die
Chorherren 1244 von St. Georgen nach Herzogenburg kamen und mit dem Bau
einer neuen Kirche begannen. Die untere Hälfte des Turmes stammt noch
aus dieser Zeit, das gotische Eingangsportal ist das sichtbare Zeichen
dieser Bauperiode (der Vorbau wurde zum Schutz gegen die Witterung um
1820 errichtet). Als der Neubau und die Einrichtung der barocken Kirche
ziemlich weit fortgeschritten waren, beauftragte Propst Frigdian Knecht
den St. Pöltner Maurermeister Matthias Munggenast 1765 mit der
Barockisierung des Kirchturmes. Unter Zuhilfenahme eines älteren Planes
des Hofarchitekten Johann Bernhard Fischer von Erlach wurde der Turm
nun gestaltet und um 20 Klafter erhöht (heutige Gesamthöhe 75m). Die
originelle Turmspitze mit Herzogshut und Stiftskreuz wurde am 6. Juli
1767 um die Mittagszeit „unter Pauken- und Trompetenschall“ aufgesetzt.

Wem der viele Text zu lange war und lieber Bewegtbilder mit Musik mag,
kann sich gerne dieses Video antun: