web steiner
Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen
Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.
+43/2624/54014 - office@websteiner.com
Stift Vorau
das Augustiner-Chorherrenstift Vorau, Juli 2024
Das Augustiner-Chorherrenstift Vorau liegt in der
nordöstlichen Steiermark in der Marktgemeinde Vorau. Das Kloster geht
auf eine Gründung Markgraf Ottokars III. von Traungau und seiner Frau
Kunigunde im Jahr 1163 zurück, aus Dankbarkeit für die Geburt des lang
ersehnten Erben. Markgraf Ottokar übergab daraufhin seine steirischen
Besitzungen zwischen Wechsel und Masenberg dem Salzburger Erzbischof
Eberhard I, der zur Besiedelung Augustiner-Chorherren aus dem Domstift
St Rupert schickte.

Das Augustiner-Chorherrenstift Vorau ist seit 1163 ein seelsorgliches,
kulturelles und geistliches Zentrum in der nördlichen Oststeiermark.
Hinter den schönen Fassaden des Hauptgebäudes können Sie eine
farbenprächtige Bilderwelt und viel Gold im barocken Kirchenraum
bewundern.

Stift Vorau
Eingebettet in die reizvolle Landschaft des Jogllandes ist das
Augustiner-Chorherrenstift Vorau ein Zentrum des Gebetes und der
Seelsorge, der Bildung und der Kultur. Das Augustiner-Chorherrenstift
Vorau wurde 1163 von Markgraf Otakar III. als erste Tochtersiedlung von
Seckau gestiftet. Im 12. Jahrhundert wurde eine romanische
Pfeilerbasilika errichtet. 1660 bis 1662 kam es zum Neubau der Kirche
unter Domenico Sciassia, wobei die mittelalterlichen Türme beibehalten
wurden.

Die besonderen Schmuckstücke sind die 1706 entstandene Kanzel, die sich
mit der Lehrtätigkeit Jesu Christi befasst; und der 1701 bis 1704
ausgeführte Hochaltar, der die Himmelfahrt Mariens (Kirchenpatrozinium
am 15. August) darstellt. Beide wurden von Matthias Steinl entworfen
und von den Bildhauern J. F. Caspar und G. Niedermayr ausgeführt.

Die Stiftskirche wurde 1660–1662 nach Plänen von Domenico Sciassia
erbaut. Ab 1700 wurde sie durch den kaiserlichen Ingenieur Matthias
Steinl im Stile des Wiener Hochbarock umgestaltet. Steinl entwarf die
Kanzel, die die Lehrtätigkeit Jesu von Nazaret thematisiert und den
Hochaltar, der die Himmelfahrt der Maria (Mutter Jesu) darstellt. Seit
1783 ist die Stiftskirche die Pfarrkirche der Pfarre Vorau. Die
überlebensgroßen Plastiken des Hochaltares gestaltete hauptsächlich der
aus Würzburg zugewanderte Bildhauer Franz Caspar, wie auch Jakob Seer.

Die erste Stiftskirche war eine dreischiffige Basilika mit hölzerner
Flachdecke und zwei Westtürme. Diese brannte 1237 ab. Der Wiederaufbau
dauerte bis gegen 1300. Während der im Kern noch romanische südliche
Uhrturm in der Spätgotik um das etwas verjüngte Obergeschoss mit
abschließendem Keildach erhöht wurde, entstand der Glockenturm auf der
Nordseite 1597 neu.

Besondere Schmuckstücke sind die 1706 entstandene Kanzel, die sich mit
der Lehrtätigkeit Jesu Christi befasst; und der 1701 bis 1704
ausgeführte Hochaltar, der die Himmelfahrt Mariens (Kirchenpatrozinium)
darstellt. Beide wurden von Matthias Steinl entworfen und von den
Bildhauern J. F. Caspar und G. Niedermayr ausgeführt.

Die mittelalterliche Kirche wurde unter Belassung der beiden Westtürme
und der dazwischen liegenden Vorhalle 1660-62 von Domenico Sciassia
durch einen barocken Neubau ersetzt. Bereits 1688 wurde der
Stiftskirche ein neues Presbyterium angefügt.

Der frühbarocke Kirchenbau erhielt knapp vierzig Jahre nach
Fertigstellung ab 1700 eine hochbarocke Neugestaltung des Innenraumes.
Erstmals im steirischen Barock verwirklichte man hier eine komplette
Freskierung der Kirche. Ursprünglich war eine Stuck-Fresken-Ausstattung
geplant, wie die erhaltenen Reste in den Gewölben der südlichen
Turmkapelle und der beiden westlichen Seitenkapellen des
Kirchenschiffes belegen.


Zum Stiftsjubiläum 2013 wurde das Kircheninnere samt Sakristei und
Kapitelsaal restauriert, und die Firma Orgelbau Pirchner GmbH & Co.
KG aus Steinach am Brenner baute eine neue mechanische
Schleifladenorgel, die über 34 Register, verteilt auf 2 Manuale und
Pedal, und 2471 Pfeifen verfügt.


In diesem Schrein befinden sich die Reliquien des hl. Märtyrers Julius.
Der hl. Julius war ein römischer Senator und lebte in Rom. Von den hl.
Märtyrern Eusebius, Vincentinus und Pontianus wurde Julius im
christlichen Glauben unterrichtet und vom hl. Priester Rufinus getauft.
Wegen seiner Treue zu Christus wurde der hl. Julius unter Kaiser
Comodus am 19. August im Jahre 192 mit Prügeln erschlagen. Seine
Reliquien kamen unter Propst Philipp Leisl im Jahre 1695 nach Vorau.




In der Sakristei hat J. C. Hackhofer ein Fresko mit der Vorstellung von
Himmel und Hölle zu Beginn des 18. Jh. hinterlassen. Die Bibliothek im
Rokokostil beherbergt viele Bücher, die Zeugnis geben für die Bedeutung
der Orden für die Kultur und Wissensgeschichte Europas durch viele
Jahrhunderte. Zu den Handschriften zählen z.B. die „Vorauer
Kaiserchronik“ und die „Vorauer Volksbibel“, die zum UNESCO
Weltkulturerbe zählt.

Beicht- und Kerzenkapelle




Die Sakristei ist ein schlichter Rechtecksaal mit Flachdecke, der im
Zuge der Neuerrichtung des Klausurgebäudes 1625-1635 entstand. Seine
Freskenausstattung, die ihn zum künstlerischen Juwel des Stiftes Vorau
macht, wurde 1715/16 von dem Stiftsmaler Johann Cyriak Hackhofer und
dessen Schülern geschaffen. Hackhofer gilt als der bedeutendste barocke
Monumentalmaler der Steiermark. Die Sakristei ist bis auf die
eingebauten, reich mit Zinnintarsien versehenen Sakristeischränke von
1716 komplett freskiert. Die Decke sowie die Westwand sind der
Darstellung des Jüngsten Gerichts gewidmet. Im östlichen Teil der Decke
ist der zum Weltgericht wiedergekehrte Christus auf einem Regenbogen
dargestellt. Christus als der hell erleuchtete Mittelpunkt ist von
einem Kreis aus Wolken, Engeln und Heiligen umgeben, aus dem Maria und
Johannes der Täufer als Fürbitter hervorgehoben sind. Der Teil der
Decke Richtung Westen ist den von Engeln präsentierten
Leidenswerkzeugen (Arma Christi) gewidmet, die um das Kreuz Christi
versammelt sind, das somit den Sieg Christi über den Tod
versinnbildlicht. Der Abschluss der künstlerischen Gestaltung befindet
sich an der Westwand mit dem Höllensturz der Verdammten. Das in
rötlich-braunem Kolorit gehaltene Fresko schildert fantasievoll die
Bestrafung der Laster, insbesondere der sieben Hauptsünden, durch
diverse Teufel und Folterknechte. Auf den Wänden sind Szenen aus dem
Leiden Christi (Fußwaschung, Letztes Abendmahl, Blutschwitzung,
Geißelung, Dornenkrönung, Kreuztragung und Kreuzigung) dargestellt.

Auf den Wänden erscheinen in einfachen illusionistischen Rahmungen
Szenen aus dem Leiden Christi (Fußwaschung, Letztes Abendmahl,
Blutschwitzung, Geißelung, Dornenkrönung, Kreuztragung und Kreuzigung).
In der Mitte des östlichen, stark belichteten Deckenteils thront
Christus auf dem Regenbogen. Um ihn scharen sich die Heiligen des Alten
und des Neuen Bundes sowie anbetende Engel.

Der "Höllensturz" zeigt, umgeben von Flammen, teuflischen Gestalten und
anderen höllischen Ungeheuern, den Sturz personifizierter menschlicher
Laster wie Geiz, Unzucht, Hochmut, Trunksucht, Verleumdung usw.
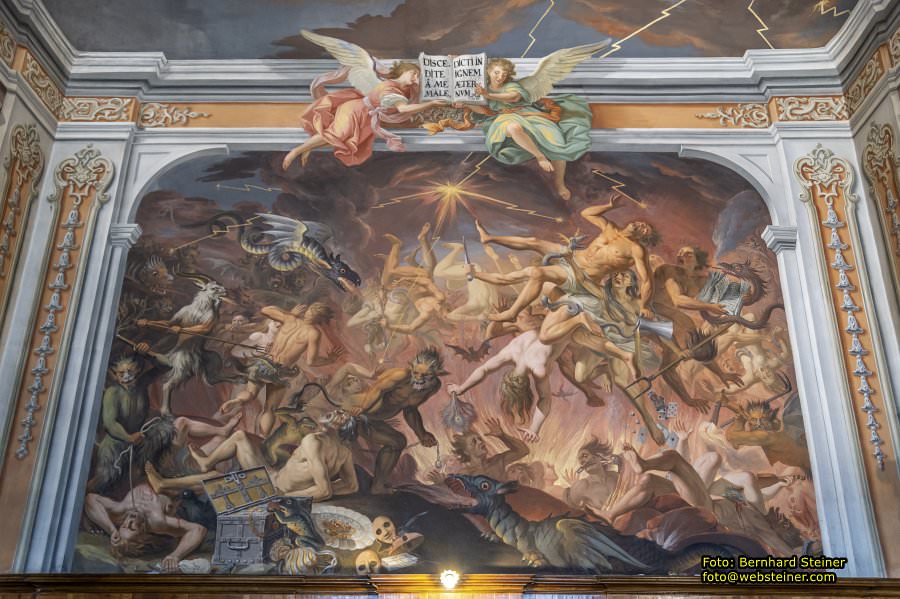
Der umfangreiche Bestand der Vorauer Stiftsbibliothek umfasst etwa
40.000 Bände zu denen 415 Handschriften, 179 Inkunabeln und 82
Frühdrucke zählen. Ein Juwel unter den Handschriften stellt das Vorauer
Evangeliar aus dem letzten Viertel des 12. Jh. mit seinen prächtigen
ganzseitigen Evangelistendarstellungen dar. Ihren hohen
literaturhistorischen Wert verdankt die Vorauer Handschriftensammlung
der ältesten frühmittelhochdeutschen Sammelhandschrift geistlicher und
weltlicher Dichtung. Das um 1190 unter Propst Bernhard entstandene Werk
enthält u.a. die Kaiserchronik, die Vorauer Genesis, das Ezzolied und
die Dichtungen der Ava, der ersten namentlich bekannten,
deutschsprachigen Dichterin.

Besonders bedeutend ist die gut erhaltene Bibliothek des Stiftes. Der
1731 fertiggestellte Bibliothekssaal beherbergt etwa 17.500 Bände,
darunter 415 Handschriften und 206 Inkunabeln. Darunter sind bedeutende
Handschriften wie das Vorauer Evangeliar aus dem 12. Jahrhundert, die
im Jahre 1467 (in österreichischer Bastarda) geschriebene Vorauer
Volksbibel mit über 550 Miniaturen und die Vorauer Handschrift, die
umfangreichste und wichtigste der alten Sammelhandschriften mit
geistlichen frühmittelhochdeutschen Dichtungen, von denen viele
nirgends sonst überliefert sind. Diese enthält auch die Kaiserchronik –
eine poetische Kaisergeschichte von Julius Caesar bis zum zweiten
Kreuzzug.

Der Bibliothekssaal wurde 1731 reich mit Stuck und Fresken
ausgeschmückt. Der zarte Bandlwerkstuck stammt von den aus der Schweiz
stammenden Künstlern Domenico Androi und Giovanni Bistoli, während die
Hackhofer-Schüler Joseph Georg Mayr und Ignaz Gottlieb Kröll für die
1731 entstandenen Fresken verantwortlich zeichnen.

Besonders hervorzuheben sind das Vorauer Evangeliar, die Vorauer Handschrift und die Vorauer Volksbibel.

Das gesamte Freskenprogramm steht unter dem Motto, das über dem Portal
angebracht ist: „Den Weg der Weisheit will ich dir zeigen.“ An der Ost-
und Westwand sind Darstellungen des Erlösers, der Evangelisten,
Propheten und Kirchenväter sowie der vier damals bekannten Erdteile zu
sehen. Ergänzt werden diese Idealportraits durch einen Zyklus
wissenschaftlich tätiger Chorherren. Die Wölbung schmücken weiters
zahlreiche, im Barock sehr beliebte Embleme. Die auf 1767 datierten
Bücherschränke mit Schnitzereien in den Stiftsfarben Gold-Blau schufen
Vorauer Tischler.

Bemerkenswert sind außerdem der Himmels- und Erdglobus des
italienischen Globenmachers Vinzenzo Coronelli (* 1650) aus dem Jahr
1688 sowie die beiden parabolisch ausgehöhlten Schallmuscheln, die
leises Flüstern auf der gegenüberliegenden Seite hörbar machen.

Das „Denkmal des Lesens" wurde in zweitägigen Workshops über einen
Zeitraum von sechs Jahren (2003-2008) von Studenten und Studentinnen
des Studienganges „Produktionstechnik und Organisation" der
Fachhochschule FH JOANNEUM mit dem Studiengangsleiter Johannes Haas
umgesetzt. Im stimmungsvollen inspirierenden Ambiente von Stift,
Bibliothek und Wirtschaftshof erarbeiteten die angehenden Techniker und
Technikerinnen mit teilweise selbst mitgebrachten Steinrohlingen aus
ganz Österreich kraftvolle Steinskulpturen. Das Material Stein,
gespeicherte Information über Jahrmillionen, erscheint als besonders
geeignet für die aus der Vorstellungskraft gestalteten Bücher. So
entstand in einer Zeit des Umbruches durch elektronische Medien ein
„Denkmal des Lesens", gesetzt am „Welttag des Buches", am 23. April
2009. Die Künstler und Lehrbeauftragten Anne & Peter Knoll zeichnen
für Idee & Konzept, Durchführung der Workshops und die Errichtung
dieses Denkmals verantwortlich.

Die unmittelbar dem Stift vorgelagerte Friedhofskirche zum hl. Johannes unter den Linden ist nicht nur die älteste Kirche der Pfarre, sondern des Dekanates Vorau. Vermutlich wurde sie bald nach der Stiftsgründung (1163) als vorübergehende Ausweichmöglichkeit für die Zeit während der Errichtung der dreischiffigen romanischen Stiftskirche erbaut. Ihren romanischen Ursprung dokumentierte das anlässlich der Renovierung im Jahr 1987 sichtbar gewordene romanische Mauerwerk, sowie die nun freigelegten Trichterfenster.

Die älteste schriftliche Notiz zur Johanneskirche bringt die
Stiftschronik, nach der Propst Bernhard III. (1267-1282) während seiner
Regierungszeit am Chor der Stiftskirche ein Fenster in Richtung der
Johanneskirche anbringen ließ. Im 14. Jh. hat man eine Abänderung an
der baulichen Substanz und die Ausstattung des Chorraumes und des
Torbogens mit gotischen Wandmalereien vorgenommen; Reste davon sind
noch erhalten. Die Einweihung des Friedhofes nahm Bischof Petrus von
Wr. Neustadt 1488 vor.

Die jetzige Kirche ist das Ergebnis eines im 17. Jh. durchgeführten
Umbaues und weist starke Parallelen zur Kreuzkirche (auf der Kring)
auf. In der Johanneskirche werden seit 1800 alle Chorherren und
Pröpste des Augustiner-Chorherrenstiftes Vorau bestattet. Vorher wurden
die Pröpste in der Stiftskirche beigesetzt.

Rückseite der Johanneskirche am Friedhof in Vorau

Kirche und Stift Panorama

Wem der viele Text zu lange war und lieber Bewegtbilder mit Musik mag,
kann sich gerne dieses Video antun: