web steiner
Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen
Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.
+43/2624/54014 - office@websteiner.com
Wallfahrtskirche Maria Straßengel
Mariä Namen, Mai 2023
Maria Straßengel zählt zu den bedeutendsten Kirchenbauten der österreichischen Hochgotik und ist in seiner Architektur unter anderem vom Wiener Stephansdom inspiriert. Die Scheiben der Kirchenfenster bilden zudem die größte Ansammlung mittelalterlicher Glasmalereien in der Steiermark.

Die Wallfahrtskirche Maria Straßengel ist eine denkmalgeschützte
römisch-katholische Expositur- und Wallfahrtskirche in der zur
Marktgemeinde Gratwein-Straßengel gehörenden Ortschaft
Judendorf-Straßengel in der Steiermark. Die auf Mariä Namen geweihte
Kirche gehört zum Seelsorgeraum Rein der Region Steiermark Mitte in der
Diözese Graz-Seckau.

Wegmarken des Glaubens - Christusweg „Weg des Lebens“
Zur Einstimmung der Wallfahrer vor Betreten des Marienheiligtums am
Berg wurden ost- und westseitig, vermutlich um die Mitte des 18.
Jahrhunderts, insgesamt neun Pfeilerbildstöcke errichtet. Um 1970
plante man unter dem damaligen Seelsorger P. Dionys Pils eine höchst
notwendige grundlegende Restaurierung der Bildstöcke. Dabei wurde eine
Neugestaltung des gesamten Kreuzweges ins Auge gefasst. Über die
übliche Gestaltung eines Kreuzweges hinaus, sollte ein „Weg des Lebens"
entstehen. Mit der Gestaltung wurde der Straßengler Künstler Gottfried
Johannes Höfler beauftragt. Er schuf insgesamt 49 Sandsteinreliefs und
spannte mit den Darstellungen einen Bogen durch die Heilsgeschichte von
der Erschaffung der Welt bis zur Auferstehung.
Gottfried Johannes Höfler (1934-2005) war in Straßengel wohnhaft und
schuf als bildender Künstler nicht nur zahlreiche Kunstwerke, sondern
zeichnete auch für wichtige Um- und Neugestaltungen sakraler und
öffentlicher Räume verantwortlich. Die Arbeiten an den Kreuzwegbildern
waren Ende 1974 fertiggestellt.

Wegmarken des Glaubens - Christusweg „Weg des Lebens"
Bildstock der Sünde (Sandsteinreliefs von Gottfried Höfler 1934 - 2005)
... und wirft ihn in den Abgrund
Schlange - Symbol des Bösen
Hand, die nach der verbotenen Frucht greift
Brudermord - Kain erschlägt Abel

Wegmarken des Glaubens - Christusweg „Weg des Lebens"
Bildstock der Erwartung und des Glaubens (Sandsteinreliefs von Gottfried Höfler 1934 - 2005)
Maria mit dem Fuß auf der Schlange - Sieg über das Böse
Maria tritt durch Empfängnis „aus ihrem Lebenskreis"
Jesus, als er im Tempel zum ersten Mal auftrat
Jesus auf Mariens Knien nach der Kreuzabnahme

Wegmarken des Glaubens - Christusweg „Weg des Lebens"
Bildstock der Evangelisten (Sandsteinreliefs von Gottfried Höfler 1934-2005)
Matthäus - Antlitz des Sehers
Johannes - Adlerbild
Markus - Löwe
Lukas - Stier

Wegmarken des Glaubens - Christusweg „Weg des Lebens"
Bildstock der Hände (Sandsteinreliefs von Gottfried Höfler 1934 - 2005)
Pilatus wäscht seine Hände in Unschuld
Jesu Hände werden ans Kreuz genagelt
Hände drücken Jesus die Dornenkrone aufs Haupt
Aus der Hand sind die Würfel gefallen

Wegmarken des Glaubens - Christusweg „Weg des Lebens"
Bildstock der Erfüllung (Sandsteinreliefs von Gottfried Höfler 1934-2005)
Obere Reihe: Abendmahl, Ölbergszene, Verrat des Judas, Verspottung Jesu
Untere Reihe: Kreuztragen, Kreuzigung, Auferstehung, Szene mit dem „ungläubigen" Thomas

Relief am Wasserbehälter - Gottfried Höfler (1934-2005) Straßengler Künstler
Viertel rechts oben: Aufgehende Sonne über dem Meer, „Es werde Licht"
und Bedeutung des Wassers und der Sonne für das irdische Leben
Viertel rechts unten: Baum als Sinnbild für die Natur
Viertel links unten: Mensch als Krone der Schöpfung, weist mit einem Arm über seinen Lebenskreis hinaus
Viertel links oben: Streben nach Göttlichkeit. Die Endlichkeit des Strebens ist begrenzt, symbolisiert durch die Sanduhr.

1757 wurde der Torbogen
anlässlich der 600 Jahr-Feier mit einem Fresko für die Wallfahrer aus
Nah und Fern versehen. Den Pilgern wurde die Legende des wundertätigen
Wurzelkreuzes dadurch bildlich nähergebracht. Der Torbogen war
ursprünglich mit Ornamenten und Voluten (schneckenförmige Verzierungen)
reich bemalt, und stellte seit jeher einen Blickfang für die
ankommenden Wallfahrer dar. Im Laufe der Jahrhunderte mussten, bedingt
durch die Witterungseinflüsse, immer wieder Renovierungsarbeiten
vorgenommen werden. Dadurch wurde auch das unansehnlich gewordene Bild
mit einer Putzschicht überzogen, und darauf die Legende neu gemalt. Am
rechten Bildrand ist noch ein kleines Stück eines früheren Freskos (vor
1757) ersichtlich. Es sind noch Ansätze einer Bischofsmütze und zweier
Bischofsstäbe zu erkennen.

Das restaurierte Bild
Die Madonna zu Füßen des legendären Tannenbaumes, darüber das
Wurzelkreuz (das durch das Verhalten der Rinder von den Hirten gefunden
wurde), den heiligen Geist und Gottvater. Links und rechts in den
Wolken befindet sich der heilige Benedikt von Nursia und der heilige
Bernhard von Clairvaux. Die beschädigte Stützmauer auf der linken Seite
wurde zurückgesetzt, und dadurch konnte die zweite Schießscharte
freigelegt werden. Durch diese aufwändigen Arbeiten konnte der
wehrhafte Charakter des Torbogens wieder voll zur Geltung gebracht
werden. Auf Initiative von Pfarrer P. Paulus Baumann fand die
Restaurierung im Jahre 2002 von Brunhilde Meder statt. Die Finanzierung
erfolgte, mit Spenden zum 25-jährigen Priesterjubiläum.

Die „tönenden Engel" von Straßengel - Die drei Engel an der Kirchhofsmauer sind Teil des originalen Ensembles der Turmfiguren des 1366 vollendeten gotischen Turms.
Auf dem Turm stehen über den hohen Maßwerkfenstern acht lebensgroße
Figuren - sieben Engel und die Gottesmutter Maria. Drei dieser
Engel sind durch Kopien ersetzt worden. Ihre Originale sind jetzt an
der Kirchhofsmauer aufgestellt. Ein Engel hält ein Spruchband, ein
anderer ein geöffnetes Buch. Der dritte Engel scheint eine Posaune vor
der Brust zu halten. Auf dem Turm gibt es noch zwei weitere Engel, die
ein Blasinstrument hielten, dazu einen Engel mit Spruchband und einen
Engel mit vor der Brust gekreuzten Armen. Die ebenfalls durch eine
Kopie ersetzte edle gotische Marienstatue steht heute in der Kirche und
grüßt mit einem Segensgestus die Gläubigen beim Eintreten in die
Kirche. Einzigartig sind die berühmten ehemals „tönenden Engel" mit
ihren Blasinstrumenten. Der auf dem Berg allgegenwärtige Wind brachte
durch eine Spezialvorrichtung diese Engel zum Tönen. Die Engel am Turm
von Straßengel gemahnen an das Jüngste Gericht und rufen die Pilger zur
inneren Umkehr auf. Die „tönenden Engel" sind als deutliche Warnung zu
verstehen: Engel blasen die Posaunen des Gerichts.

Wallfahrtskirche Maria Straßengel
1346-1366 Bau der gotischen Kirche
1455 Baubeginn der ca. 120 m langen Wehranlage zum Schutz vor Osmanengefahr
Spätgotisches Kirchhoftor, Glockenturm, Erweiterungen in der Barockzeit
1494 Bau des ehemaligen Propsteigebäudes, heute Pfarrhof
1582 Errichtung der Taverne („Kaisergebäu"), 1673 Nächtigung Kaiser Leopolds I.
17. Jh. Bau des „Prälatenhauses" (ehem. Neugebäude) mit spätgotischem Baukern
Seit 2007 „Steirisches Wahrzeichen"
1788 Entweihung und Abriss angedroht, 1789 abgewendet

Die beiden Portale und ihre Tympanareliefs
Zwei Spitzbogenportale mit profiliertem Gewände und hohen Fialen führen
in das Innere; ihre Tympanareliefs zählen zu den bedeutendsten
Leistungen der Reliefkunst des 14. Jahrhunderts in Österreich.
Das Tympanonrelief des Südportals, das ebenfalls vom Meister des
Verkündigungsreliefs stammt, zeigt in einer ergreifenden Schilderung
die „Beweinung Christi" nach der Kreuzabnahme, wobei die
Beweinungsszene mit dem Andachtsbild der Marienklage verbunden ist:
Maria sitzt auf einer Bank und drückt in tiefem Schmerz mit beiden
Händen den von der Todesstarre geprägten Körper ihres Sohnes an sich,
während der kniende Joseph von Arimathia mit einem Tuch die Füße
Christi vom Todesschweiß zu trocknen scheint; unter dem gegabelten
Astkreuz - es ist dies ein Symbol des Lebensbaumes - stehen Johannes
der Evangelist, Maria Salome und Maria Magdalena.
Beweinung Christi
Nach der Kreuzabnahme umarmt Maria den Körper ihres geliebten Sohnes.
Joseph von Arimathia trocknet die Füße Jesu. Unter dem Astkreuz als
Symbol des Lebensbaumes stehen als Begleiter Jesu der Evangelist
Johannes, Maria Magdalena und Maria Salome. Darüber schweben drei Engel
als trauernde Gottesboten: Der rechte weist mit dem aufgeschlagenen
Buch auf die Erfüllung der Heiligen Schrift; das Weihrauchgefäß in
seiner rechten Hand ist, wie der Rauchbehälter des linken Engels, ein
Sinnbild des Opfers und Gebetes. Von erschütternder Ausdruckskraft ist
der dritte Engel, der sein Antlitz weinend mit einem Tuch verhüllt. Der
Totenschädel und die Gebeine vor dem Kreuzesstamm charakterisieren
Golgatha.
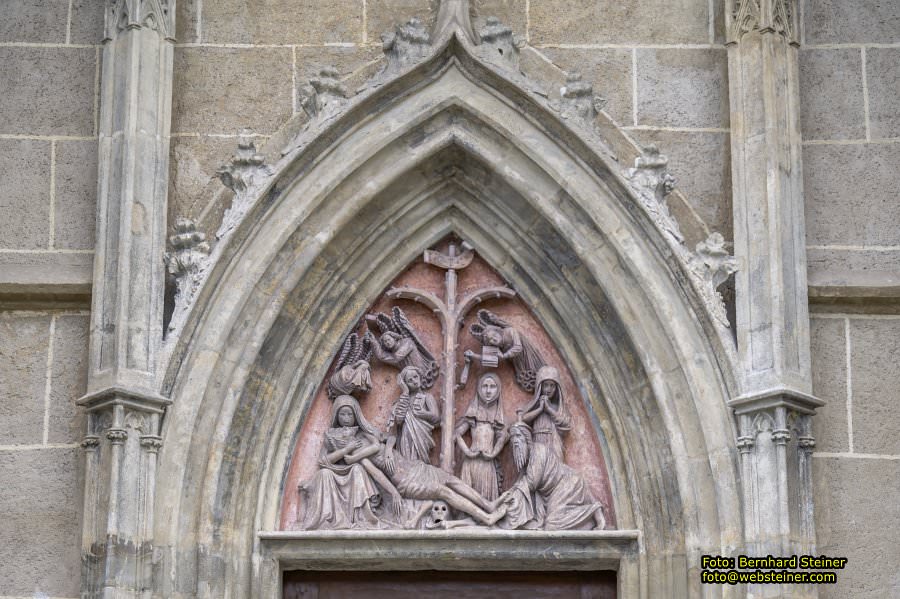
Der quadratische Querschnitt der Kirche zeigt einen Hallenraum, wobei
das Mittelschiff gegenüber den Seitenschiffgewölben - wie in St.
Stephan in Wien - leicht überhöht ist. Die Höhe des Mittelschiffs
beträgt wie die des Dachstuhls 13,80 Meter, die Höhe der Pfeiler 9,12
Meter. Die Kirche weist im Mittelschiff eine Länge von 28 Metern und in
den Seitenschiffen von 23,70 Metern auf; die Breite beträgt 12,60 Meter
(Innenmaße). Den schmalen, aus vier hochrechteckigen Jochen gebildeten
Seitenschiffen und dem breiteren, fünfjochigen Mittelschiff sind Chöre
im 5/8-Schluss vorgesetzt, wodurch eine gestaffelte Chorpartie entsteht.
Diese Grundrisslösung mit drei polygonalen Apsiden, die Jochbildung und
der gestaffelte Aufriss folgen dem Chor der Wiener Stephanskirche
(1304/40). Die Last des Gewölbes mit den birnstabprofilierten
Kreuzrippen wird im Mittelschiff auf vier kantonierte Pfeilerpaare, in
den Seitenschiffen auf hochsitzende Konsolen und in den Chören auf
Runddienste geleitet. Verstärkte Scheidbögen betonen die Trennung der
Kirchenschiffe.
Die Bauplastik und ihre Motive: Die Kapitelle zeigen verschiedene
Blattformen. Auch die Schlusssteine im Scheitel der Gewölberippen und
die Wandkonsolen weisen analoge naturalistische Blattgestaltungen auf,
wie Weinlaub, Efeublätter und Feigenlaub.

Chor und Langhaus werden an der Ost- und Südseite durch
Spitzbogenfenster belichtet; an der Nordwand wurden anläßlich der
letzten Restaurierung die Fensterlaibungen des 3. und 4. Joches - das
westliche mit originalem Maßwerk und ergänzten Pfosten - freigelegt,
wodurch der ursprüngliche Charakter des Innenraumes spürbarer wird. Zu
den hochgotischen Architekturformen kontrastieren die rundbogigen
Arkadenreihen an den beiden Langhauswänden. Sie dienten als
Akzentuierung ehemaliger Sitznischen für die Zisterziensermönche von
Stift Rein. Die Empore geht in der vorliegenden Gestaltung auf das 15.
Jahrhundert zurück. Vermutlich errichtete sich hier Kaiser Friedrich
III. im Jahr 1455 gleichzeitig mit dem Kapellenanbau eine Art
Herrschaftsempore; dabei wurden die hochgotische Empore mit einem
Gratgewölbe unterfangen und die beiden die Empore berührenden
Bündelpfeiler mit Arkadenbögen massiv verstärkt. Gleichzeitig
vergrößerte man das Hauptportal und errichtete das profilierte
Flachbogentor zur Empore.
Von der ursprünglichen Einrichtung aus der Bauzeit hat sich außer den
Glasgemälden und dem Wurzelkreuz nichts mehr erhalten. Die bestehende
Ausstattung wird vor allem bestimmt durch die mystisch-transzendente
Licht- und Farbwirkung der Glasgemälde und durch die spätbarocken
Einrichtungsgegenstände, wie Kanzel, Altar- und Kreuzwegbilder, und die
einheitliche Spätbarockausstattung der Annakapelle, zu denen die
neugotischen Altaraufbauten kontrastieren.
Besonders bemerkenswert sind die Glasgemälde
der Chor- und Südfenster mit dem größten zusammenhängenden Bestand
mittelalterlicher Glasmalereien in der Steiermark. 147 Rechteckscheiben
und Maßwerkfelder sind hier an ihrem ursprünglichen Bestimmungsort
erhalten geblieben. 25 Scheiben befinden sich in in- und ausländischen
Museen. Der heutige Bestand der Straßengler Glasgemälde ist jedoch nur
der Rest einer weit umfangreicheren Verglasung; ebenso wie der Chor,
waren auch das Langhaus und die Fensterrose mit farbigen Bildfenstern
aus der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts ausgestattet. In den Jahren
1884/1885 erfolgte eine Restaurierung, Ergänzung und Neuordnung durch
die Tiroler Glasmalereianstalt NEUHAUSER aus Innsbruck, auf die die
vorhandene ikonographische Anordnung zurückgeht. Zuletzt wurden die
Glasfenster in den Jahren 1972 bis 1978 in den Werkstätten des
Bundesdenkmalamtes restauriert und gleichzeitig, zum Schutz gegen
Korrosion und Verwitterung, eine Außenschutzverglasung angebracht. Als
Programm kann man Szenen aus dem Alten Testament, marianische und
christologische Themen, Darstellungen der Erzengel und Evangelisten
sowie Apostel-, Propheten- und Heiligenserien rekonstruieren.

Die jetzige, 1995 vom Orgelbaumeister MARTIN PFLÜGER aus Feldkirch
(Vorarlberg) erbaute Orgel mit einem in die Emporenbrüstung eingefügten
Rückpositiv besitzt 30 Register auf 3 Manualen und Pedal. Es ist eine
rein mechanische Orgel mit 1868 Pfeifen aus Metall und Holz.
Die vierzehn Kreuzwegbilder (1775) wurden 1979 von der obersteirischen Pfarr-und Wallfahrtskirche Kumitzberg erworben.

Die neben der Schmerzhaften-Muttergottes-Kapelle gelegene Annakapelle
ist ein rechteckiger Raum mit Kuppelgewölbe und Laterne, der von
Rechteckfenstern und einem ovalen Fenster belichtet wird und sich mit
einer Korbbogenarkade zum Langhaus öffnet. Da in Straßengel bereits
1667 eine Anna-Bruderschaft gegründet wurde, ist die Errichtung der
Kapelle zumindest im vierten Viertel des 17. Jahrhunderts anzunehmen.
Bemerkenswert ist die einheitliche Barockeinrichtung: An den Pfeilern
der Eingangswand sind zwei leuchterhaltende Engel auf Konsolen mit der
Inschrift „Bruederschafft 16"/„S. Anna 67" postiert, die auf das
Gründungsjahr verweisen und von der ursprünglichen Ausstattung der
Annakapelle stammen.

Das Ölbild des Johannes-Nepomuk-Altares im Südchor stellt den hl.
Johannes von Nepomuk im Gebet vor der Muttergottes von Altbunzlau dar,
zu der er vor seinem Tod wallfahrtete, um ihr seine Sterbestunde
anzuempfehlen. Der Kleriker der Prager Diözese, der 1393 sein Martyrium
durch Ertränkung in der Moldau erlitt, wurde insbesondere als Bewahrer
des Beichtgeheimnisses und als Brücken- und Wegeheiliger verehrt.

Die dem Grazer Bildhauer JAKOB PEYER Zugeschriebene Kanzel wurde
ebenfalls anläßlich der Neuausstattung von 1779/1781 errichtet. Auf
dem Schalldach wird durch die Darstellung des Wurzelkreuzes auf eine
der beiden Straßengler Gründungslegenden hingewiesen.

Die drei spätbarocken Altäre wurden 1884/85 durch neue Retabel im
neugotischen Stil ersetzt, deren Entwürfe vom Grazer Architekten ROBERT
MIKOVICS stammen. Der aus Marmor von der Steinmetzanstalt GREIN
ausgeführte Hochaltar enthält im Auszug eine Kopie des spätgotischen
Mariengnadenbildes mit der Darstellung der „Maria im Ährenkleid".
Das um 1420/1425 gemalte Tafelbild wurde 1976 gestohlen und ist 1978
durch eine von GOTTFRIED HÖFLER gemalte Kopie ersetzt worden.
Ährenkleid-Madonna
Die Darstellung der „Maria im Ährenkleid", die Maria als jugendliche
Tempeljungfrau mit dunkelblauem, mit goldenen Ähren verzierten Kleid
wiedergibt, wurzelt in der theologischen Auffassung, dass Maria die
Gnadenähre ist, die den Weizen Christi gibt und ihn in der Eucharistie
darstellt. Nach Überlieferung der Apokryphen weilte Maria als Kind im
Tempel von Jerusalem, wo sie Gott in tugendhafter Weise als
Tempeljungfrau diente. Der Legende nach strickten die Tempeljungfrauen
das Ährenkleid für Maria. Das im 15. Jahrhundert häufig dargestellte
Thema geht zurück auf das ehemalige Gnadenbild im Dom von Mailand, eine
von deutschen Handelsleuten im 14. Jahrhundert gestiftete Silberstatue.
Maria im Ährenkleid nimmt möglicherweise auch Bezug zu den Worten im
Hohenlied (HL 7, 3), mit denen sich der Bräutigam (Christus) an seine
Braut (Kirche) wendet: „Dein Leib ist ein Weizenhügel mit Lilien
umstellt". Die Ähren wurden im Mittelalter als Anspielung auf die
Eucharistie verstanden, das Weizenkorn galt als Symbol Christi.

Die beiden neugotischen Holzretabel in den Nebenchören enthalten als
Reste der spätbarocken Seitenaltäre deren Mensen und die Altarblätter
(1781) von MARTIN JOHANN SCHMIDT („Kremser Schmidt").
Das Ölgemälde des Sebastian-Altares im Nordchor zeigt die Pflege des
römischen Märtyrers aus der diokletianischen Christenverfolgung nach
seiner erlittenen Durchpfeilung, wobei die hl. Irene von Rom die Pfeile
aus seinem Körper zieht. Der Heilige galt seit dem 7. Jahrhundert als
Pestpatron für Mensch und Tier.

Der Anna-Altar wurde 1723 unter
Abt Placidus Mally aufgestellt; die Stuckmarmorierarbeiten fertigte
JOHANN CHRISTOPH CRASSBERGER aus Graz an. Im Zentrum befindet sich das
plastische Bildwerk der Anna selbdritt; es ist dies eine
ikonographische Darstellung, in der die hl. Anna ihre Tochter Maria und
das Jesuskind auf ihren Armen hält. Als Seitenfiguren fungieren der hl.
Joachim, der Gemahl Annas, mit Hirtenschippe und zwei Opfertauben und
der hl. Joseph, der Gatte Mariens. Offensichtlich ist im Rahmen der
Neuausstattung von 1779/81 auch der Anna-Altar „modernisiert" worden
und erhielt vermutlich von JAKOB PEYER die Anna-selbdritt-Gruppe, den
dekorativen Baldachin und den Tabernakelaufbau mit Reliquienpartikeln
der Heiligen Felicissimus, Gangolph, Irenäus, Marcian, Placidus,
Quirinus, Stephanus, Theodorich und Theresia.

Das Gewölbefresko ist aus stilistischen Gründen dem ab 1738 im Stift
Rein tätigen Trientiner Maler JOSEPH AMONTE (gest. 1753) zuzuschreiben.
Das um 1750 gemalte Fresko zeigt die figurenreiche Wiedergabe der
„Heiligen Sippe"
(die große Familie Christi und Mariens), die auf die
apokryphe Erzählung von der dreimaligen Heirat der Mutter Anna, der
sogenannten Trinubiumslegende, zurückgeht. Diese Darstellung aller
Personen aus der „Dreiheirat" Annas ist insofern ikonographisch
bemerkenswert, da die Trinubiumslegende durch das Konzil von Trient
(1543/1563) verboten wurde. Das Straßengler Fresko ist somit eines der
spätesten Zeugnisse dieses volkstümlich beliebten Bildmotivs.
Das Deckenfresko der Annakapelle zeigt die große Familie Christi und
Mariens, die auf die apokryphe Erzählung (sog. Trinubiumslegende) von
der dreimaligen Heirat der heiligen Anna, der Mutter Mariens, zurück
geht. So sind auf den besonders im 15./16. Jh. beliebten Darstellungen
der Hl. Sippe neben Maria und ihren Eltern Anna und Joachim meist auch
die beiden anderen Männer der hl. Anna, Kleophas und Salomas,
wiedergegeben, bisweilen auch die Töchter, Schwiegersöhne und
Enkelkinder Annas. Ihre Töchter waren Maria, die Mutter Jesu, sowie
Maria Kleophas (Cleophae) und Maria Salome. Die drei Frauen werden
vielfach als die „drei Marien" bezeichnet (Frauen am Grabe).

Von JOSEPH AMONTE stammt auch das große Ölgemälde (um 1752), das die
Überbringung des ersten Gnadenbildes durch Markgraf Otakar III. im Jahr
1157 zeigt.

Von der Ausstattung sind weiters zu nennen ein 1757 hier aufgestellter,
spätbarocker verglaster Schrein mit den Gebeinen eines unbekannten
Märtyrers, ein spätbarockes Gestühl und Votivbilder aus dem 19.
Jahrhundert.
An der Westwand steht ein im dritten Viertel des 18. Jahrhunderts aus
Holz geschnitzter und verglaster spätbarocker Reliquienschrein. In
diesem Schrein ruhen seit dem 12. April 1757 die 1753 aus Rom hierher
überbrachten sterblichen Überreste eines unbekannten Märtyrers, dem der
Name Bonifatius gegeben wurde. Im Volksmund, aber auch laut einer
Inschrift am Schrein werden die Gebeine fälschlicherweise als jene des
heiligen Bonifatius von Tarsus angesehen.

Schmerzhafte-Muttergottes-Kapelle
Der kleine tonnengewölbte Raum ist zum Langhaus rundbogig geöffnet und
wird von einem schmalen Fenster belichtet. Durch das Tonnengewölbe
wurde die Kapelle irrigerweise mit dem romanischen Vorgängerbau in
Verbindung gebracht. Anläßlich der letzten Restaurierung konnte jedoch
nachgewiesen werden, dass der gesamte Anbau „in einem Guß" erfolgte.
Vermutlich wurde im 17. Jahrhundert dieser Raum zum Heiligen Grab
umfunktioniert, auf das auch das um 1740/1750 gemalte
Auferstehungsfresko (2011 restauriert) - der auferstandene Christus mit
der Siegesfahne und Grabwächter - an der Eingangswand Bezug nimmt.

Der Mater-dolorosa-Altar (3. Viertel 17. Jahrhundert) zeigt als
Altarbild eine Pietà. Zwei Engel, die ehemals Weihrauchbehälter
hielten, als Seitenfiguren und eine Kreuzgruppe im Aufsatz bilden das
Figurenensemble. Die Knorpelwerkkartusche am Gebälk enthält die
Jahreszahl „1850" als Restaurierungshinweis. Erwähnenswert ist die
neugotische Herz-Jesu-Statue.

Der nach einem Entwurf von ROBERT MIKOVIcs verfertigte neugotische
Marmor-Taufstein mit der Schnitzfigur des hl. Johannes des Täufers
stammt aus dem Stift Rein.

Das Tympanonrelief des Westportals
zeigt die Darstellung der „Verkündigung an Maria". Maria kniet in einem
„Raum", der durch einen mittels Fialen gerahmten Kielbogen, durch ein
Betpult, eine Vase und ein Bücherkästchen angedeutet ist. Die
ungewöhnlich großen Flügel des Erzengels Gabriel füllen den linken
Bildteil, das S-förmige Spruchband verbindet die beiden Reliefhälften.
Symbolische Hinweise bereichern die Szene. Die Siebenzahl der Bücher
kennzeichnet Maria „als Meisterin in allen sieben freien Künsten" und
als Besitzerin der sieben Gaben des Heiligen Geistes; die heilige
Siebenzahl tritt auch in zweimaliger Anordnung am Maßwerkfries oberhalb
des Türsturzes auf. Die Lilie in der Vase verweist wie das Tuch auf dem
Betpult auf die Reinheit und die Jungfräulichkeit Mariens.
Verkündigung an Maria
Die als königliche Braut gekrönte Jungfrau kniet vor dem Betpult mit
dem aufgeschlagenen Psalter. Sie empfängt zugleich mit der Botschaft
des Engels den Heiligen Geist und das Jesuskind, das aus dem Mund
Gottvaters herabgesendet wird; diese Darstellung symbolisiert
eindrucksvoll die Stelle der Heiligen Schrift, „Und das Wort (Gottes)
ist Fleisch geworden..." (Joh 1,14).

Die Wallfahrtskirche Maria Straßengel ist eine Hochleistung gotischer
Sakralarchitektur in Österreich. In der Konzeption des Hallenraumes und
der gestaffelten Chorpartie wurden Baugedanken aufgegriffen, die sowohl
in den Hallenkirchen der Zisterzienser als auch in der Albertinischen
Choranlage von St. Stephan in Wien vorliegen. Ein Anschluss an die
Wiener Bauhütte ist auch in der Gestaltung des durchbrochenen
Turmhelmes, in den vielfältigen Maßwerkformen und in den von der
„Herzogswerkstätte" beeinflussten Glasgemälden gegeben.
Das vielschichtige bauplastische Programm wurde im Zisterzienserstift
Rein entwickelt und ist eine Dokumentation des sakralen und imperialen
Wirkens dieses Klosters. Bedeutende Ereignisse in der wechselvollen
Geschichte der Steiermark stehen in Verbindung mit diesem Stift und der
Wallfahrtskirche: Der Traungauer Markgraf Leopold I. berief 1129 die
ersten Zisterzienser hierher, 1157 gründete sein Sohn Markgraf Otakar
III. zusammen mit dem Kloster die Gnadenstätte Maria Straßengel, und
1276 trugen steirische Adelige im „Reiner Schwur" entscheidend zur
politischen Konsolidierung Rudolfs I. von Habsburg in der Steiermark
bei. Die enge Bindung des Hauses Habsburg an das Stift Rein und an
Straßengel zeigt sich in Bestätigungen von Reiner Privilegien und in
Stiftungen für die Wallfahrtskirche durch Herzog Rudolf IV. und weiters
in der Wahl der Reiner Stiftskirche als Grablege Herzog Ernsts des
Eisernen von Innerösterreich. Auch sein Sohn, Kaiser Friedrich III.,
folgte dieser Tradition und errichtete in der Straßengler
Wallfahrtskirche eine Kapelle und eine „Herrschaftsempore".

Im Kirchhof befinden sich ein von ALFRED SCHLOSSER gemeißelter
Kunststeinbrunnen mit der Reliefdarstellung der „Ährenkleidmadonna" und
eine von der Marktgemeinde Judendorf-Straßengel errichtete Stele zur
Erinnerung an den 1789 verhinderten Abbruch der Wallfahrtskirche.
DEN MUTIGEN BÜRGERN DIE VOR 200 JAHREN 1788 DEN ABBRUCH DER KIRCHE VERHINDERT HABEN
GEWIDMET VON DER MARKTGEMEINDE JUDENDORF-STRASSENGEL

Die Wehranlage, unter Abt
Molitor um 1455 errichtet, gehört mit ihrer Längenausdehnung von über
120 Metern zu den größten ihrer Art in Österreich. Die 4,5 Meter hohe
Ummauerung des Vorkirchhofes wird von Schlüsselschießscharten
durchbrochen. Das spätgotische Kirchhoftor mit seitlichen
Schießscharten weist eine Freskomalerei mit Darstellungen des
Wurzelkreuzes, der Ährenkleidmadonna, der Heiligen Benedikt und
Bernhard und des Reiner Stiftswappens aus dem Jahr 1757 (restauriert
2002 von BRUNDHILDE MEDER).

Beginn der Wallfahrt
Die erste archivalische Nennung einer Kapelle in Straßengel findet sich
in einer Urkunde aus dem Jahr 1208 des Erzbischofs Eberhard II. von
Salzburg. Die Anfänge der Wallfahrten und das Bestehen einer Kapelle
kann jedoch mit Sicherheit bereits um die Mitte des 12. Jahrhunderts
angenommen werden. Nach der Legende schenkte Markgraf Otakar III. im
Jahr 1157 dem Kloster Rein ein Marienbild, das er von der „heiligen
Wallfahrt aus Palästina" mitbrachte, mit der Auflage, das Bild in
Straßengel zur öffentlichen Verehrung aufzustellen.
Das Stift Rein betrachtet das Jahr 1158 als Gründungsjahr und feierte
im Jahr 1858 das siebenhundertjährige Jubiläum der Stiftung. Da jedoch
der Typus des originalen, um 1420/1425 gemalten Mariengnadenbildes -
eine „Maria-im-Ährenkleid"-Darstellung - am Ende des 14. Jahrhunderts
ausgebildet wurde, lässt es sich nicht mit dem ersten Marienbild in
Verbindung bringen, das vermutlich zugrunde gegangen ist. Der zweite
Verehrungsgegenstand der Wallfahrtskirche ist ein im Jahr 1255
gefundenes kleines Wurzelkruzifix. Der Legende nach fanden es Hirten in
einer Tanne vor der Straßengler Kapelle. Das Kruzifix (Höhe 18,5 cm)
weist realistische Züge auf, die Haupt- und Barthaare sind aus zarten
Wurzelfasern gebildet. Pflanzenphysiologische Untersuchungen erbrachten
den Nachweis, dass am Kruzifix keine Einwirkungen eines Schnitzmessers
vorliegen. Das in einem silbernen Standkreuz gefasste Kruzifix wurde
1976 zusammen mit dem Mariengnadenbild gestohlen, konnte jedoch
unmittelbar danach wieder aufgefunden werden. Es wird vermutet, dass
die erste hölzerne Kapelle im 13. Jahrhundert vergrößert bzw. in Stein
neu erbaut wurde.

Die Wallfahrtskirche Maria Straßengel, die zu den bedeutendsten
Sakralbauten der Hochgotik in Österreich zählt, wurde weithin sichtbar
auf einem in das Gratweiner Becken vorspringenden Hügel errichtet.
Dieser auch Frauenkogel genannte Hügel zwischen Judendorf und
Straßengel diente vermutlich als Wehranlage für die ehemalige slawische
Bevölkerung. Für eine ursprüngliche slawische Besiedelung spricht auch
der Ortsname „Straßengel", das im Jahr 860 „strazinola" genannt wird,
was sich aus dem Slawischen „strazilna" (kleine Warte) oder „straza"
(Warte) ableitet. Die Gegend muss in dieser Zeit von großer Bedeutung
gewesen sein, da „zwei Örter" bei Straßengel in einem Majestätsbrief
König Ludwigs des Deutschen vom 20. November 860 angeführt sind. Über
Verfügung vom 8. Juni 1147 des Traungauer Markgrafen Otakar III. von
Steiermark, Sohn Leopolds des Starken, des Stifters des
Zisterzienserklosters Rein, und Sophie von Bayern, gelangte Straßengel
an das Kloster Rein.
