web steiner
Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen
Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.
+43/2624/54014 - office@websteiner.com
SÜDBAHN Museum
Mürzzuschlag, Juli 2024
Die Eisenbahnerlebniswelt am Weltkulturerbe
Semmeringbahn. Zwei Lokomotivhallen zeigen eine Ausstellung zur Südbahn
Wien–Triest und eine Fahrzeugsammlung. Highlights: k. u. k. Caféwaggon
und die älteste in Österreich erzeugte Dampflok "STEINBRÜCK". „Bitte
alle einsteigen! Zug fährt ab!“, heißt der Kinderweg des
SÜDBAHNMuseums. Ausgerüstet mit einem „Reiseführer“ und
Expeditionsrucksack können Kinder spielerisch mehr über die Südbahn
erfahren.
100 JAHRE SEMMERING BAHN 1854-1954
Dieses Flugrad, dessen Bewehrung aus Siederohren einer Dampflok besteht. wurde anläßlich des Jubiläums
100 Jahre Semmeringbahn von den Mürzzuschlager Eisenbahnern Karl Trnek
und Walter Partlic gestaltet. Im Jahr 1998 wurde dieses Denkmal
wiedererrichtet.

Das Südbahnmuseum Mürzzuschlag ist ein Eisenbahnmuseum in der
ehemaligen Zugförderung Mürzzuschlag der Österreichischen Bundesbahnen.
Es steht in der Heizhausgasse im Nordosten des Bahnhofs Mürzzuschlag in
der Stadtgemeinde Mürzzuschlag im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag in der
Steiermark. Träger des Museums ist der im Jahr 2003 gegründete Verein
Freunde der Südbahn. In zwei denkmalgeschützten Eisenbahnhallen
befindet sich das SÜDBAHN Museum Mürzzuschlag. Zum 150-Jahr-Jubiläum
der Semmeringbahn wurde am 10. Juni 2004 die erste Ausstellungshalle
des SÜDBAHN Museum eröffnet. Drei Jahre später, am 18. Juni 2007, wurde
der Ringlokschuppen als zusätzliche Ausstellungshalle eröffnet.

ÜBER DEN BERG
WIEN - MÜRZZUSCHLAG - TRIEST
13 STUNDEN 4 MINUTEN
Über den Berg bedeutet die Überschienung des Semmerings, die
Überwindung räumlicher Distanzen und natürlicher Barrieren. Es steht
auch dafür, Getrenntes zu verbinden oder eigene Grenzen zu erweitern,
neue Räume zu erschließen oder für die Sehnsucht, mit der „weiten Welt"
in Berührung zu kommen. Wien - Mürzzuschlag - Triest meint die
Verbindung geographischer Räume und vor allem die Möglichkeiten,
Menschen und deren Lebens(t)räume kennen zu lemen, fremden und anderen
Lebenswelten mit Neugier und Interesse zu begegnen - kurz: den
Austausch geistiger und materieller Welten.
13 Stunden 4 Minuten - etwas mehr als ein halber Tag - soll auf die
Beschleunigung des Reisens verweisen. Die schnelle Erreichbarkeit weit
entfernter Orte und Menschen bedeutet Verbindung, Begegnung und
Austausch durch Raum und Zeit zu festigen. Es erinnert auch daran, dass
die „Eisenbahnzeit" zur „Weltzeit" geworden ist. In Mürzzuschlag
beginnt eine spannende Reise durch die vielfättige Welt der Eisenbahn.
Als einer der ältesten Eisenbahnorte Österreichs, liegt Müzzuschlag an
einem zentralen Abschnitt der „Südbahn", der „Semmeringbahn", die seit
1998 als „UNESCO-Weltkulturerbe" zu den bedeutendsten Kulturschätzen
der Welt zählt. Der Bau der Bahn über den Berg war eine der aufsehen
erregendsten und aufwendigsten Eisenbahnprojekte des 19. Jahrhunderts.
Nirgendwo zuvor war etwas Vergleichbares realisiert worden Mit
Fertigstellung der „Südbahn" war jedoch nicht nur eine durchgehende
Eisenbahn-Verbindung zwischen der Residenzstadt Wien und Triest, dem
wichtigsten Hafen der Habsburgermonarchie, gegeben. Die „Südbahn" steht
symbolisch für die vielen Veränderungen, durch die das Eisenbahnwesen
das Leben der Menschen bis zum heutigen Tag nachhaltig beeinflusst hat,
aber auch für die Sehnsucht nach Reisen Ferne und den Weg in fremde
Länder. Es finden sich also mehrere Gründe, am Beispiel Mürzzuschlags
eine Entdeckungsreise durch die Geschichte der Eisenbahn zu beginnen.
VOM PFERD ZUM DAMPFROSS
Bis zur Domestikation des Pferdes im 4. vorchristlichen Jahrtausend ist
der Mensch bei der Überwindung von Entfernungen auf sich selbst
angewiesen. Erst mit Hilfe des Pferdes kann er größere Entfernungen in
vergleichsweise kurzer Zeit zurückzulegen. Die Schnelligkeit und
Ausdauer des Pferdes, seine Fähigkeiten als Reit- und Zugtier, als
Streitross, wie auch als Arbeitstier bestimmen über Jahrtausende die
Möglichkeiten des Menschen, sich in Zeit und Raum zu bewegen, seine
Lebensräume zu erschließen, zu organisieren und zu bewirtschaften. Das
bleibt so - bis im England des 18. Jahrhunderts die
„Pferde-Eisen-Bahnen" entstehen. Das Pferd bleibt aber nicht zentraler
Bestandteil dieses Transportwesens mit der Erfindung der
Dampflokomotive am Anfang des 19. Jahrhunderts ändert sich die
Situation. Der Mensch hat eine neue - aus damaliger Sicht revolutionäre
- Fortbewegungsmöglichkeit gefunden: Aus dem Pferd wird das „Dampfross". Das „Eisenbahnzeitalter" beginnt, und mit ihm eine neue Ära in der „Verkehrs-Geschichte" des Menschen.

Von der Spurrille über die „Eisen-Bahn" zur Dampflokomotive
Die Vorgeschichte des Elsenbahnwesens reicht welt in die Geschichte
zurück. Hinsichtlich der technischen Entwicklung sind dabel zwel
Faktoren von besonderer Bedeutung: dle Entwicklung der so genannten
„Rad-Schlene-Technik", das heißt, die optimals Abstimmung zwischen Rad
und Schiene sowie die Optimierung der Traktionstechnik. Erste Ansätze
zur Entwicklung einer Rad-Schlene-Technik zelgen sich bereits zur Zeit
der frühen Hochkulturen. Transportsysteme in Form von in die Straße
gehauenen, ebenflächigen Spurrillen, die von Fahrzeugen mit
gewöhnlichen Rädern befahren werden.
Die Anfänge der „Eisen-Bahn-Technologie" gehen auf das europäische
Bergwerkswesen des frühen 16. Jahrhunderts zurück. Perfektioniert wird
die Rad-Schlene-Technik selt der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts im
Bereich des englischen Bergbaus, wo die ersten Spurkranzräder und
(guss)eisernen Schienen zum Einsatz kommen. Damit ist jene „Eisen-Bahn"
geschaffen, die letztlich dem gesamten Verkehrsmittel seinen Namen
gibt. Richard Trevithick (1771-1833) baut die erste Dampflokomotive der
Welt (1803/04), George (1781-1848) und Robert (1803-1859) Stephenson
bauen mit der „Stockton-Darlington Rallway" (1825) und der
„Liverpool-Manchester Railway" (1830) die ersten dampfbetriebenen
Elsenbahnstrecken der Welt. Auch in der Habsburger-Monarchie werden die
ersten „Elsen-Bahnen" im Bereich des Berg- und Hüttenwesens gebaut. In
den Jahren 1809/10 errichtet Joseph Fortunat Sybold (1766-1844) auf dem
Erzberg eine Pferdeeisenbahn. Ungefähr gleichzeitig zwischen 1807 und
1809 konzipiert F.J. Gerstner zwischen Budweis/České Budějovice und
Katzbach bel Linz ebenfalls eine Pferdeeisenbahn. F.A. Gerstner kann
schließlich die „Vision" seines Vaters realisieren. Sein Schüler
Mathias Schönerer führt den Bau zu Ende. Mit einer Gesamtlänge von
196,7 km ist die so entstandene Eisenbahn die längste des europäischen
Festlands ihrer Zeit.
Carl Ritter von Ghega (* 10.
Jänner 1802 in Venedig; † 14. März 1860 in Wien) war ein
österreichischer Ingenieur und der Erbauer der Semmeringbahn von
Gloggnitz bis Mürzzuschlag. Der Baubeginn für die Semmeringbahn war
1848. Noch vor der Fertigstellung 1854 wurde der Ingenieur im Jahr 1851
in den Ritterstand erhoben.

SYMBOL FÜR DIE EISENBAHN - SYMBOL UNBESCHRÄNKTER MOBILITÄT
Das Flügelrad tritt bereits in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts
als Symbol für das Eisenbahnwesen in Erscheinung. In Österreich
schreibt eine Uniformierungsvorschrift den Bahnbediensteten die
Verwendung des Flügelrades auf Rockkrägen und Dienstmützen seit 1857
vor. Rad und Flügel stehen aber schon in den ältesten Mythologien
symbolisch für „Bewegung" und „Geschwindigkeit". In ihnen spiegelt sich
der Wunsch des Menschen, sich möglichst schnell durch Raum und Zeit zu
bewegen. Darstellungen geflügelter Räder finden sich im
assyrisch-babylonischen Raum bereits seit dem 2. vorchristlichen
Jahrtausend. In der christlichen Ikonographie taucht das Flügelrad in
Verbindung mit vier- bis sechsfach geflügelten Engelwesen auf, den
Cherubim und Seraphim. So beschreibt der Prophet Hesekiel (Ezechiel) in
einer Vision den von vier Cherubim getragenen Thron Gottes als
beweglichen Thronwagen mit Rädern, der an keinen Ort gebunden ist. Die
vier Cherubim ermöglichen Bewegungen in alle Richtungen, werden aber
vom Geist Gottes gelenkt. Diese Mobilität erlaubt es den Cherubim alles
wahrzunehmen, alles zu sehen, zu hören und letztlich mit dem Thron
Gottes überall gleichzeitig zu sein. Dabei sind sowohl die Räder als
auch der Leib und die Flügel der Cherubim mit einer Vielzahl von Augen
bedeckt.
Erzherzog Johanns (geboren in
Florenz/Firenze am 20. 1. 1782, gestorben in Graz am 11. 5. 1859)
Interesse am Eisenbahnbau dokumentiert sich besonders in einem Brief
aus dem Jahre 1825, in dem er die Vision einer internationalen
Eisenbahnlinie entwirft. Diese sollte von der Nord- und Ostsee über die
Donau-Monarchie bis nach Triest und von dort bis in den Nahen und
Fernen Osten, ja sogar bis nach Indien führen.
Weitaus „realistischer" waren seine Bemühungen um den Bau einer
Eisenbahnverbindung zwischen Wien und Triest/Trieste, die entlang der
Linie Wien-Semmering -Graz Marburg/Maribor-Laibach/Ljubljana
-Triest/Trieste verlaufen sollte. Nachdem Johann für dieses Projekt
auch das Interesse des Kaisers geweckt hatte, veranlaßte er in den
Jahren 1837-1839 zwischen Wiener Neustadt und Triest ausführliche
Trassierungsstudien, die sich schließlich als wertvolle Vorarbeiten zum
späteren Bau der „Südbahn" durch Carl Ritter von Ghega erwiesen.

Die Steinklopfer - Alltag am Bau der Semmeringbahn
Wer in früherer Zelt ...dle Bahn über
den Semmering... zum ersten Mal befahren hat, der wird, wenn der Zug
über schwindelerregende Viadukte donnert... Jene mit erhabenem Grauen
gemischte Bewunderung empfunden haben, die uns stets überkommt, wenn
wir etwas, das wir bisher für unmöglich gehalten, verwirklicht vor uns
sehen."
Ferdinand von Saar, Die Steinklopfer 1874
Zu Beginn des Jahres 1848 kommt es in ganz Europa zu Revolutionen.
Notstandsarbeiten sollen Ruhe in die aufgewühlte Menge bringen. Damit
ist endlich die Zeit für das Großprojekt „Semmeringbahn" - das schon
selt 1844 dem Ministerium vorliegt - gekommen. Der Plan Carl Ghegas,
über den Semmering eine Lokomotivbahn zu bauen, gilt als kühnes
Unterfangen. Besonders die praktische Umsetzung dieses Planes stellt
eine große Herausforderung dar. Nur an den Endpunkten Gloggnitz und
Mürzzuschlag und in Payerbach liegt die Bahntrasse direkt an bewohnten
Ortschaften, sonst führt sie durch praktisch unbesiedeltes Gebirgsland.
Noch gibt es keine Straßen, keine Unterkünfte, keine
Verpflegungsmöglichkeiten und keine ärztliche Versorgung. Und doch
sollen möglichst mehrere tausend Menschen gleichzeitig auf den
Baustellen arbeiten. Denn nur dadurch ist es möglich, und zwar in
reiner Handarbeit, dieses große Werk In sechs Jahren zu vollenden!

Ingenium und Institution - der Bahnbau am Semmering
Der Bahnbau am Semmering steht üblicherweise ganz im Zelchen der Person
Carl Ritter von Ghega. Ghega war jedoch in die staatliche Organisation
eingebunden und der Bahnbau selbst wurde von 14 erfahrenen Unternehmern
durchgeführt. Sowohl der Bau der großen Viadukte als auch der Tunnelbau
war in der damaligen, von Handarbeit geprägten Zeit eine immense
Herausforderung. Um die Bahn wirtschaftlich betreiben zu können, wurde
ein Lokomotivwettbewerb ausgeschrieben. Die daraus abgeleitete
Konstruktion, die Engerth-Lokomotive, leitete den Bau von
Gebirgslokomotiven ein.

Die Eisenbahn - treibende Kraft der „Industriellen Revolution"
Wohl kaum ein anderes Verkehrsmittel hat die Entwicklung von Industrie
und Handel nachhaltiger beeinflußt, als die Elsenbahn. Ihre
Schnelligkeit, Regelmäßigkeit und Berechenbarkeit sowie ihre Sicherheit
und die Möglichkeit, große Warenmengen verhältnismäßig billig zu
transportieren, hatten auch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in
der Habsburgermonarchie des 19. Jahrhunderts wesentlich verändert. Das
dichter werdende Schienennetz machte weit entfernte Gebiete
erreichbarer und führte zu einer Ausdehnung und Vernetzung der
Wirtschaftsräume. Mehr und mehr Konsumenten wurden mit Hilfe der
Eisenbahn Teil eines immer größer werdenden Marktes, in dem
Massenproduktion und Massenabsatz zu bestimmenden Faktoren wurden. Mit
Fertigstellung der „Kaiser-Ferdinands-Nordbahn" (1856) und der
„Südbahn" (1857) waren die Habsburger-monarchie und insbesondere der
„österreichische" Zentralraum an alle wichtigen europäischen
Wirtschaftsräume angeschlossen. Neben den gewohnten Gütern des
täglichen Bedarfs (Nahrungsmittel, Textillen etc.), wurden durch die
Elsenbahn auch ehemalige „Luxus-Güter", wie etwa Kaffee, Tee, Zucker,
oder Gewürze und vieles anderes mehr, allmählich zu Gegenständen des
Massenverbrauchs. Diese „Güter der Ferne" wurden vor allem von
Triest/Trieste - dem wichtigsten Hafen der Monarchle - über dle
„Südbahn" ins Zentrum der Monarchle transportiert. Besonders wichtig
war die Eisenbahn für die Entwicklung der Eisen- und Stahlindustrie.
Noch heute wird das Wirtschaftsleben vieler an der „Südbahn" gelegener
Orte und Regionen zwischen Triest und Wien durch die Elsen- und
Stahlindustrie geprägt. Schließlich wird der Waren- und Gütertransport
auch heute noch größtenteils von der Eisenbahn bewältigt. Die
„Österreichischen Bundesbahnen" sind gegenwärtig das größte
Transportunternehmen Österreichs.
>>HANS<<
Fabriksnummer 637
Bauart Bt-n2
Höchstgeschwindigkeit 18 km/h
Spurweite 760 mm
Leermasse ohne Tender 5,5 t
Dienstmasse mit Tender 6,6 t
Die einzige erhaltene Lokomotive des deutschen Herstellers
Zobel/Bromberg in Österreich ist die „Hans" der ehemaligen
Werksschmalspurbahn Mürzzuschlag-Hönigsberg. Als Besonderheit ist die
„Hans" mit einem Giesl-Ejektor ausgestattet. Baujahr 1913
Werkslokomotive Firma Schöller-Bleckmann („Phönix-Stahlwerke J.E. Bleckmann")
Leihgabe, Winter! Sport! Museum! Mürzzuschlag

TRIEST
Seit sich Trieste/Triest 1382 der Habsburgischen Herrschaft
unterstellt, rückt die Hafenstadt zunehmend in den Blickpunkt
wirtschaftlicher und verkehrspolitischer Interessen der Habsburger. Der
wirtschaftliche Aufschwung der Stadt ist besonders mit den Initiativen
Karls VI. (Kaiser von 1711-1740) und seiner Tochter Maria Theresias
(„Kaiserin" von 1740-1780) verbunden: Nachdem Karl VI. 1717 die
Freiheit der Adriaschifffahrt für alle „eigenen und ausländischen
Schiffe" proklamiert, erhebt er Triest 1719 (zusammen mit Fiume/Rijeka)
zum „Freihafen". Dadurch erhalten sämtliche ausländischen Kaufleute
oder Kapitäne, die im Freihafen anlegen, unbehindert und unentgeltlich
Zugang zu diesem, wo ihnen darüber hinaus der Erwerb, Verkauf oder die
Löschung von Gütern frei gestattet ist. Dadurch wird die Position
Triests gegenüber Venedig als Endpunkt der Handelsrouten aus den
österreichischen Ländern wesentlich gestärkt. Mit der Erhebung zum
Freihafen verbunden ist auch der Ausbau der „Haupt- und
Kommerzialstrasse" zwischen Wien und Triest („Triesterstrasse"), in
dessen Zuge unter anderem auch die Neutrassierung der Semmeringstrasse
erfolgt (1728). Unter Maria Theresia wird im Hafenbereich ein völlig
neuer Stadtteil erbaut, der noch heute den Namen „Borgo Teresiano"
trägt.
Durch die Gründung der „Ostindischen Handelskompagnie" (1722-1731) und
der österreichisch-ostindischen Handelskompagnie" (1775-1785) sowie
durch die Gründung des „Österreichischen Lloyd" als
Schifffahrtsgesellschaft (1836) in Triest wird die Stadt endgültig zu
einem zentralen Punkt der habsburgischen Wirtschafts- und
Verkehrspolitik. Einen Höhepunkt findet diese Entwicklung mit der
Fertigstellung der „Südbahn" (1857), wodurch sich für Triest das
gesamte Hinterland bis zur Residenzstadt Wien - und darüber hinaus -
als Wirtschaftsraum erschließt. Um die durch die „Südbahn" steigenden
Handelsaktivitäten bewältigen zu können, stellt man ab den
1860er-Jahren Überlegungen zur Modernisierung der aus dem 18.
Jahrhundert stammenden Hafenanlagen an. Diese Bestrebungen verstärken
sich angesichts der Eröffnung des Suezkanals (1869), über den eine
wesentliche Erweiterung der Handelsrouten Richtung Indien und Fernost
erwartet wird. Schließlich wird 1883 der nach Kaiser Franz Joseph I.
benannte neue Triestiner Hafen fertig gestellt. Triest entwickelt sich
in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bis 1918 zu einem der
wichtigsten Industrie-und Handelszentren der Habsburgermonarchie.
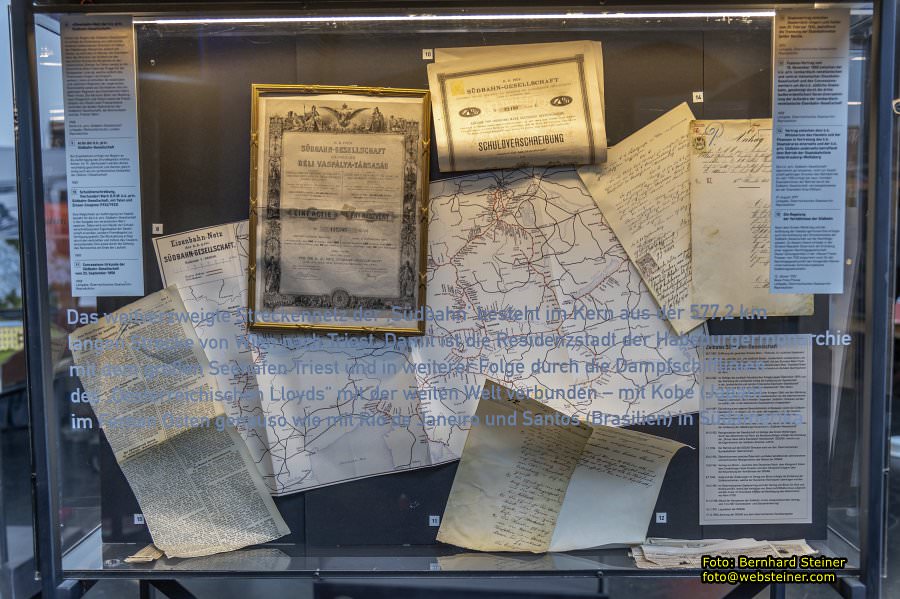
Zauber der Montur - Die Eisenbahner
Mit der Industrialisierung ändert sich auch die Gesellschaft.
Mechanisierung, Arbeitstellung und andere Faktoren verändern die
Berufsbilder. Berufe verschwinden, Berufe entstehen. Die Eisenbahn
schafft Arbelt - und einen neuen Berufsstand, den der Eisenbahner. Per
„kaiserlicher Verordnung" vom 16.11.1851 wird für alle Kronländer elne
Elsenbahnbetriebs-Ordnung verfasst. Ihr Vorläufer ist das
„Pollzeigesetz für Eisenbahnen" vom 14.03.1847. 1882 wird die Direktion
für Staatseisenbahnbetrieb gegründet und im Anschluss daran das
Eisenbahnministerlum. Nach englischem Vorbild gelten Elsenbahner nun
als Handelsangestellte. Die Eisenbahner der Frühzeit sind ein
Konglomerat aus verschiedenen Berufszweigen, wobel ehemalige Angehörige
des Militärs bevorzugt aufgenommen werden.
Lange hält sich der Spottvers: Wer nichts ist und wer nichts kann - geht zur Post oder Eisenbahn.
Wie in der sozialdemokratischen Partel spielt auch bel den Elsenbahnern
das Vereinswesen eine bedeutende Rolle. Das „Verwurzeltsein" In den
verschiedensten Arten von Vereinen vom „Südbahnbund" bis zur
„Sängerrunde Lokomotive" hat bei den Eisenbahnern lange Tradition und
zeichnet sie bis zur Gegenwart aus.

k. u. k. Caféwaggon

Warnung.
Das Oeffnen der Bahnschranken, das Betreten und Beschädigen der
Bahnanlagen, die Störung der Telegrafenleitung, das Weiden des Viehes
an der Bahn ohne Aufsicht, sowie die Widersetzlichkeit gegen das
Bahnpersonale ist bei Strafe verboten.
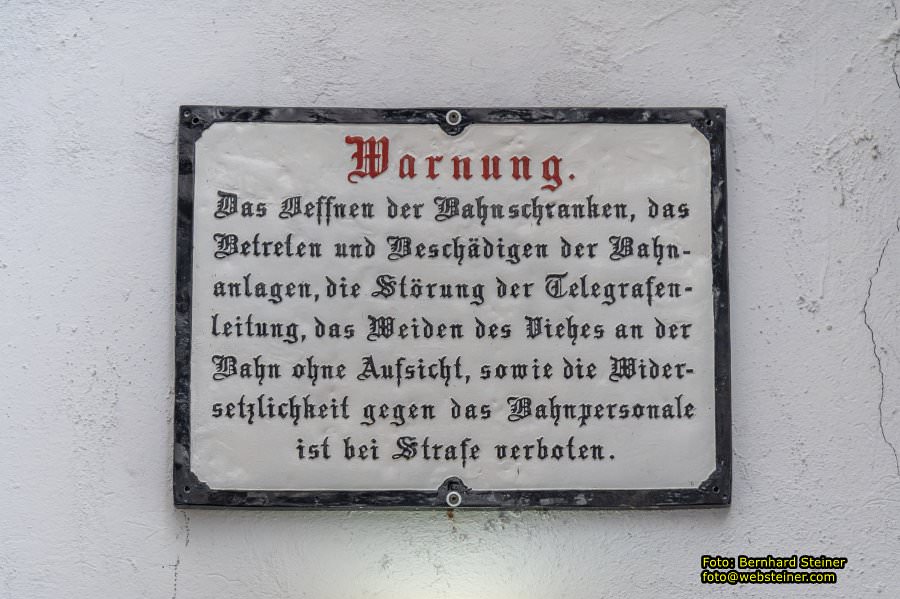
Lokomotiv-Schmuck
Zum 75-jährigen Jubiläum der Betriebsaufnahme der Semmeringbahn
veranstaltete die ÖBB am 23. Juni 1929 einen Sonderzug mit der 109er.
75 Jahre später, zum 150 Jahr Jubiläum, wurde von den ÖBB und vom 1.
ÖSEK am 20. Juni 2004 zur Eröffnung des SÜDBAHN Kulturbahnhofes wieder
ein Sonderzug geführt. Das Eisenbahnmuseum Strasshof schmückte nach der
historischen Vorlage die 109.13 und die 629.01.
Leihgabe Eisenbahnmuseum Strasshof, 1. ÖSEK

Der Korridor der Eisenbahn
Der gefahrlose Umgang mit der noch ungewohnten Eisenbahn, der ersten
industriellen Transporttechnologie, muss vom Menschen erst erlernt
werden. Der die Umwelt förmlich durchschneidende Korridor rund um die
Eisenbahn wird abgegrenzt, um diesen Umgang zu erleichtern. Auf die
Bahnsteige der Bahnhöfe gelangt man nur mit gültiger Fahrkarte und die
Bahntrasse darf gar nicht betreten werden. Nur an eigens dafür
festgesetzten Stellen dürfen Gleise überquert werden, entweder unter
Aufsicht des Schrankenwärters oder mit Hilte eindringlich formulierter
Warnschilder.
Semmeringbahnzüge
In den vergangenen 150 Jahren kommen auf der Südbahn über 100
verschiedene Lokomotivtypen zum Einsatz zunächst jene der privaten
Wien-Gloggnitzer Eisenbahn-Gesellschaft (WRB), danach ab 1844 jene der
südlichen Staatseisenbahn (SSB) und schließlich ab 1859 Lokomotiven der
k.k.priv. Südbahngesellschaft (SB). Nach dem Ersten Weltkrieg wird die
Südbahn von Lokomotiven der jeweiligen Staatsbahnen der
Nachfolgestaaten Italien (FS), Jugoslawien (JZ) und Österreich (BBÖ,
nach Zweitem Weltkrieg ÖBB) befahren. Mit dem Anschluss Österreichs an
Hitler-Deutschland und der Eingliederung der österreichischen Bahnen in
die Deutsche Reichsbahn (DRB), kommen neben den Kriegs-Dampflokomotiven
wie der Baureihe 52 oder 42 auch einige Lokomotivreihen aus Deutschland
auf die Südbahn. Nach dem Zweiten Weltkrieg im Zuge der
fortschreitenden Elektrifizierung werden die Dampflokomotiven immer
weiter zurückgedrängt, wobei in dieser Zeit auch Diesellokomotiven zum
Streckeneinsatz kommen.

Unter dem Hauptthema Über den Berg. Wien – Mürzzuschlag – Triest in 13
Stunden 4 Minuten zeigt die Ausstellung auf insgesamt rund 2200
Quadratmetern Eindrücke vom Bau der Südbahn. Die Ausstellung zur
Südbahn dokumentiert die Geschichte dieser verkehrsgeschichtlich
bedeutenden Eisenbahnstrecke von den ersten Entwürfen bis in die
Gegenwart. Die Lokomotive der Sinne, der Zug der Schicksale und die
Viadukt-Baustelle sind einige Themen der Ausstellung. Im „Tunnel“ kann
die unter den Schienen noch eingebaute Achssenke der ehemaligen
Werkstätte besichtigt werden.

Durch die Lokomotivtechnik konnte sich der Mensch in bisher ungeahnter
Geschwindigkeit durch Raum und Zeit bewegen, da sich die bisherigen
Reise- und Transportzeiten auf ein Minimum verkürzten. In der frühen
Eisenbahnzeit belief sich die durchschnittliche Geschwindigkeit der
Eisenbahnen auf 30 bis 45 km/h, was in etwa dem Dreifachen der von
einer Postkutsche erreichten Geschwindigkeit entsprach. In der Praxis
bedeutete dies, dass eine gegebene Stecke in einem Drittel der bisher
benötigten Zeit zurückgelegt werden konnte. Bereits kurz nach Beginn
des Lokomotivbaus wurden so genannte „Schnellfahrloks" gebaut, die
schon in den 1830er-Jahren bis zu hundert Stundenkilometer erreichten.
Derartige „Experimente" hatten allerdings für den Normalbetrieb
keinerlei Konsequenzen. Heute werden im Plandienst
Höchstgeschwindigkeiten bis zu 300 km/h erreicht.
Durchschnittliche Geschwindigkeit der Schnellzüge Europas im Sommer 1896
Die Fahrgeschwindigkeit der Eisenbahnen war in den einzelnen
europäischen Staaten unterschiedlich festgelegt. Auf den
österreichischen Bahnen belief sich die Grundgeschwindigkeit für
Schnellzüge auf Hauptbahnen am Ende des 19. Jahrhunderts auf 80-90
km/h. Personenzüge fuhren durchschnittlich 65-80 km/h, Gütereilzüge ca.
45 km/h und Güterzüge 40 km/schnell. Als Höchstgeschwindigkeiten wurde
bei Personenzügen bis zu 120 km/h erreicht, was aber keiner
Durchschnittsgeschwindigkeit entsprach.
Die „Vernichtung" von Raum und Zeit durch die Eisenbahn... oder: Von der Eisenbahnzeit zur Weltzeit...
Am Ende des 19. Jahrhunderts hatte sich der europäische
Eisenbahnverkehr weitgehend internationalisiert. Darüber hinaus
schienen sich die Räume proportional zur Geschwindigkeit der Züge zu
verkürzen. Diesen Prozess bezeichneten die Zeitgenossen als
„Verkürzung" oder „Vernichtung" der Zeit und des Raumes. Bis zur
Einführung der so genannten „Einheitszeit", verfügte beinahe jeder Ort
der Welt über eine eigene Ortszeit. Diese wurde unter anderem auf den
Bahnhöfen durch „Stationsuhren" angezeigt, nach denen sich die
Ankunfts- und Abfahrtszeiten der Züge richteten. Um jedoch überregional
bzw. international gültige Fahrpläne zu schaffen, war es notwendig,
eine international gültige Zeitregelung zu finden. Diese wurde 1884 auf
Grundlage der bis heute bestehenden Welt-Zeltzonen-Einteilung
eingeführt und im Jahre 1890 auch in die Fahrpläne der
österreichisch-ungarischen Monarchie übernommen. Auf der
Sommerfahrplankonferenz von Berlin 1891 wurde schließlich die
„mitteleuropäische Zeit" (MEZ) eingeführt, nach der schließlich auch
die Fahrpläne der Monarchie ausgerichtet wurden.

Technisch gesehen ist die Dampflokomotive ein an die Bahngleise
gebundenes Dampfkraftwerk auf Rädern mit einer bestimmten
Umsetzungsmechanik: Durch die im Brennstoff (anfänglich Koks oder Holz,
später meist Kohle, welche am Tender mitgeführt wird) steckende
Energie (in der Feuerbox freigesetzt durch Verbrennung am Feuerrost)
wird im (Lang-) Kessel Wasser in Dampf umgewandelt. Die Kraft des
Dampfes (aus dem Kessel im Dampfdom entnommen) wird im Zylinder in eine
mechanische Linearbewegung des Kolbens umgesetzt, welche sie wiederum
durch den Kurbeltrieb des Triebwerkes in eine Rotationsbewegung der
Treib- und Kuppelachsen umwandelt.
Aufbau und Funktion der Lokomotive
Die Lokomotive ist eine fahrbare, an Gleise gebundene Kraftmaschine,
deren Antrieb aus internen oder externen Energiequellen (Kohle und
Dampf, Pressluft, Dieselöl, Gas, Strom, Kernkraft) kommt, der
Beförderung von Eisenbahnwagen dient, aber im Allgemeinen nicht für die
Aufnahme von Gütern oder Personen bestimmt ist.

Die Stationen der JŽ 33-329: Biographie eines bewegten Lebens
- gebaut im Jahr 1943 in der „F. Schichau GmbH, Maschinen- und Lokfabrik", in Elbing (Westpreussen, heute: Polen) mit der Fabriksnummer 3700/43 hergestellt.
- am 9.8.1943 erfolgte die Übernahme durch die Deutsche Reichsbahn.
- nun wurde ihr die Nummer DR 52 5422 zugeteilt und kam an die Reichsbahndirektion Wien.
- nach dem Zweiten Weltkrieg erfolgte am 19.6.1945 die Abgabe der Lokomotive über die ungarische Staatsbahn (MAV) in die Sowjetunion. Dort wurde sie auf Breitspur (1524 mm anstelle 1435 mm 'Normalspur'-Schienenabstand) umgespurt und erhielt die Nummer TE-5422.
- 1962 erfolgte eine Generalreparatur der gesamten Maschine
- im Mai 1966 wurde sie - wieder umgespurt auf Normalspur - in den Stand der jugoslawischen Staatsbahn (JŽ) übernommen und als JŽ 33-329 nummeriert.
- von 1969 bis 1974 befand sie sich in Subotica.
- nach einer Belastungsprobefahrt bei Niš wurde die Maschine nach Dimitrovgrad gebracht und dort seit 27.6.1974 als strategische Reserve hinterstellt und konserviert.
- zusammen mit 5 anderen Lokomotiven der JŽ Reihe 33 ( Baureihe ÖBB 52) wurde sie von 3. bis 6.9.1991 von Jesenice nach Strasshof an der Nordbahn überstellt.
- in ihrem letzten Zustand als abgestellte JZ 33-329 ist sie 2004 im SÜDBAHN. Kulturbahnhof Mürzzuschlag am Semmering aufgestellt worden und repräsentiert nun gleichsam das Ende der Dampflokomotiv-Epoche.

Schon 1843 werden auf der Linie Wien-Gloggnitz verschiedene Arten von
Fahrpreis-Begünstigungen eingeführt: Von zwei Personen kann ein Kind
unentgeltlich mitgenommen werden, werden 12 Karten 1. Klasse gekauft,
müssen bloß 10 Stück bezahlt werden - als Abonnementkarten.
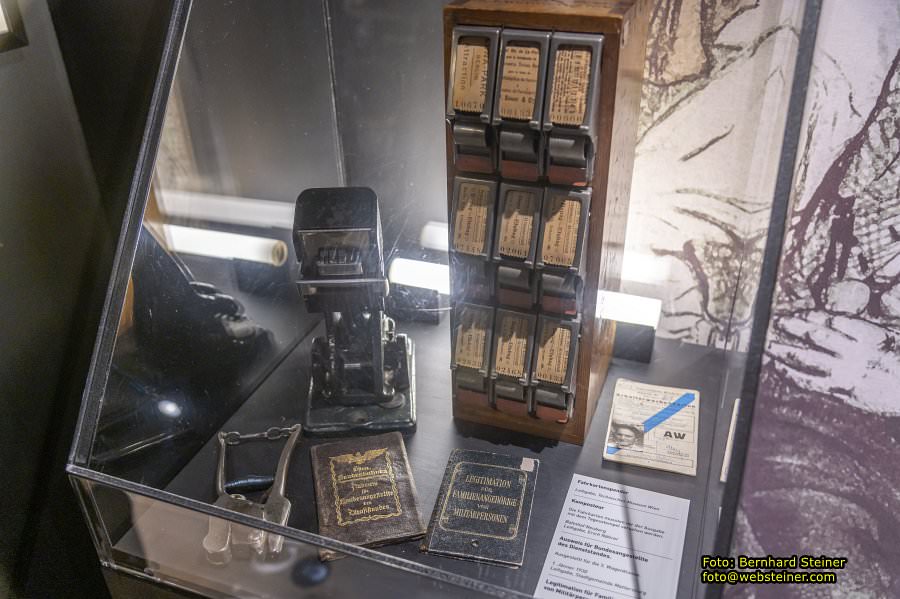
Die Wagen der 3. Klasse hatten keine geschlossenen Stirnwände, sondern
nur ein auf Säulen ruhendes Dach und einfache hölzerne Sitze. Der
Außenanstrich der Wagen 3. Klasse war braun.

Das vis-a-vis Verhältnis der Reisenden im Eisenbahnwaggon wird
zunehmend unerträglich. Das Mitbringen von Reiselektüre ist ein
Versuch, die nicht mehr zustande kommende Unterhaltung - im Vergleich
zu den gewohnten Postkutschenfahrten ist dafür nämlich nun keine Zeit
mehr - zu ersetzen. 1849 wird in England die „Railway Library"
gegründet und später auf dem Kontinent übernommen. Sich mit
Reiselektüre auseinander zu setzen ist übrigens eine ausschließlich
bürgerliche Beschäftigung.
Die Sitzplätze der Wagen 2. Klasse waren mit Leder überzogen. Sie
hatten geschlossene Rückwände jedoch keine Abteilungswände. Der
Außenanstrich der Wagen 2. Klasse war grün.

Die Hofwagen der verschiedenen Zeitperioden repräsentieren die
jeweilige Leistungsfähigkeit des Waggonbaues und der Technik. 1845 wird
von Heindorfer ein erster Hofwagen für die Staatsbahnen gebaut. Wahrend
die Speise- und Schlafwaggons fahrplanmäßig verkehren und jedem
zugänglich sind, dürfen die sogenannten Salonwagen nur von einzelnen
Persönlichkeiten benutzt werden. Sie stehen nur nach Bedarf zur
Verfügung. Für die Hofreisen gelten eigene Vorschriften und damit auch
separate Fahrplane, die auf größtmögliche Sicherheit, Komfort und
Pünktlichkeit ausgerichtet sind. Diese Hofzüge haben Vorrang vor allen
anderen. Ersatzlokomotiven müssen immer bereitgehalten werden,
eigens dafür geschulte Bedienstete begleiten den Zug. Diese Reisen
werden dem Hof von den Gesellschaften auch verrechnet. Für die Reise
des Kaisers von Wien nach Wiener Neustadt werden 227 Gulder und 25
Kreuzer (2.237,50 €) in Rechnung gestellt.
Die Wagen 1. Klasse waren gepolstert, mit Tuch überzogen und hatten Glasfenster. Der Außenanstrich der Wagen 1. Klasse war gelb.

Koffer sind mehr als nur Reiseutensilien. Sie sind auch Objekte, die
gesellschaftliche Veränderungen und Veränderungen in der
Verkehrstechnik anzeigen. So verändert natürlich auch das
Eisenbahnzeitalter den Koffer. Stabile große Koffertruhen mit
Holzkorpus und flachem Deckel kommen in Mode, weil sie im Gepäckwaggon
leicht aufeinandergestapelt werden können. Das Bahnabteil erfordert
Koffer, die im Gepäcksnetz oder unter dem Sitz verstaut werden können.
Mit dem Handkoffer gewinnen Reisende mehr Unabhängigkeit und
Bewegungsfreiheit.

Signale für die Sicherheit
FÜR DAS SYSTEM EISENBAHN IST SEIT BEGINN DES EISENBAHNZEITALTERS IN DEN
1840ER JAHREN DIE SICHERHEIT DER ZUGFAHRTEN EIN WESENTLICHES MERKMAL.
Trotz ausgefeilter technischer Einrichtungen ist es schlussendlich der
Mensch der die Verantwortung trägt. Der erste Mann am Bahnhof ist der
Fahrdienstleiter, früher Verkehrsbeamter genannt. Erkennbar an seiner
roten Kappe obliegen ihm die Bedienung des Stellwerkes und damit die
Verkehrsabwicklung. Die ausgestellten Originalobjekte zeigen den
Arbeitsbereich des Fahrdienstleiters und des Stellwerkswärters. Mit der
Einführung der Computertechnik im Eisenbahnsicherungsdienst hat sich
der Dienst in den Bahnhöfen grundlegend geändert. Heute gibt es keine
optische Fahrstraßenprüfung mehr und die Leitung und Überwachung der
Zug- und Verschubfahrten erfolgt aus großer Entfernung in
Betriebsführungszentralen. Die dort tätigen Fahrdienstleiter haben
einen viel größeren Streckenbereich als früher zu betreuen, werden aber
durch Computer unterstützt.
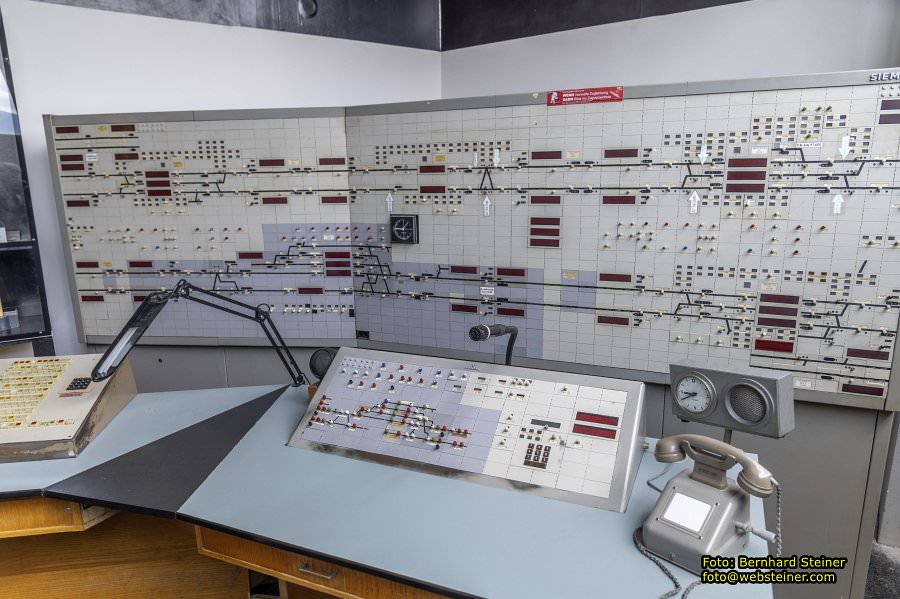
Bitte Einsteigen! - Die Sozialgeschichte des Reisens
Die Elsenbahn hat von ihrer Entstehung an zwel Grundkompetenzen - das
Befördern von Gütern und das von Personen. Die soziale Hierarchle in
den Eisenbahnen fällt schon am Beginn der Personenbeförderung auf - sie
ist allerdings keine Erfindung der Eisenbahn. Schon zur Zelt des
Postkutschenverkehrs gibt es unterschiedliche Preise für Reisende, die
auf dem luftigen Kutschbock und für jene, die geschützt Im Wagen
relsen. Ursprünglich werden für jede Wagenklasse separate Wagen gebaut,
später ergibt sich die Notwendigkelt gemischte Wagen zu bauen.
Besonders die Wagen 1. Klasse werden, wegen ungenügender Ausnützung nur
mehr seltener gebaut und durch gemischte, duch 1. und 2. Klasse-Wägen,
ersetzt.
1896 benützen 1,03% die erste Klasse, 7,92% die zwelte und 88,05% die
dritte. Anfangs ist der Personenwagen übrigens eine auf ein
Eisenbahngestell in Federn gehängte Straßenkutsche. Die Dimensionen der
ältesten Elsenbahnwagen sind - nach unseren heutigen Vorstellungen -
nur auf das notwendigste beschränkt. Besonders genügsam ist man, was
dle Höhe der Wagen betrifft - aufrechtes Stehen gestatteten sie nicht.
Die durchschnittliche Abmessung eines Coupés Im Jahre 1838: Höhe 1,60m;
Breite 1,75m; Länge 1,60m

Ästhetik, Kommerz und Schienen - Einflüsse und Auswirkungen der Bahn
Die Einflüsse und Auswirkungen der Eisenbahn sind weltreichend. Spuren
der Eisenbahn finden sich sowohl im Bereich der Kunst und Kultur, als
auch im Tourismus und der Landschaft: ab den 1870er Jahren nahm die
Eisenbahn als Bildmotiv Einzug in die Kunst. Auch das Sujet der
Semmeringbahn findet sich auf vielen Gemälden, Aquarellen oder Stichen.
Die Kultur der Jubiläumsfeierlichkeiten wird seit Anbeginn sehr
gepflegt - mit feierlichen Gedichten, Festschriften, Umzügen und
geschmückten Lokomotiven wurde dem Bahnbau gedacht. Zur Ankurbelung der
Fahrgastzahlen wurden von der Südbahn-Gesellschaft schon frühzeitig
Hotels in unmittelbarer Bahnnähe errichtet - wovon das Südbahnhotel am
Semmering bis heute ein stummes Zeugnis abgibt. Einhergehend mit dem
Aufkommen des Tourismus ist auch die gezielte Wahrnehmung von
Landschaft. Dieser ästhetische Eindruck konnte erst durch distanzlerte
Betrachtung - wie beispielsweise durch das Waggonfenster, mittels
Panoramen oder durch Reiseführer generiert werden.

Rund 27 Kilometer Länge, 18 Jahre Bauzeit und herausfordernde
geologische Bedingungen: Der Semmering-Basistunnel ist eines der
wichtigsten Infrastrukturprojekte im Herzen Europas. Als Teil der neuen
Südstrecke bringt der Semmering-Basistunnel eine rasche und sichere
Verbindung zwischen Niederösterreich, Wien und der Steiermark: Das
entlastet die historische Semmeringbahn und bringt Sie als Reisenden
noch rascher an Ihr Ziel. Zudem wird der Gütertransport auf dieser
Strecke attraktiver: Selbst schwere Züge können den Tunnel mit nur
einer Lok passieren. Der Semmering-Basistunnel ist eine der
nachhaltigsten Investitionen für die Wirtschaft und den Klimaschutz:
Der Ausbau stärkt den Baltisch-Adriatischen Korridor in Europa. Dadurch
bleibt unsere Wirtschaft international wettbewerbsfähig und die Umwelt
atmet auf: Jede Tonne Fracht auf der Schiene bedeutet rund 30-mal
weniger CO2-Emissionen als beim LKW.
Der Bau des Semmering-Basistunnels ist bereits weit voran geschritten.
Mitte 2023 waren bereits über 95% des Tunnels gegraben und nur mehr
rund 1 km zurückzulegen. Gebaut wird aus logistischen und zeitlichen
Gründen von fünf Baustellen aus mit insgesamt 14 Vortrieben. Nach dem
Vortrieb wird im Tunnel eine Beton-Innenschale errichtet und dann als
letzte Phase vor der Inbetriebnahme die technische Tunnelausrüstung
eingebaut. In Mürzzuschlag liegt die westliche Portalbaustelle des
Semmering-Basistunnels. Im Zuge der Arbeiten wurde auch der Bahnhof
Mürzzuschlag modernisiert.

Das SÜDBAHN Museum komplett macht die Fahrzeugsammlung im
Ringlokschuppen. Neben Dampflokomotiven wie der 180.01 sind auch
Elektrolokomotiven, zum Beispiel die Schweizer Gebirgslokomotive Ce 6/8
II „Krokodil“, ausgestellt. Die umfangreiche Draisinen-Motorbahnwagen-
und Zweiwegefahrzeugsammlung zeigt mehr als 30 derartige Fahrzeuge von
den 1830er-Jahren bis in die 2000er von allen bedeutenden
Konstrukteuren Österreichs – wie zum Beispiel von Ferdinand Porsche.
Mehrere ehemalige ÖBB-Lokomotiven sowie Fahrzeuge des Technischen
Museums Wien sind als Leihgaben ausgestellt, unter anderem ein Exemplar
der ÖBB-Reihe 91, das zuletzt auf der Lokalbahn Mürzzuschlag–Neuberg im
Einsatz stand. Seit 2024 befindet sich auch die Lokomotive Steinbrück,
mit Baujahr 1848 die älteste erhaltene in Österreich gebaute
Lokomotive, im SÜDBAHN Museum.

Mit der Weiterentwicklung der Bahnlinien geht Mitte des 19.
Jahrhunderts die Errichtung eigener Zugförderungen zur Überwachung des
zunehmenden Fahndienstes und zur Erhaltung der Lokomotiven und Wagen
einher. Zur Wartung und Reinigung der Lokomotiven sind so genannte
Heizhäuser gebaut worden. Ursprünglich als schwerer Steinbau
ausgeführt, weisen diese Heizhäuser zwei Grundformen auf, ällere gerade
und die spätere segmentförmige Bauart. Der Rundlokschuppen in
Mürzzuschlag ist 1873, im Zuge einer großen Erweiterung der
Semmeringbahn, gebaut werden. Im 2. Weltkrieg ist das Gebäude, aufgrund
der größeren Länge der Dampflokomotiven. bereits vergrößert worden.
2005 ist der Rundlokschuppen nach 132 Jahren außer Betrieb und 2006 vom
Bundesdenkmalamt unter Schutz gestelltgestellt worden. Heute bletet er
zwei Themenschwerpunkten Platz: der größten österreichische Draisinen-
und Motorbahnwagensammlung aus Privatbesitz und historischen
SÜDBAHN-Lokomotiven.
Ausstellung über die geschichtliche Entwicklung der normalspurigen
Draisinen, Bahnwagen und Motorbahnwagen auf Österreichs
Eisenbahngleisen. Es sind Originalfahrzeuge und Rekonstruktionen von
Schienenfahrzeugen zu sehen, die im Zeitraum von 1836 bis 1970 fur
Bahnaufsicht und Bahnerhaltung in Verwendung waren. Die Ausstellung ist
allen Eisenbahnern und Arbeitern gewidmet, die seit dem Bau der ersten
Schienenbahnen in Österreich für deren sicheren und reibungslosen
Betrieb, auch in schwierigsten Zeiten und unter widrigsten
Verhältnissen tätig waren.
Lokomotiven - Die mächtigen Symbole der Eisenbahn!
Die Dampflokomotiven sind Leihgaben des Technischen Museums Wien und
der Brenner&Brenner Dampflokomotiven Gesellschaft. Das SÜDBAHN
Museum - Rundlokschuppen versteht sich als „museum in progress" und
wird sich in den nächsten Jahren noch weiter verändern.

Karl Friedrich Drais - Der Namensgeber
Karl Friedrich Drais (*29. April 1785. †10. Dezember 1851). Freiherr
von Sauerbronn. lebt als Forstmeister im deutschen Königreich Baden. In
seinem sehr unsteten Leben, macht Drais mehrere Erfindungen und wird
1818 zum Professor der Mechanik ernannt. 1813 erfindet Drais einen
vierrädrigen Wagen für die Straße, der vom Fahrer mittels Fußantrieb an
der hinteren Achse bewegt wird. 1817 baut er ein hölzernes Zweirad mit
Lenkstange und Fußantrieb - die Laufmaschine und damit Vorläufer der
ersten Fahrräder. Im Zuge des Bahnbaues in Karlsruhe erprobt Drais 1842
einen vierrädrigen Wagen mit Fußantrieb auf den Bahngleisen. 1843
entwickelt die Firma Keßler & Martiensen in Karlsruhe vierrädrige
Wagen mit Handkurbelantrieb für die Badischen Eisenbahnen. So entsteht
die Bezeichnung Draisine für ein vorerst nur durch Menschenkraft
angetriebenes Schienenfahrzeug.
Eine Draisine ist ein kleines, durch Menschenkraft oder Verbrennungsmotor angetriebenes Schienenfahrzeug
Die Entwicklung beginnt beim Laufrad oder Laufmaschine und beim
hölzernen Bahnwagen am Beginn des 19. Jahrhunderts. Eingesetzt um den
sicheren und reibungslosen Betrieb der Eisenbahn zu gewährleisten ist
sie von großer Bedeutung für die regelmäßige Wartung und Erhaltung der
baulichen Anlagen.
Die einzelnen Bahnstrecken werden in Aufsichtsbereiche unterteilt und
von Bahnmeistereien oder Bauhöfen betreut. Als Hilfsmittel für die
Überwachung und für Erhaltungsarbeiten entstehen in der Mitte des 19.
Jahrhunderts eigene Bahndienstfahrzeuge.
Franz Aloys Bernard - Erfinder der Draisine
Der Wiener Seidenfabrikant Franz Aloys Bernard, beeindruckt von der
ersten österreichischen Dampfeisenbahn, die 1837 zwischen Floridsdorf
und Deutsch Wagram fährt, beschäftigt sich mit der Erfindung einer
Gleis-Laufmaschine. Am 26. Februar 1838 bekommt er ein österreichisches
Patent und gilt daher im deutschsprachigen Raum als Erfinder der
Draisine.
* * *
HANDHEBELDRAISINE-VELOCIPED
Sheppard-Telegraph-Handcar nach Muster aus Szentes, Rekonstruktion János Hidvégi
Diese Handhebeldraisine wird ab 1860 in den USA gebaut und ist bei fast
allen Bahnen der Welt in Verwendung. In Österreich vor allem im Einsatz
für die Südbahngesellschaft. Bei der Raab-Oedenburger-Ebenfurther
Eisenbahn ist sie bis in die späten 1920er Jahre im Einsatz. Die
Fortbewegung erfolgt mittels Arme und Beine.
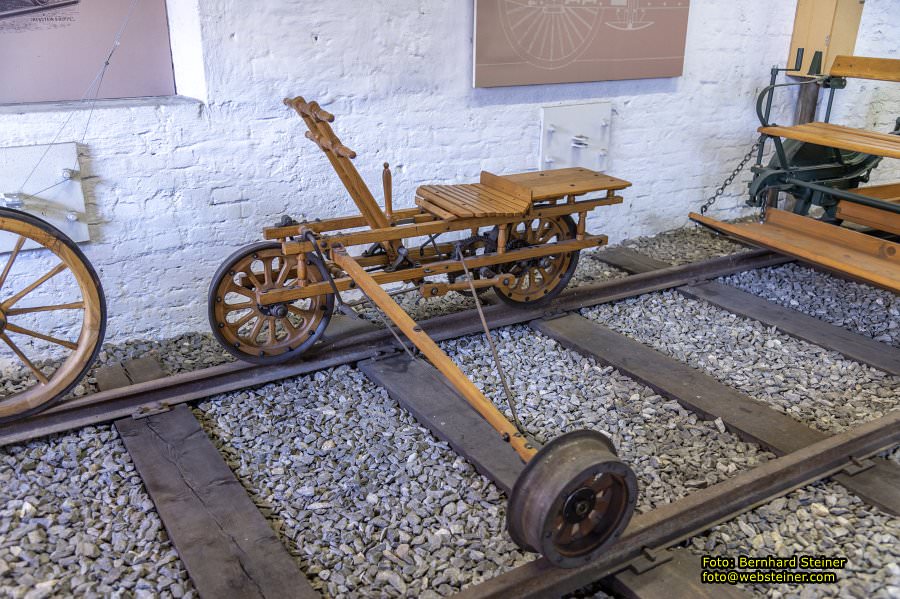
DRAISINE AUSTRO-DAIMLER TYPE D IV
2 Zylinder Steyr FB 10A Motor mit 10 PS Leistung, Rekonstruktion mit Original Austro-Daimler Teilen von der Firma Anton Braun
Diese Vollbahndraisine entsteht um 1928 als einfachere Version der
größeren D III. Sie kann wahlweise mit dem 6 oder 12 PS starken,
luftgekühlten Feldbahnmotoren FB 6/8 oder FB 12 geliefert werden. Diese
Motorreihe entstammt einer Entwicklung von Ferdinand Porsche, der bei
Austro-Daimler bis 1923 als Konstrukteur tätig ist. Typisch für diese
Draisinen von Austro-Daimler ist der einfache Wechsel der
Fahrtrichtung, da die Fahrzeuge im wesentlichen vorne und hinten gleich
sind. Sie haben ein Wendegetriebe und damit können alle drei Gänge für
beide Fahrtrichtungen benützt werden. Diese Draisinen werden von den
ÖBB spätestens in den 1950er Jahren umgebaut und bekommen einen
geschlossenen Wagenkasten.

Die Draisine - Historische Entwicklung
1813 K.F. Drais erfindet Wagen für die Straße, der mit Füßßen angetrieben wird
1826 J. Božek baut eine Fahrmaschine für die Pferdeeisenbahn Linz-Budweis
1838 FA. Bernard aus Wien, erhält ein Patent für eine einspurige Laufmaschine die auf Gleisen fährt
1880 in Österreich wird die Handhebeldraisine nach dem System Plank zum Standardfahrzeug
1887 Daimler baut in Stuttgart-Cannstadt die erste Motordraisine
1912 Wohanka baut in Prag Motordraisinen
1920 Versuchsfahrten bei den BBÖ mit einem Bahnwagen der von einem Austro-Daimler Feldbahnmotor angetrieben wird
1925 Entwicklung von Serienfahrzeugen mit Austro-Daimler Motoren für BBÖ Bereisungsdraisinen und Bahnmeisterwagen
1927 die Liesinger Motoren-Fabrik A.G. baut für die BBŐ Gleismotorräder
1941 Bau von großen Motorbahnwagen BM 40G bei Kromag in Hirtenberg
1943 Bau von Panzerspähdraisinen bei Kromag
1948 die Firma Stabeg in Wien liefert Kleindraisinen
1954 Entwicklung des Motorbahnwagens BM 35 mit Motor der Jenbacher Werke in den ÖBB Werken Wörth
1957 Einführung der schweren Motorbahnwagen BM 70 mit Druckluftbremsausrüstung bei den ÖBB
1974 die ersten von Plasser und
Theurer gebauten dieselhydraulisch angetriebenen Oberbaumotorwagen
leiten das Ende der Entwicklungsgeschichte der österreichischen
Draisinen ein
* * *
GLEISFAHRRAD DER ÖBB
ÖBB Bauartnummer X 701, gebaut um 1940 von der Hamburger Draisinenbau GmbH, Type 1A
Gleisfahrräder werden um die Jahrhundertwende von vielen Firmen im In-
und Ausland gebaut. An der Grundkonstruktion ändert sich bis in die
1950er Jahre kaum etwas. Es gibt Gleisfahrräder mit ein oder zwei
Sitzen. mit Sitzbänken und Werkzeugplattformen. Ältere Räder haben auch
manchmal nur 2 Räder über einen Schienenstrang und ein zusätzliches
Stützrad. In Österreich werden noch bis in die 1970er Jahre
Gleisfahrräder bei den ÖBB für Ablösefahrten von Bediensteten in
schlecht zugänglichen Bahndienststellen verwendet.

KLEINDRAISINE STABEG, TYPE 48
ÖBB Bauartnummer X 713, ÖBB X 713.008, zuletzt Signalmeister Ried im Innkreis
Von dieser Draisinentype werden von der Wiener Firma Stabeg ab 1948
rund 150 Stück gebaut. Anfänglich mit einem 3 oder 6 PS starken. von
Rotax gebauten Sachs-Stamo Zweitaktmotor angetrieben. Später wird die
Motorleistung auf 10 PS gesteigert. Die Draisine ist 280 kg schwer und
hat eine Höchstgeschwindigkeit von 40 km/h. Zum Schutz der 2 bis 3
Personen ist ein Planenverdeck vorgesehen. In den 1970er Jahren
bekommen auch diese Draisinen den üblichen zinkgelben Anstrich. Diese
Draisinenbauart ist die letzte. und damit „modernste" Type, die in
Österreich gebaut wird.

GLEISMOTORRAD TYPE MD/II DER LAG MIT ANHÄNGER
Motor Puch 125er, bei den Steiermärkischen Landesbahnen Feldbach-Bad Gleichenberg eingesetzt
In den Jahren von 1922 bis 1931 ist die Liesinger Motoren-Fabrik A.G.,
kurz LAG genannt, einer der größeren österreichischen
Motorradhersteller. Die LAG baut ab 1927 rund 120 Stück Gleismotorräder
mit einem 3 bis 5 PS Motor. Sie sind 150 kg schwer und können bis zu 35
km/h schnell fahren. Die Laufflächen der Räder sind zur besseren
Federung mit einer 25mm starken Gummiauflage belegt. Durch diese
Gleismotorräder werden viele der bis dahin verwendeten Gleisfahrräder
abgelöst.

Bahnmeisterkanzlei in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts
Schon im Zuge der ersten Bahnbauten werden jeweils in Sichtweite
entlang der Strecken Wärterhäuser gebaut. Damit ist es möglich. Signale
und Nachrichten durch Zeichen übermitteln zu können. Gleichzeitig
müssen die Wärter die ihnen zugeteilten Streckenbereiche beaufsichtigen
und kleine Reparaturen vornehmen. Es entsteht für die Bahnmeister neben
der Organisation von Instandhaltungsarbeiten an den Bahnanlagen das
Arbeitsgebiet „Bahnaufsicht". Dazu gehören Streckenbegeher,
Schrankenwärter, Blockwärter mit Signalbedienung sowie Lehnen- und
Tunnelwärter für Spezialaufgaben. Für diese Bedienstete müssen
Dienstpläne erstellt, ihre Löhne abgerechnet und ihre Tätigkeiten
überwacht werden. Der Bahnmeister benützt für seine Kontrollfahrten
meist ein Gleisfahrrad und später eine Kleindraisine. Für die
notwendige Bürotätigkeit der Bahnmeister und seiner Kanzlisten werden
an den größeren Bahnhöfen Bahnmeisterdienststellen eingerichtet.
Wichtig sind Vorschriftensammlungen, Regelzeichnungen für die einzelnen
Fachgebiete, Stoffverzeichnisse, Karteikarten für Personal, Inventar
und Stoffe, Abrechnungsbögen und Leistungsnachweise. Auch jeder
Kleinwagen hatte eine Karteikarte und sein Einsatz wird von einer
Bahnmeisterkanzlei aus gesteuert.

PUCH-MOTORRADMOTOR FÜR DRAISINEN
Austro-Daimler hat den 1929 entstandenen Puch Doppelkolben
Zweitaktmotor Type 250 in seine Draisine DVP eingebaut. Der 6 PS starke
Motor hat 248 cm³ Hubraum, einen Zylinderdurchmesser von 45 mm und
einen Hub von 78 mm. Austro-Daimler wird bereits 1928 mit den
Puchwerken fusioniert und heißt von da an Austro-Daimler- Puch A.G. Es
war daher eine wirtschaftliche Notwendigkeit, den vorher verwendeten. 1
Zylinder Austro-Daimler FB 5 Motor durch den bewährten Puch-Motor bei
der Draisine DV zu ersetzen. Bei dem Motor ist eine, seitlich des
Getriebes, montierte Kupplung, die es bei den Motorrädern nicht gibt,
notwendig.

KLEINDRAISINE AUSTRO-DAIMLER-PUCH A.G. TYPE D 5 P
ÖBB Bauartnummer X 711, Fabriksnummer 21051/6. Motor Puch SG, ÖBB Nr. X 711.011, bis 1998 Bahnmeister Hermagor
Die bei den ÖBB seit 1932 verwendeten Kleindraisinen werden ständig
verbessert und bekommen eine kleine Stirnwand, nach außen verlegte
Bandbremsen. eine neue Hub- und Wendevorrichtung und ab 1950 Puch TF
und später SGS Motore. Nun kann auch die externe Kupplung entfallen und
die Motorleistung steigt auf 13,8 PS. Die letzte Verwendung finden drei
Stück noch in den 1960er Jahren als Schmierdraisinen mit der
Bauartnummer X 716. Sie bringen während der Fahrt Schmiermittel an den
Schieneninnenseiten an, um die Abnützung an Schienen und Spurkränzen in
scharfen Bögen zu vermindern. Heute erfolgt diese Schmierung durch
ortsfeste Schienenschmiervorrichtungen.

KLEINDRAISINE AUSTRO-DAIMLER-PUCH A.G. TYPE D 11V
ÖBB Bauartnummer X 712.5, Motor Puch TF, ÖBB Nr. X 712.516, bis 1986 Fernmeldemeister Graz
Nach 1938 kommt, von Draisinentypen der Deutschen Reichsbahn
abgeleitet, eine andere Sitzordnung als bei der österreichischen D 5 P.
in Mode. Die Sitze werden nebeneinander angeordnet und es entsteht die
Type D 11V. Vergleichbar mit der Deutschen Bauart „Vorhölzer". In
Österreich gibt es nur einige Exemplare, die von den Werken Wörth der
ÖBB in den 1950er Jahren modernisiert und mit neuen Puch Motoren
ausgestattet werden.

SCHIENENAUTOKRAN FAUN LK 5S
Fahrgestellnummer 6443 von 06/1941. Der Kran ist nach 1945 mit der Nr.
930.04.03 hauptsächlich im Raum Linz und später mit der Nr. 916 824
beim Brückenmeister Tulln im Einsatz. Er wird sehr oft bei der
Streckenelektrifizierungen, so auch auf der Semmeringstrecke, für
Maststellarbeiten verwendet.
Im Zusammenhang mit der Entwicklung des Tiger-Panzers der Deutschen
Wehrmacht liefern die Nürnberger Faun Werke ab 1939 sieben Stück
schienengängige Autokräne. Es ist vorgesehen. für einen
Eisenbahntransport zu große und zu schwere Panzer, in drei Teile zu
zerlegen und in Frontnähe wieder zusammenzubauen. Tatsächlich werden
jedoch mit den Kränen keine Panzer zusammengebaut. Verwendet werden sie
von den Pioniertruppen. Der Unterwagen ist ein dreiachsiges
Faun-Fahrgestell L 900 D 567 mit einem Deutz F6 M 517 Motor mit 145 PS
Leistung. Ein Generator versorgt den, von Demag-Benrath gebauten Kran
Typ D 360 mit elektrischer Energie. Zu beachten ist die
Zusammenlegbarkeit des Krans, das weit ausfahrbare Gegengewicht und die
versetzte Vorderachse fur die Schienenfahrt

ZUGMASCHINE FAUN ZRS
Fahrgestellnummer 41620 von 12/1942. Eingesetzt bei der deutschen
Luftwaffe. Nach 1945 auf den Gleisen der Zipfer Bräuerei in Redl-Zipf
bis 1979 als Verschublokomotive in Verwendung. Danach bis 1987 auf
Baustellen der Gleisbaufirma Schmidt & Metzger.
1941 statten die Nürnberger Faun Werke ihre schwere Zugmaschine ZR mit
Pufferträger und Eisenbahnkupplungen aus. Die Straßenräder können gegen
Eisenbahnradfelgen getauscht werden. Sie sind auch für die russische
und spanische Breitspur verstellbar. Diese Variante hat die Bezeichnung
ZRS und ist mit einem 150 PS starken 6 Zylinder F 6 M 517
Deutz-Dieselmotor ausgestattet.

Skandinavisches Gleisfahrrad mit Schneidrädern

Zweiwege Ford Transit Kastenwagen FT 125
Bis 1982 bei der ÖBB Streckenleitung Salzburg später Gleisbaufirma Schmidt & Metzger
1972 beschaffen die ÖBB zwei Ford Transit Kastenwagen für die
Streckenleitungen Salzburg und Amstetten. Die Firma Zweiweg GmbH in
Rosenheim liefert die Wagen vorerst mit absenkbaren Gleitspurhaltern,
die wie Kufen wirken und von den Firmen Schneider und Beilhack
entwickelt worden sind. Einige Jahre später montiert man
Gelenk-Doppelrollenspurhalter ZW FR 2. Sie halten das Straßenfahrzeug
auf der Schiene. Mittels Hydraulik wird der notwendige Anpressdruck und
auch das Heben und Absenken gesteuert. Das Lenkrad der Wagen wird bei
Schienenfahrt fixiert.

GMUNDEN DAMPFLOKOMOTIVE NR. 4
Leihgabe Technisches Museum Wien
Fabriksnummer 131
Baujahr 1854
Bauart 2B n2 t
Leermasse 10,5 t
Dienstmasse 13,5 t
Die Gmunden wurde (im Jahre der Eröffnung der Semmeringbahn) von der
Wiener Neustädter Firma Günther erbaut. Von dieser Type wurden 10 Stück
für Personenzüge und 4 ähnliche für Güterzüge hergestellt. Eingesetzt
wurden sie auf dem Streckennetz der k.k. privilegierten ersten
(österreichischen) Eisenbahn-Gesellschaft. Die Spurweite war 1106 mm, das sind 3 1/2
Österreichische Fuß. Das Streckennetz umfasste die Strecke von Linz -
Wels - Lambach - Gmunden, und war die südliche Verlängerung der
Pferdeeisenbahn Linz - Budweis. Die schmalspurigen Lokomotiven waren
nicht sehr lange im Einsatz, da die Strecke 1903 auf Normalspur
umgebaut wurde.

KROKODIL - GOTTHARDBAHN-ELEKTROLOKOMOTIVE DER SCHWEIZERISCHEN BUNDESBAHNEN / SBB BE 6/8 II 13257
Leihgabe ÖBB Erlebnis Welt Bahn
Fabriksnummer 2677
Baujahr 1919
Bauart [1'C)' (1'C]'
Höchstgeschwindigkeit 75 km/h
Stundenleistung 2.688 kW (= 3.565 PS)
Dienstmasse 126 t
In der Schweiz wurden schon frühzeitig die Eisenbahnen elektrifiziert.
Ab 1920 konnte schon die gesamte Gotthardbahn elektrisch befahren
werden. Zur Bewältigung des damals schon großen Gütervolumens war es
notwendig, besonders leistungsstarke Elektrolokomotiven anzuschaffen.
Es wurde eine schwere, aber gelenkige Lokomotive mit den
charakteristischen Vorbauten konstruiert. Wohl deswegen erhielt diese
Lokomotivbaureihe bald den Spitznamen „Krokodil". Die „Krokodile" der
Serie Be und Ce 6/8 Il wurden zwischen 1919 bis 1922 in einer Serie von
33 Exemplaren von der Schweizer Lokomotiv- und Maschinenfabrik
Winterthur (SLM) gebaut. Sie kamen in den ersten Jahrzehnten
ausschließlich auf der Gotthard-Bergstrecke im Personen- und
Güterdienst zum Einsatz. Bis in die frühen 1960er-Jahre bildeten die
„Krokodile" das Rückgrat des Betriebes der Gotthardbahn.

Führerstand im „Krokodil"

180.01
Leihgabe Technisches Museum Wien
Fabriksnummer 1343
Baujahr 1900
Bauart E n2v
Höchstgeschwindigkeit 50 km/h
Leistung 740 kW (= 1.006 PS)
Leermasse ohne Tender 59 t
Dienstmasse mit Tender 102 t
Die Baureihe 180 ist der erste brauchbare Typ einer fünffach
gekuppelten Güterzuglokomotive und wurde in der Floridsdorfer
Lokomotivfabrik in Wien erbaut. Diese Baureihe ist untrennbar mit dem
berühmten Lokomotivkonstrukteur Karl Gölsdorf verbunden. Seine
Innovation war es, drei von fünf Achsen ein seitliches Spiel zu
gewähren, um so der Lokomotive eine gute Kurvengängigkeit zu
ermöglichen. Diese einfache Lösung war bei der neuen, fünfachsigen
180er so erfolgreich, dass die Konstruktion fortan weltweit eingesetzt
wurde.

DAMPFLOKOMOTIVE STEINBRÜCK
Die Dampflokomotive „Steinbrück", benannt nach einem Eisenbahnknoten in
der Untersteiermark im heutigen Slowenien, ist die älteste erhaltene
Dampflok österreichischer Fertigung.
TECHNISCHE DATEN
Konstrukteur: John Haswell, Wien
Hersteller: Maschinenfabrik der Wien-Gloggnitzer-Bahn
Baujahr: 1848
Fabriksnummer: 87
Betreiber: k.k. Südliche Staatsbahn (SSB), GKB
Steuerung: Stephenson
Leistung: ca. 250 PS (ca. 184 kW)
Bauart: 2'B n2
Höchstgeschwindigkeit: ca. 45 km/h
Spurweite: 1435 mm
Dienstmasse: 25 Tonnen (ohne Tender)
Länge (ohne Tender): 7550 mm
Kesseldruck: 6,5 Bar
Treibräder: 1264 mm
Konstruiert wurde sie nach amerikanischem Vorbild von John Haswell. Sie
war die 32. Lokomotive von 67, die von 1844 bis 1853 über die
Semmering-Passstraße von Gloggnitz nach Mürzzuschlag für die südliche
Staatsbahn transportiert wurde. Mit größter Wahrscheinlichkeit wurden
das Fahrgestell und der Kessel getrennt, mit Pferdefuhrwerken
überstellt. Da die Lokomotiven in Mürzzuschlag für die bereits 1844
fertig gestellte Strecke nach Graz erst betriebsfähig gemacht werden
mussten, war dies wohl die Geburtsstunde der Werkstätte in Mürzzuschlag.

ZWEIWEGEWALZE KAELBLE 6W - GLEISBETTUNGSWALZE
1941 mit der Fabriksnummer 8524 bei der Firma Kaelble aus
Backnang/Deutschland gebaut. Motor 15 PS, Type F 125e, Einsatz bei der
Gleisbaufirma Schmidt und Metzger
In den 1930er Jahren beginnt im Ausland eine Mechanisierung der
Gleisbaustellen. Da es damals, die heute bekannten großen
Gleisstopfmaschinen noch nicht gab, werden die Schwellen auf
vorbereitete Schotterbänder verlegt. Der Gleisschotter wird in
möglichst genauer Höhenlage mit Walzen verdichtet. Dazu sind vom
Straßenbau bereits bekannte Walzen notwendig. die aber
Eisenbahnzusatzräder bekommen, um die Gleisbaustellen erreichen zu
können.

MOTORBAHNWAGEN BM 20L
0BB Bauartnummer X 610, Rekonstruktion aus ÖBB BM 35. X. 616.005, Motor FB 20A
Die von den Steyr-Daimler-Puch Werken bei Kromag in Hirtenberg nach
1938 gebauten Bahnmeisterwagen bekommen bereits den, in Steyr
erzeugten, stärkeren FB 20A Motor und werden daher BM 20 oder BM 20L in
der längeren Version, genannt. Die meisten Wagen sind bei der
Auslieferung noch mit offenen Sitzbänken ausgestaltel und bekommen erst
später ein Stahltonnendach das auf Eckstehern aufgesetzt wird. Die
Stimwände sind, meist in Eigenregie der Bahnmeistereien, in den
verschiedensten Varianten mit Holzwänden verkleidet. Im Sommerbetrieb
können die Fenster entfernt werden. Seitlich gibt es Planen. Erst arm
Beginn der 1950er Jahre werden in den Werken Wörth geschlossene
Wagenkästen montiert

Die Drehscheibe
Eine Drehscheibe ist eine Einrichtung zum horizontalen Drehen von
Schienenfahrzeugen. Dieser Vorgang wurde vor allem bei Dampflokomotiven
mit Schlepptender durchgeführt, die nur in Vorwärtsrichtung mit ihrer
Höchstgeschwindigkeit fahren können.
In Mürzzuschlag gab es in der Vergangenheit bis zu drei Drehscheiben.
Die Baugeschichte der letzten verbliebenen Drehscheibe hängt mit dem
Rundlokschuppen zusammen. Die „Urform" stammt somit aus dem Ende des
19. Jahrhunderts. Auf der Maschinenkarte ist als Baujahr 1916 vermerkt.
Es ist anzunehmen, dass damals die Drehscheibe ausgetauscht wurde,
eventuell von einer kleinen Drehscheibe auf eine Größere. Für die
Bemessung der Drehscheibenlänge ist der Radstand der Fahrzeuge wichtig.
Damit die Drehung der Scheibe durch überstehende Spurkränze der Räder
nicht behindert wird, ferner um einen gewissen Spielraum beim Anhalten
der Fahrzeuge zu haben, wählt man die Fahrbahnlänge um 0,8 bis 1 Meter
größer als den längsten Radstand der in Betracht kommenden Fahrzeuge.
Die Länge der Mürzzuschlager Drehscheibe beträgt 20,04 Meter. Die
Drehscheibe gehört samt Rundlokschuppen und der Neuen Montierung mit
Schiebebühne zum technisch bedeutenden Ensemble am Bahnhof
Mürzzuschlag. Die gesamte Anlage steht seit 2007 unter Denkmalschutz
und befindet sich außerdem in der Kernzone des UNESCO Weltkulturerbes
Semmeringeisenbahn. Die Drehscheibe wurde 2021/2022 generalsaniert. Die
Drehscheibe in Mürzzuschlag ist eine Balancedrehscheibe. Die Brücke
wird auf dem sogenannten Königsstuhl balanciert und gedreht.
Eigengewicht: 45 t , Tragkraft: 180 t

INFOBLICK MÜRZZUSCHLAG
In Mürzzuschlag entsteht das Westportal des Semmering-Basistunnels.
Wenn der Tunnel in Betrieb geht, beginnt auch eine neue Zeitrechnung
für Mürzzuschlag und seinen Bahnhof. Das unter Denkmalschutz stehende
Gebäude erfährt eine Erneuerung, von der die zukünftigen Bahnkunden
immens profitieren: Ein helleres, freundlicheres Erscheinungsbild,
kürzere Wege und mehr Parkplätze sind nur einige der zahlreichen
Vorteile, die der Semmering-Basistunnel und der neue Bahnhof der Stadt
Mürzzuschlag bringen.

Die Baustelle Mürzzuschlag des
Semmering-Basistunnels ist Tunnelbaustelle, Gleisbaustelle und
Bahnhofsbaustelle in einem. Gebaut wird in Etappen an verschiedenen
Stellen - alles abgestimmt auf den Zugfahrplan. Die Baustelle umfasst
insgesamt 25 Hektar - das ist in etwa so viel wie 35 Fußballfelder. In
Mürzzuschlag wird das Westportal des Semmering-Basistunnels gebaut. Die
Besonderheit dieses Bauwerks ist seine Zweistöckigkeit: Während die
Züge aus dem Tunnel aus der unteren Etage ausfahren, können die Züge
der Semmering-Bergstrecke auf der oberen Ebene kreuzen. Das zukünftige
Portal wird rund 12 Meter tiefer liegen als der Bereich, den man im
Augenblick an dieser Stelle sieht. Vom Portal selbst wird nicht
bergmännisch gegraben. Die für das Portal notwendigen Tunnelmeter
werden in „offener Bauweise" errichtet.
Der sogenannte „Waltraud-Stollen" diente beim „Altprojekt"
Semmering-Basistunnel als Pilotstollen. Er wird auch beim aktuellen
Semmering-Basistunnel-Projekt als Bauhilfsmaßnahme zur Wasserhaltung
benötigt. Im Zuge der Bauarbeiten wird er wieder verfüllt. Die
Planungen der sichtbaren Bauwerke des Semmering-Basistunnels - so auch
das Portal und der Bahnhof Mürzzuschlag - wurden von einem sogenannten
Gestaltungsbeirat begleitet. Dieser legt, neben der grundsätzlichen
architektonischen Ausgestaltung auch die Beschaffenheit von Oberflächen
und Materialien fest. Im Musterpark werden einzelne Elemente - wie
Bahnsteigdächer und ähnliches - vorab gebaut, um ihre Eignung und ihre
Verträglichkeit für das Weltkulturerbe zu testen.
Derzeit muss der gesamte Bahnverkehr über den Semmering über die bald
200 Jahre alte Semmeringbahn geführt werden. Der Semmering-Basistunnel
wird die bestehende Bahnstrecke entlasten. Um den zusätzlichen
Zugverkehr durch den Semmering-Basistunnel im Bahnhofsbereich
Mürzzuschlag zukünftig abwickeln zu können, müssen die Gleisanlagen
ergänzt, erneuert oder adaptiert werden. Dafür sind
Unterbaukonstruktionen, wie zum Beispiel Rampen oder Entwässerungen
notwendig, aber auch der Oberbau also Schotter, Schwellen, Gleise und
Weichen müssen teilweise erneuert werden, damit die Züge schnell und
leise im Bahnhofsbereich ein- und ausfahren können.

Täglich sind tausende Züge auf Österreichs Bahnstrecken unterwegs. Um
die Strecken optimal zu nutzen, wird ein Fahrplan erstellt. Anhand
dessen wird der genaue Fahrweg eines Zugs programmiert und die dafür
notwendigen Signale und Weichen gestellt. Bevor die Fahrgäste am
Bahnhof einsteigen können, wird der Zug zusammengestellt. Dazu werden
die entsprechenden Waggons angekoppelt, dann gereinigt und einem
Sicherheitscheck unterzogen. Wenn der Zug dann losfährt und die
Fahrgäste sich entspannt zurücklehnen können, läuft die Arbeit im
Hintergrund so richtig an. Die Betriebsführungszentralen überwachen
alle Zugfahrten in Österreich. Per Computer werden die Weichen und
Signale gestellt. Aufgrund der langen Bremswege (ca. 1500 Meter) können
Züge nicht auf Sicht fahren. Deshalb teilen wir die Gleise in
Blockabschnitte ein. In jedem Blockabschnitt darf sich nur ein Zug
befinden. Baustellen werden bei der Fahrplanerstellung bereits viele
Jahre vorher berücksichtigt.
DER SEMMERING-BASISTUNNEL
In weniger als zwei Stunden mit dem Zug von Wien nach Graz: Der
Semmering-Basistunnel macht's möglich. Ab 2030 verbindet er das
niederösterreichische Gloggnitz mit dem steirischen Mürzzuschlag. Das
entlastet die historische Semmeringbahn und bringt Sie als Fahrgast
noch rascher an Ihr Ziel. Zudem wird der Gütertransport auf dieser
Strecke attraktiver: Selbst schwere Züge können den Tunnel mit einer
Lok passieren. Die 160 Jahre alte Semmeringbahn schlängelt sich
malerisch die bizarren Felsen entlang und führt über Viadukte und durch
kleinere Tunnel - zu ihrer Zeit eine technische Meisterleistung. Die
Lokomotiven haben jedoch große Mühe, die hohen Steigungen und engen
Kurvenradien zu überwinden. Der Semmering-Basistunnel entlastet und
ergänzt die bestehende Bergstrecke. Fahren die großen und schweren
Güterzüge nach 2030 erst einmal zum Großteil durch den Tunnel, kann die
malerische Bergstrecke vermehrt für Regionalfahrten oder touristische
Zwecke genutzt werden. Wenn der Bahntunnel gewartet wird, braucht man
die Strecke über den Berg jedenfalls in Zukunft weiter. Das eine kann
nicht ohne das andere existieren.

Wem der viele Text zu lange war und lieber Bewegtbilder mit Musik mag,
kann sich gerne dieses Video antun: