web steiner
Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen
Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.
+43/2624/54014 - office@websteiner.com
Technisches Museum Wien
TMW, April 2023
Das Technische Museum Wien, kurz TMW, befindet sich
an der Adresse Mariahilfer Straße 212 im 14. Wiener Gemeindebezirk
Penzing. Es zeigt Exponate und Modelle aus der Geschichte der Technik
unter besonderer Berücksichtigung des österreichischen Anteils an der
technologischen Entwicklung. Es verfügt über zahlreiche historische
Demonstrationsmodelle, etwa aus dem Bereich der Eisenbahn, des
Schiffbaus, der Luftfahrt und der Industrie. Herausragend sind dabei
die funktionsfähigen Dampfmaschinen. Weiters ist im TMW eine der
größten Sammlungen historischer Musikinstrumente in Österreich
untergebracht. Dem Museum angegliedert ist die Österreichische
Mediathek.
* * *
Im Auftrag der Südbahn entstanden 1873 in der Lokomotivfabrik von Georg
Sigl in Wiener Neustadt zwei Schnellzug-Lokomotiven der Achsfolge 2'B,
mit Außenrahmen und niedriger Kessellage. Die „Rittinger", benannt nach
dem Montanisten Peter von Rittinger, galt auf der Wiener
Weltausstellung als eine der besten Schnellzuglokomotiven der Zeit, die
für drei Jahrzehnte ein Vorbild blieb. Versehen mit einem Kamper'schen Laufgestell, bei dem das Drehgestell
durch Stangen gezogen wurde, entstand 1883 nach dem Beispiel der
„Rittinger" für die Kronprinz Rudolf-Bahn die Lokomotive AR 254. Nach
der Verstaatlichung erhielt sie bis zur Außerdienststellung 1926 die
Reihenbezeichnung 1.20. Entsprechend einer damals beliebten musealen Vermittlungsmethode
erfolgte ihre Umgestaltung durch Lehrlinge der Hauptwerkstätte Linz zu
einer Schnittlokomotive für den Vorführbetrieb im Eisenbahnmuseum.
Angetrieben von einem Elektromotor zeigt sie anschaulich die
Funktionsweise einer Dampflokomotive in langsamer Bewegung.
Schnellzug-Dampflokomotive KRB AR 254 bzw. k.k.St.B. 1.20
Hersteller Lokomotivfabrik Floridsdorf, Baujahr 1883, Bauart 2'B-n2,
Gewicht 35,3 Tonnen (ungeschnitten), Länge 8,7 Meter
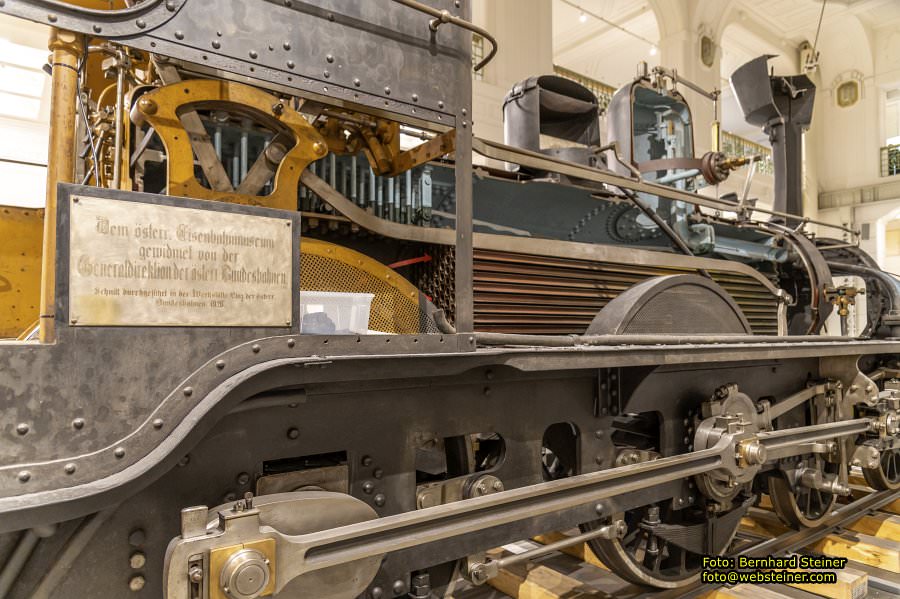
Dampflokomotive Rocket
Lokomotivfabrik Robert Stephenson & Co., Newcastle upon Tyne, 1829
Modell 1:20, hergestellt von Lokomotivführer Rudolf Kraus, 1953

Erste Dampflokomotive der Welt
Richard Trevithick, England, 1802
Modell 1:20, hergestellt von Josef König, 1952
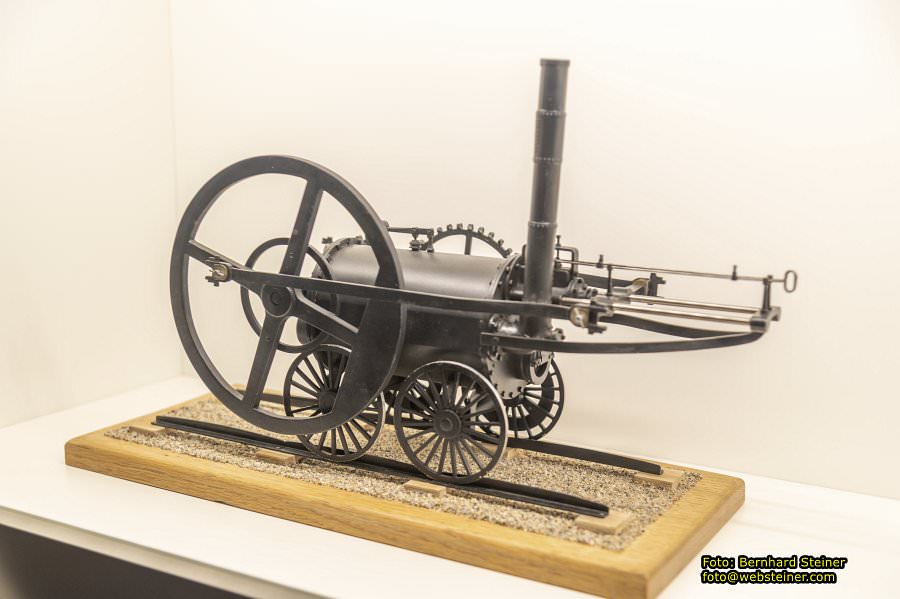
Dritter Wiener Südbahnhof 1957-2009
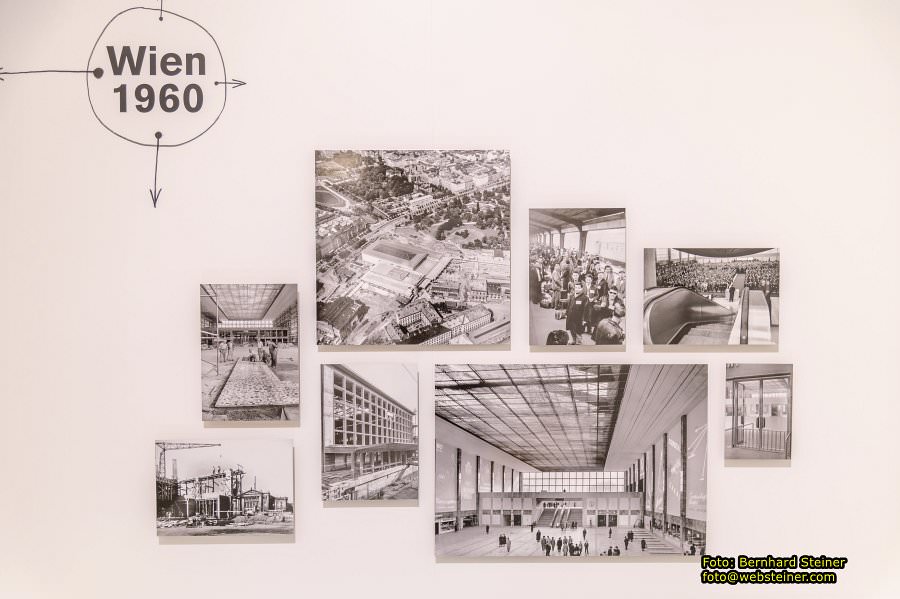
Hauptbahnhof Wien, Modell 1:500, hergestellt von Modellwerkstatt
Gerhard Stoker, 2007

Personenwagen 2. Klasse für den Sommerbetrieb
Länge: 4,9 m, Gewicht: 3,7 t, 24 Sitzplätze - Maschinen- und
Waggonbaufabrik Johann Spiering, Wien, 1855
Der Abschnitt der Pferdeeisenbahn zwischen Linz vnd Gmunden wurde 1854
auf Dampfbetrieb umgestellt. Obwohl laut Gesetz die Wagen der 2. Klasse
geschlossen ausgeführt sein sollten, durften im Sommerbetrieb auch
Wagen ohne Fenster fahren. 1859 übernahm die Westbahn die Strecke und
befuhr nur mehr den Abschnitt zwischen Lambach und Gmunden. Mit dem
Umbau auf Normalspur im Jahr 1903 verloren die alten Wagen ihre
Funktion.

Ford T Roadster
Wassergekühlter Viertakt-Vierzylinder-Reihenmotor mit 2.900 cm³ und 20
PS (15 KW), Serien-Nr. 9 791 677
Ford Motor Company, Detroit, 1924
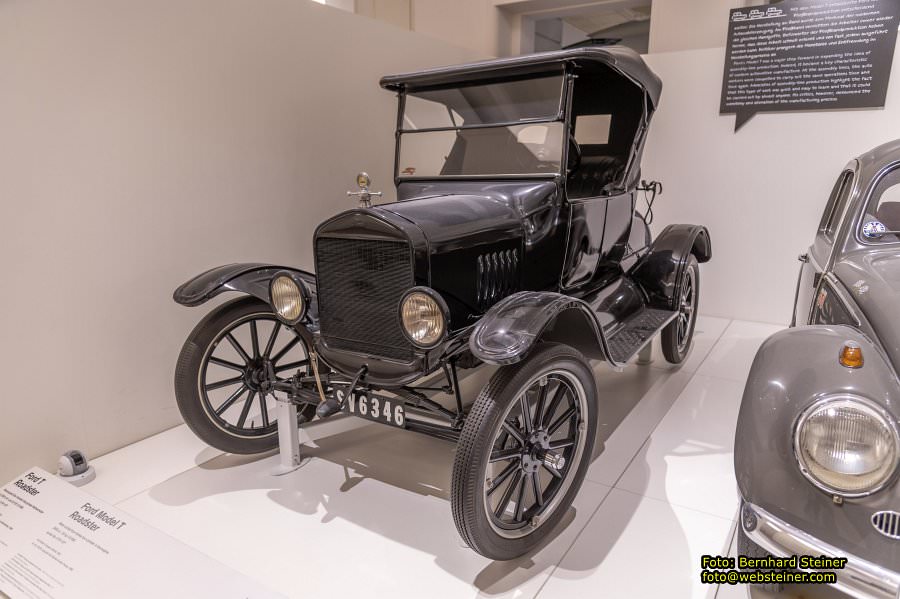
Steyr XXX (30) Standard Cabriolet
Wassergekühlter Viertakt-Sechszylinder-Reihenmotor mit 2.078 cm³ und 40
PS (29 KW), Höchstgeschwindigkeit: 90 km/h, Benzinverbrauch: 12-14
l/100 km
Steyr-Werke AG, Steyr, 1930

Steyr 55 »Baby«
Wassergekühlter Viertakt-Vierzylinder-Boxermotor mit 1.158 cm³ und 25,5
PS (19 KW), Höchstgeschwindigkeit: ca. 95 km/h, Benzinverbrauch: 7-8
l/100 km
Steyr-Daimler-Puch AG, Steyr, 1938

Steyr 220 Cabriolet
Wassergekühlter Viertakt-Sechszylinder-Reihenmotor mit 2.260 cm³ und 55
PS (40 KW), Höchstgeschwindigkeit: 120 km/h, Benzinverbrauch: ca. 14
l/100 km
Steyr-Daimler-Puch AG, Steyr, 1938

Motorrad Laurin & Klement B-Z-N
Viertakt-Einzylindermotor mit 353 cm³ und 3 PS (2KW),
Höchstgeschwindigkeit: ca. 50 km/h
Laurin & Klement, Mladá Boleslav (Jungbunzlau), 1905

Steyr-Waffenrad Modell 97
Waffenfabrik Steyr, Steyr, 1912

Motorrad Puch 5 HP mit Beiwagen
Viertakt-Zweizylindermotor mit 730 cm³ und 5 PS (4 KW),
Höchstgeschwindigkeit mit Beiwagen: ca. 50 km/h Johann Puch &
Company, Graz, 1907/1908

Mercedes-Benz W 196 „Silberpfeil" mit Stromlinienkarosserie
Achtzylinder-Reihenmotor mit 2.496 cm³ Hubraum und 280 PS (206 KW),
Höchstgeschwindigkeit: 290 km/h Daimler-Benz AG, Stuttgart, 1954-1955
Legendär war die „Giftbrühe" getaufte Benzinmischung des Mercedes-Benz
W 196, die mit der damals hochmodernen Direkteinspritzung in den Motor
gelangte. Das Kraftstoffgemisch bestand neben Benzin auch aus Benzol,
Methanol, Azeton und dem giftigen Nitrobenzol. 40 Liter verbrauchte der
Silberpfeil auf 100 Kilometer. Da das gesundheitsschädliche Gemisch
auch die Leitungen des Fahrzeugs angriff, musste regelmäßig mit
normalem Benzin nachgespült werden.

Elektrischer Phaéton, System Lohner-Porsche, Modell Nr. 27
Innenpolmotoren in den Vorderrädern mit je 2,5 PS (2 KW),
Geschwindigkeit: ca. 32 km/h
Jacob Lohner & Co., Wien, 1900-1902
Ab 1897 stellte die Wiener Hofwagenfabrik Jacob Lohner & Co.
Automobile her. An der Entwicklung der Elektromobile System
Egger-Lohner war der junge Ferdinand Porsche, ein Angestellter Béla
Eggers, beteiligt. 1899 beschloss Lohner, Porsches Idee eines
Radnabenmotors aufzugreifen, und kündigte Egger die Zusammenarbeit. Der
Lohner-Porsche wurde 1900 auf der Pariser Weltausstellung als „erster
transmissionsloser Wagen der Welt" ausgezeichnet. Es war gleichsam der
„erste Porsche der Welt".

Flughafen Wien-Schwechat
Ab 1954 übernahm der 1938 für die Luftwaffe errichtete Flughafen
Schwechat die Rolle des zivilen Hauptstadtflughafens. Der Bau des
Flughafengebäudes (1960) und einer zweiten Start- und Landebahn (1977)
waren wichtige Ausbauschritte. Später folgten immer größere Terminals,
Hotels, Bürogebäude und ein 109 Meter hoher Tower. Die Anbindung an die
Ostautobahn (1982) und den Eisenbahnfernverkehr (2014) machten den
Flughafen Wien zu einem intermodalen Knotenpunkt und zum größten
regionalen Arbeitgeber. Die unterschiedlichen Bauabschnitte der
ständigen Erweiterung sind an den Modellen (Bauzustand 1960 und 2013)
sichtbar.


Die Donau-Dampfschifffahrts-Gesellschaft
Im Jahr 1880, 50 Jahre nach ihrer Gründung, war die
Donau-Dampfschifffahrts-Gesellschaft (DDSG) die größte
Binnenschifffahrtsgesellschaft der Welt. Ihre Flotte umfasste zu dieser
Zeit über 200 Dampfschiffe und etwa 1.000 Güterkähne. 1910 beschäftigte
sie 11.000 Menschen. Nach dem Ersten Weltkrieg reduzierte sich der
Flottenbestand auf ein Drittel. 1955 musste die DDSG infolge der
Staatsvertragsbestimmungen über 60 Prozent ihrer Schiffe an die
damalige Sowjetunion abtreten. In den 1990er Jahren wurde die
staatliche DDSG trotz vorangegangener Rationalisierungsmaßnahmen
zerschlagen. Die Streichung aus dem Firmenbuch erfolgte am 31. Dezember
2003.
Motorfahrgastboot Kriemhild, Modell 1:50
Länge: 21,5 m, Breite: 3,75 m, Dieselmotoren mit 2*150 PS (2*112 kW)
Schiffswerft der DDSG in Korneuburg, 1957
Motorfahrgastschiff Prinz Eugen, Modell 1:50
Länge: 63,4 m, Breite: 9,88 m, Dieselmotoren mit 2*441 PS (2*325 kW), 2
Beckerruder, 1 Bugstrahlruder Österreichische Schiffswerften AG
(ÖSWAG), Linz, 1987
Motorfahrgastboot Vindobona, Modell 1:50
Länge: 40,2 m, Breite: 8,5 m, Dieselmotoren mit 2*365 PS (2*272 kW), 2
Propeller, 1 Bugstrahlruder
Österreichische Schiffswerften AG (ÖSWAG), Linz, 1979

Der Wiener Klavierbau um 1800
Die Herstellung von Klavieren war um 1800 auf bestimmte Wiener Bezirke
konzentriert. Der Bezirk Mariahilf (heute VI. Bezirk) wies die meisten
Wohn- und Arbeitsstätten von Klavierbauern auf. Hier wirkten bedeutende
Klaviermacher wie Anton Walter oder Ignatz Kober. Zahlreiche
Klavierbauwerkstätten gab es auch in den beiden angrenzenden Bezirken
Wieden (heute IV. Bezirk) und Neubau (heute VII. Bezirk). Conrad Graf
hatte seine Klavierfabrik in Wieden gleich neben der Karlskirche. Die
Familie Stein-Streicher lebte und wirkte im Bezirk Landstraße (heute
III. Bezirk), und Ignaz Bösendorfer gründete seine Werkstatt in der
Josefstadt (heute VIII. Bezirk). Vor allem die Ansammlung zahlreicher
Klavierbauer in Mariahilf hatte positive wie negative Auswirkungen auf
die Entwicklung der einzelnen Werkstätten. Einerseits waren sämtliche
Zulieferer von Einzelteilen zur Hand und eine Aushilfe von Arbeitern
wie ein Austausch von Wissen leicht möglich. Andererseits muss der
Konkurrenzdruck auf empfindliche Weise spürbar gewesen sein.

Um den schnell verhallenden Klang des Hammerklaviers zu verlängern und
zu modifizieren, war es zu Beginn des 19. Jahrhunderts beliebt,
Instrumente mit durchschlagenden Zungen und Klaviere zu kombinieren.
Wie die Hammerklaviere waren diese Instrumente zu stufenlosen
dynamischen Übergängen fähig. Solche Kombinationsinstrumente eigneten
sich besonders für das Spiel von Orchestermusikbearbeitungen. Das
ausgestellte Instrument war ursprünglich nur ein Hammerflügel und wurde
ca. 1845 nachträglich von Jakob Deutschmann mit einer „Physharmonika"
ausgestattet, die sich direkt unter den Tasten befindet. Hammerflügel
und Physharmonika können durch vier Handzüge für C1 bis e' und f¹ bis g
getrennt ein- oder ausgeschaltet werden. André Stein (1776-1842), der
Erbauer des Hammerflügels, führte ab 1802 eine eigene
Klavierbauwerkstatt. Jakob Deutschmann (1795-1853) war einer der
bekanntesten Wiener Orgelbauer seiner Zeit.
Hammerflügel mit eingebauter Physharmonika
Hersteller André Stein, Wien, Entstehungszeit ca. 1830, Umbau Jakob
Deutschmann, Wien, ca. 1845

Der aufrechte Hammerflügel in der dekorativen Form einer Pyramide wurde
1745 von dem Instrumentenmacher Christian Ernst Friederici (1709-1780)
in Gera erfunden. Diese Art des Hammerklaviers wurde bis ins 19.
Jahrhundert in etwas veränderter Form auch in Wiener
Klavierbauwerkstätten hergestellt. Michael Rosenberger (1766-1832) war ein einfallsreicher Klavierbauer,
der sowohl um die Verbesserung bestehender Instrumente bemüht war als
auch neue Instrumente mit wohlklingenden Namen wie
„Harmoniefortepiano", „Pianoforte d'amour" oder „Polyharmonikon"
erfand. Meist handelte es sich um Kombinationsinstrumente aus Klavier
und Orgel mit Zungenstimmen. Das Exponat verfügt über eine
außergewöhnliche, von Rosenberger eigens für den Pyramidenflügel
erfundene Mechanik.
Pyramidenflügel - Hersteller Michael Rosenberger, Wien, Entstehungszeit
ca. 1820
Umfang: F₁ bis f4, durchgängig zweichörig. Schubzungenmechanik, drei
Pedale für Piano, Verschiebung und Dämpferaufhebung.

Das Instrument mit Opusnummer 43791 mit altdeutscher Gehäuseform stellt
den Vorläufer der pneumatisch betriebenen Reproduktionsklaviere dar.
Der Spielapparat von Adalbert Endrés (Berlin) trägt die Nummer 463 und
wurde auch in andere Pianinos der Zeit eingebaut. Er arbeitet mit
dicken, gelochten Kartonbändern ähnlich einer elektrischen
Schreibmaschine: trifft ein Loch auf den Abtastmechanismus, so wird ein
ankerförmiges Hebeglied auf eine ständig rotierende, befilzte Walze
gedrückt, von ihr mit gerissen und schlägt mittels eines „Stechers"
(ein Holzstäbchen) den Hammer auf die Saite. Die Walze ist zur
Kraftverstärkung notwendig, da die Abtasthebelchen zu wenig Energie
hätten, den Klavierhammer zu betätigen. Die Walze sowie der
Transportmechanismus des Kartonstreifens werden gemeinsam über eine
Handkurbel angetrieben. Eine dynamische Abstufung des Klavierklangs wie
später bei den Reproduktionsklavieren ist nicht möglich. Nur wenige
Jahre später wurden diese mechanisch betriebenen Selbstspielinstrumente
von pneumatischen Apparaten abgelöst.
Pianino mit mechanischem Selbstspielmechanismus
Hersteller Blüthner, Herstellungsort Leipzig, Entstehungszeit 1895

Das tastenlose Reproduktionsklavier war das erste Instrument, das Welte
in seiner Produktserie „Mignon" herausbrachte (das Patent zur
dynamischen Steuerung stammt von 1904). Es enthält einen normalen
Klavierrasten mit Saiten und eine entsprechend angepasste Mechanik, die
nur von der Pneumatik (Tasten gibt es ja keine) betätigt wird. Der
Aufbau der Windlade und der übrigen pneumatischen Teile ist im
Wesentlichen derselbe wie bei den anderen Reproduktionsinstrumenten von
Welte.
Welte Mignon Cabinett
Hersteller (Klavierteil) H. Feurich, Leipzig, Hersteller
(Reproduktionsapparat) M. Welte & Söhne, Freiburg, Entstehungszeit
ca. 1914

Die beim Bau von Orchestrien angewandte Technik, mehrere Instrumente in
einem Gehäuse mit einem Steuerungsmechanismus anzuspielen, setzte man
zu Beginn des 20. Jahrhunderts auch ein, um die „klassische"
Kombination von Klavier und Geige automatisiert zum Klingen zu bringen.
Die Technik zur Ansteuerung des Klaviers war bekannt, für den
Geigenteil musste man noch eine geeignete Lösung finden.
Um 1913 begann die Firma Gebrüder Weber damit, Violinpfeifen (die
bereits aus der Produktion von Straßenorgeln bekannt waren) in
Reproduktionsklaviere einzubauen. Das Konzept, Geigen mit Violinpfeifen
zu imitieren, ergibt robuste und langlebige Instrumente. Die
Notenrollen waren für ihre gelungenen Arrangements bekannt.
Weber „Unica"
Hersteller Gebr. Weber GmbH, Waldkirch (Deutschland), Entstehungszeit
ca. 1915

Die beim Bau von Orchestrien angewandte Technik, mehrere Instrumente in
einem Gehäuse mit einem Steuerungsmechanismus anzu-spielen, setzte man
zu Beginn des 20. Jahrhunderts auch ein, um die „klassische"
Kombination von Klavier und Geige automatisiert zum Klingen zu bringen.
Die Technik zur Ansteuerung des Klaviers war bekannt, für den
Geigenteil musste man noch eine geeignete Lösung finden.
Die Firma Hupfeld erfand 1907 eine als „8. Weltwunder" bezeichnete
Vorrichtung zum Automatisieren des Geigenspiels: Das Anstreichen dreier
Geigen (jede mit nur einer aktiven Saite) erfolgt über einen Rundbogen,
gegen den sie mittels eines Balges gedrückt werden. Die Töne werden
über ebenfalls balggesteuerte „Finger" auf den Saiten abgegriffen. Die
Steuerung erfolgt gemeinsam mit der Klaviersteuerung über einen
Lochstreifen.
Hupfeld „Phonoliszt Violina"
Hersteller L. Hupfeld Hersteller (Klavier) Rönisch, Herstellungsort
Leipzig, Entstehungszeit ca. 1914

Um 1885 kamen die ersten „Symphonion"-Spielwerke auf den Markt. Bis in
die späten 1920er Jahre war eine breite Palette unterschiedlicher
Bauarten dieses Typs erhältlich, die alle nach demselben Prinzip
funktionieren. Über eine Reihe von Mitnehmern, die auf einer
rotierenden Scheibe eingestanzt waren, wurden mit Hilfe eines
zwischengeschalteten Zahnrades Stahlzinken angerissen und so zum
Schwingen gebracht. Daher ähnelt der Ton jenem einer Spieldose. Die
Scheiben lassen sich auswechseln. Das Angebot an verschiedenen Titeln
war groß.
Das Symphonion „Eroica" hat drei synchron rotierende Scheiben. Es
arbeitet daher mit dreimal so vielen Tönen wie einscheibige
Instrumente, erzeugt einen dementsprechend vollen Ton und erlaubt
vielfältige Arrangements. Die Spieldauer beträgt ca. eine Minute. Das
Instrument hat Federantrieb und einen Münzeinwurf, über den es
gestartet werden kann.
Symphonion „Eroica"
Hersteller Symphonion Musikwerke, Leipzig, Entstehungszeit ca. 1900

Die Werkstatt des Geigenbauers
In der Werkstatt eines Geigenbauers werden verschiedene Arten von
Streichinstrumenten hergestellt. Neben Geige (Violine) und Bratsche
(Viola) handelt es sich dabei vor allem um Violoncello und Kontrabass.
Einen weiteren Tätigkeitsbereich stellt die Instandhaltung und
Reparatur von Streichinstrumenten dar, die als Gebrauchsgegenstände
beträchtlicher Abnutzung ausgesetzt sind. Zu Beginn des 19.
Jahrhunderts spezialisierten sich einige Geigenmacher auf den Bau von
Gitarren und anderen Zupfinstrumenten. Um diese Zeit entstand auch der
Berufszweig der Bogenbauer, von denen nunmehr die Herstellung der
Streichbögen besorgt wurde. Werkzeuge und Utensilien des Geigenbauers
dienen in erster Linie der Holzbearbeitung. Sie haben sich bis heute
kaum verändert. Die Einrichtung der Historischen Werkstatt aus dem 19.
Jahrhundert stammt von den Wiener Geigenbauern Bernhard Enzensperger,
Alfred Coletti sowie Franz Geissenhof.

Größere Kirchen verfügen meist über Orgeln mit mehreren Manualen und
einem Pedal. Solche Instrumente sind oft spezifisch an Kirchenbauten
angepasst. Diese Orgel wurde für die kaiserliche Hofburgkapelle in Wien
gebaut. Ihre außergewöhnliche Gehäuseform entspricht dem dort zur
Verfügung stehenden Raum. Anton Bruckner war Organist an diesem
Instrument. Der Erbauer, Carl Friedrich Ferdinand Buckow (1801-1864),
war ein typischer Vertreter der Orgelromantik. Die Disposition zeigt
deutlich das Charakteristikum romantischer Orgeln, Orchesterstimmen zu
imitieren: Zahlreiche Register sind nach Streich- oder anderen
Orchesterinstrumenten benannt. Die vielen Register in 8'- und 4'-Lage
erlauben vielfältige dynamische Abstufungen. Das Instrument wurde ohne
Gehäuseoberteil und ohne Prospektpfeifen an das Technische Museum Wien
übergeben. Der fehlende Teil wurde nach der Originalzeichnung von
Buckow und einer Fotografie der Vorderseite rekonstruiert.
Orgel der Hofburgkapelle
Hersteller Carl Friedrich Ferdinand Buckow, Hirschberg, Entstehungszeit
1862, Opusnummer 53
Gehäuserekonstruktion Johann Waldbauer, Restaurator und Vergolder,
Furth bei Göttweig

Reproduktionsvorsetzer gibt es seit dem späten 19. Jahrhundert.
Die
Klaviertasten werden von einer Apparatur angeschlagen, die automatisch
gesteuert wird. Der wirkliche Durchbruch gelang durch die pneumatische
Steuerung mittels Saugluft und mit gelochten Papierstreifen als
Datenträger. Diese Geräte reproduzieren mit zum Teil erstaunlicher
Qualität das Spiel von Pianisten des beginnenden 20. Jahrhunderts. Im
Gegensatz zu den sehr beliebten selbstspielenden Klavieren von
Hupfeld ermöglichte es der Einsatz eines Vorsetzers, ein bereits
vorhandenes, "normales" Klavier weiterzuverwenden.
Vorsetzer Duo Phonola
Hersteller Ludwig Hupfeld Aktiengesellschaft, Herstellungsort Leipzig,
Entstehungszeit 1920
Mit diesem Konzertflügel wurde in Wien der Schritt zum modernen
Klavierbau vollzogen. Den Saitenzug trägt nicht mehr ein hölzernes
Gehäuse, sondern ein Gusseisenrahmen. Die Basssaiten kreuzen die
übrigen Saiten, wodurch sie ohne Vergrößerung des Gehäuses zusätzliche
Länge gewinnen. Die „Schraubenstimmung" dieses Instruments sollte seine
Stimmhaltung verbessern und eine leichtere Handhabung beim Stimmen
ermöglichen. Sie wurde vom technischen Direktor Bösendorfers, Franz
Berger, entwickelt und 1884 patentiert, hat sich aber nicht nachhaltig
durchgesetzt. Die hier verwendete Mechanik stellt eine einfache Weiterentwicklung der
englischen Flügelmechanik dar, die in ähnlicher Form auch von Johann
Baptist Streicher gebaut wurde.
Konzertflügel
Hersteller Ludwig Bösendorfer, Wien, Entstehungszeit ca. 1885
Umfang: As bis c°, von A bis F. einchörig, von Fis: bis Cis zweichörig,
von D bis c' dreichörig, kreuzsaitig.
Stoßzungenmechanik mit doppelter Auslösung, zwei Pedale für
Verschiebung und Dämpferaufhebung, Schraubenstimmung.

Selbstspielende Orgeln
Kleine Orgeln waren die ersten Instrumente, die man zu Musikautomaten
umrüstete. Meist als „Flötenwerk" bezeichnet, enthielten sie eine
Walze, deren Stifte mittels eines fingerförmigen Mechanismus abgetastet
wurden. Bereits im 17. Jahrhundert gab es selbstspielende Orgeln mit
großem Tonumfang und mehreren Registern bzw. Pfeifenreihen.
Ausgestattet mit Feder- oder Gewichtsantrieb waren sie in Uhren (sie
spielten meist zur vollen Stunde), Schränken und anderen Möbelstücken
eingebaut. Die Walzen enthielten entweder mehrere Musikstücke oder
konnten gewechselt werden. Im 19. Jahrhundert kam es zur Hochblüte der
Straßendrehorgeln, die es in kleineren und größeren Bauarten gab. Sie
konnten präziser und mit größerer Lautstärke spielen. Manche waren mit
Schlaginstrumenten und mit überladenen Verzierungen ausgestattet
(„Orchestrion"). Gelegentlich sind sie heute noch zu hören. Um die
Jahrhundertwende setzte sich die Steuerung mit Druckluft und gelochten
Papier- oder Kartonbändern durch. Sie ermöglichte das Spielen nahezu
beliebig langer Musikstücke.
Diese (wegen ihrer Bemalung auch als „Weißfassaden-Orchestrien"
bezeichneten) Instrumente waren für den Einsatz im Freien gedacht. Mit
relativ wenig Pfeifen erzeugen sie einen intensiven Klang. Sie wurden
in beachtlichen Stückzahlen gefertigt und von den großen Herstellern
(z. B. Bruder, Ruth, Gavioli, Limonaire) in unterschiedlichen Modellen
über Kataloge angeboten. Mit der Einführung von Kartonbändern als
Datenträgern konnte auf den Instrumenten ein großes Repertoire an
Musikstücken gespielt werden. Üblicherweise sind die Stücke mit
Melodie, Gegenmelodie, Bass und Schlaginstrumenten gesetzt. Auch dieses
Instrument folgt den üblichen Bauprinzipien: Die Melodie wird mit
Gedeckt 8', Viola 8', Oktave 4' und Mixtur gespielt, die Gegenmelodie
mit Trompete 8' und Cello 4'. Im Bass gibt es fünf Bombardon-Pfeifen.
Kleine und große Trommel und Becken ergänzen den Bestand. Laut Katalog
der Firma Wilhelm Bruder Söhne handelt es sich um das Modell 77 mit 40
Tonstufen.
„Starkton-Notenorgel"
Hersteller Wilhelm Bruder Söhne, Waldkirch (Deutschland),
Entstehungszeit ca. 1910, Opusnummer 3757


Zeigertelegraf, Streckensignalgerät, Wien (A), seit 1850

Zeigertelegraf, Streckensignalgerät, M. Hipp, Neuenburg (CH), seit 1860

Poststallschild, K.k. Poststall Golling (A), um 1850
Coupé-Landauer, Achtsitzige Postkutsche, Wagenfabrik Josef Rohrbacher,
Wien (A), 1894


Im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts öffnete sich der
Telegrafendienst für Frauen - wenn auch zu anderen Konditionen als für
ihre männlichen Kollegen. Inspiriert durch internationale Vorbilder und
befeuert durch die Konkurrenz, wurden Frauen beim österreichischen
Staatstelegrafen zu einem weitaus geringeren Lohn eingestellt. Man ging
nicht von einem existenzsichernden Einkommen aus, da nur unverheiratete
Frauen oder kinderlose Witwen eines Staatsdieners angestellt wurden,
die grundsätzlich als versorgt galten. Obwohl Frauen die gleichen
Pflichten wie Männer übernahmen, hatten sie im Gegensatz zu diesen
keinen Pensionsanspruch und waren jederzeit kurzfristig kündbar. In den
wenig später eingerichteten Telefonzentralen waren ausschließlich
Frauen für Vermittlungsdienste zuständig: Sie fragten nach der
Verbindung und stellten diese mechanisch her. Später übernahmen sie
auch Weck- und Informationsdienste. Die Arbeit galt als anspruchslos,
war aber aufgrund des hohen Lärmpegels, der schlechten Luft und der
ständigen Kontrolle sehr belastend. Bis zum Einsatz automatischer
Vermittlungstechnik hatte sich die Bezeichnung „Fräulein vom Amt"
etabliert und damit die weibliche Stimme als dienstbarer Geist
gesellschaftlich eingeschrieben.
Weibliche Stimmen übernehmen auch heute Serviceaufgaben im technischen
Bereich: Sprachgesteuerten und internetbasierten Assistenten wie Siri,
Cortana oder Alexa wird eine weibliche Identität verpasst. Wenn auch im
Hintergrund eine Maschine steht, so nimmt sie ihre Aufträge mit einer
weiblichen Stimme entgegen, baut Telefonverbindungen auf und
organisiert Termine - wie eine persönliche Sekretärin, von der keine
Widerrede erwartet wird. Obwohl argumentiert wird, dass Nutzerinnen und
Nutzer die weibliche Stimme als angenehmer empfinden, stellt sich die
Frage, ob hier nicht ein Rollenbild weitergetragen wird, das wir
eigentlich überwinden wollen. Im 19. Jahrhundert wurden Frauen in
großer Zahl in die Arbeitswelt eingegliedert und erlangten durch das
eigene Einkommen persönliche Unabhängigkeit. In Maßen zumindest, denn
sie erhielten - etwa als Telegrafistinnen im Staatsdienst - kaum mehr
als den halben Lohn ihrer männlichen Kollegen für die gleiche Arbeit.
Nach der Jahrhundertwende werden durch die Firma von Robert B. Jentzsch
an öffentlichen Orten Telephonautomaten errichtet. Der erste
Münzfernsprecher für 20 Heller-Münzen geht 1903 am Wiener Südbahnhof in
Betrieb. Die Sprechzeit ist - wie bei privaten Anschlüssen - auf drei
Minuten begrenzt. Ab 1907 propagiert die Telephonautomaten-Gesellschaft
den Kaffeehausautomaten, bei dem ein Anruf nur 10 Heller kostet.
Ein Geschäfts- oder Wohnungsanschluß ist nicht nur wegen der hohen
Errichtungskosten nach wie vor sehr kostspielig. In der Tarifklasse A
zahlt man für höchstens 12.000 Gespräche jährlich zwischen 180 und 500
Kronen an Gebühren - je nach Größe des Netzes, dem man angehört. Um das
Telefon auch in weniger begüterten Kreisen zu verbreiten, wird das
Gesellschaftsanschluß-System mit billigeren Halb-und Viertelanschlüssen
eingerichtet. Doch bleibt das Telefon Luxus. Selbst in der billigsten
Klasse der Viertelanschlüsse zahlt man für 1.200 Gespräche pro Jahr 50
bis 100 Kronen.
Telefonzelle, Telephonautomaten-Gesellschaft m.b.H., Wien, um 1925

1876 meldet Alexander G. Bell in Boston ein Patent für ein
Telefonsystem an, das auf folgendem Prinzip beruht: Im Sendegerät
versetzen Schallwellen der gesprochenen Sprache ein Metallplättchen in
Schwingung. Das Schwingen erzeugt in einer Spule Wechselstrom, der über
eine Drahtleitung übertragen wird. Am Empfangsgerät lassen die
Stromimpulse ihrerseits ein Metallplättchen schwingen, wodurch die
Worte wieder hörbar werden. Nach ersten Vorführungen hierzulande in Innsbruck und Wien sucht eine
private Wiener Gesellschaft um eine Telefonkonzession an. 1881 ergeht
seitens des Handelsministeriums die Konzession zur Herstellung und zum
Betrieb von Telephonleitungen im Umkreis von 15 Kilometern um den
Stephansdom. Vom Telegrafenbauer Otto Schäffler wird eine für 500
Anschlüsse konzipierte Telefonzentrale eingerichtet. In einer
Zeitungsanzeige erscheint eine Liste mit den Namen der ersten 154
Abonnenten; es sind dies fast ausschließlich Industrielle, Bankiers und
Journalisten.
Postbetrieb
Im 19. Jh. wird die staatliche Post zum zentralen Träger des
öffentlichen Nachrichtenverkehrs. Sie nutzt Eisenbahnen und
Dampfschiffe zum Transport von Postsendungen und übernimmt um 1860 den
Telegrafenbetrieb, der eine rasche, wenn auch teure
Nachrichtenübermittlung erlaubt. Für Eilnachrichten errichtet sie in
Wien ein unterirdisches Netzwerk: die Rohrpost. Um 1900 übernimmt sie
schließlich auch den Telefonbetrieb. Postämter bieten zudem neue Dienstleistungen wie den Zahlungsverkehr
durch Postanweisungen an. Postsendungen nehmen jährlich um Millionen
zu, darunter Korrespondenzkarten und bunt bedruckte Bildpostkarten.
Dies zieht eine Automatisierung der Bearbeitungs- und
Beförderungsmethoden in den Großstädten nach sich. In Postzentralen
arbeiten um 1910 elektrische Stempelmaschinen, automatische Paketwaagen
oder Briefmarken- und Kartenautomaten. Pakettransporte zwischen Postamt
und Bahnhof werden probeweise mit Benzin- oder Elektrobussen
durchgeführt.

Rohrpost
Zur Entlastung des innerstädtischen Nachrichtenverkehrs entstehen im
späten 19. Jh. in Metropolen wie London, Berlin, Paris und Wien
unterirdische, vom dichten Straßenverkehr unabhängige
Rohrpostnetzwerke. Postämter und Telegrafenzentralen werden durch
Rohrleitungen verbunden, in denen Briefe und Telegramme in
Metallpatronen (Pistons) mittels Luftdruck befördert werden. Für
pneumatische Briefe stehen in Wien hunderte rote Briefkästen und
dutzende Aufgabestellen in Post- und Telegrafenämtern zur Verfügung.

1913 gibt es in Wien über 50 Rohrpoststellen, die untereinander mit
einem Rohrnetz von rund 82 Kilometer Länge verbunden sind. Befördert
werden die Rohrpostbriefe in Zügen aus mehreren, aneinandergehängten
Pistons. Diese durchlaufen die Rohrleitungen bis zu den Zwischen- oder
Endstationen in diversen Ämtern, wo man die Briefe entnimmt, sortiert
und an die Empfänger zustellen läßt.

Piston, Rohrpostbehälter, Wien (A), um 1900

Rohrpoststation, System Felbinger, Schultz & Goebel, Wien (A), 1890
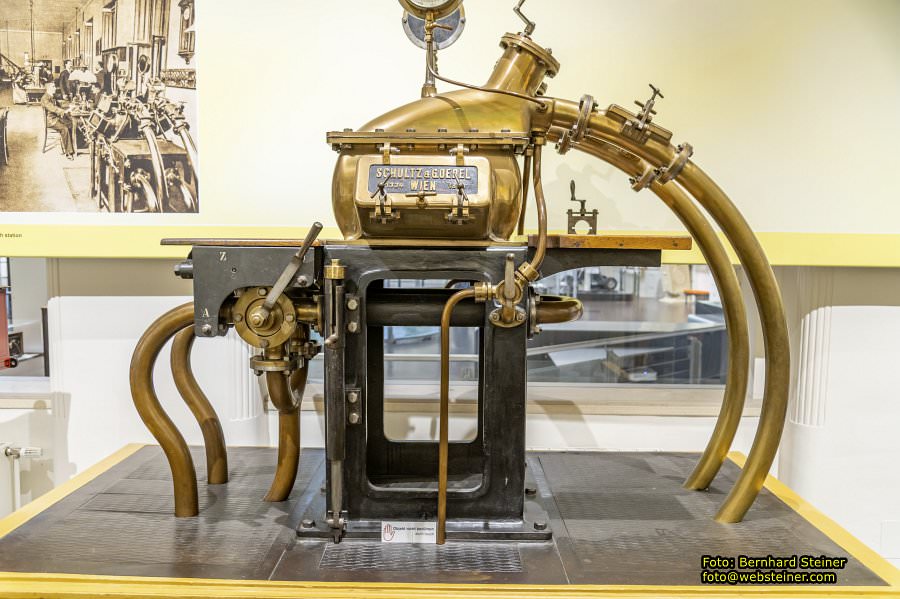
Enigma, Verschlüsselungsmaschine, Chiffriermaschinen AG, Berlin (D), um
1938

Siemens 1000 S, Femschreiber, Siemens, Deutschland, um 1985
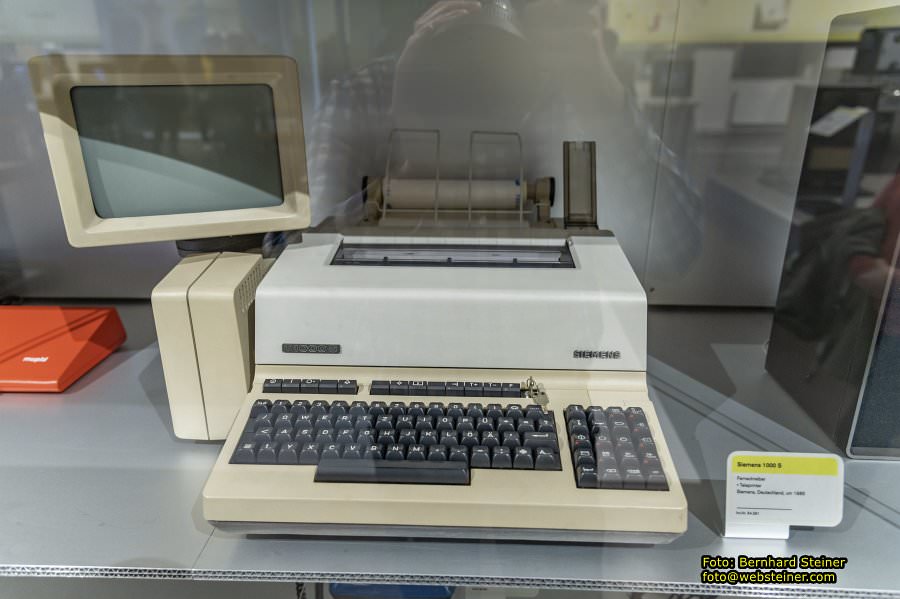
Schrack W74, Tischtelefon, Schrack, Wien (A), 1974
Feller 521, Anrufbeantworter mit Mikrokassetten, Feller, Horgen (CH),
1978
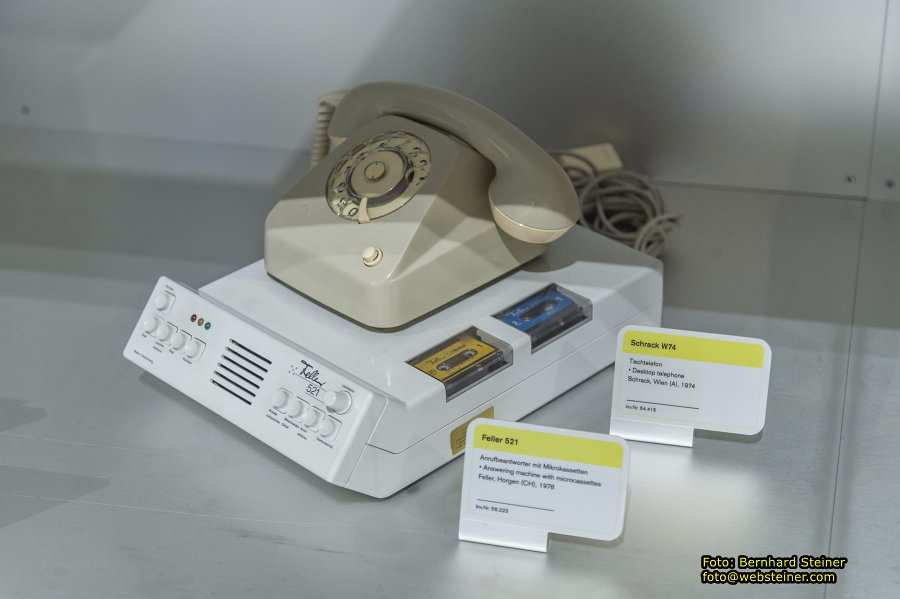
Medien und Mobilität
Radio- und Fernsehgeräte bringen die Welt ins Heim und gelten in den
Wirtschaftswunderjahren als Statussymbole. Die Transistortechnik
erlaubt es handlichere Geräte zu bauen und ermöglicht so das Radiohören
und Fernsehen auch auf tragbaren Geräten im Urlaub oder unterwegs. Das
Telefon, bis dahin hauptsächlich im Büro verwendet, bekommt allmählich
seinen Platz im Eigenheim. Mit dem Videorecorder können ab den 1970er
Jahren Fernsehsendungen aufgezeichnet werden, wodurch die starren
Programmbeginnzeiten der Rundfunkanstalten an Bedeutung verlieren.
Unabhängigkeit schaffen auch Anrufbeantworter, die in Abwesenheit
Telefonanrufe aufzeichnen. Telefaxgeräte ermöglichen Briefe rasch über
Telefonleitungen zu übertragen. Nach den Autoradios kommen auch
Autotelefone dem gestiegenen Bedürfnis nach Mobilität entgegen. Die
Mobilfunktechnik macht das Telefon in den 1990er Jahren draht- und
ortsunabhängig; per Handy ist man immer und überall erreichbar - ob man
will oder nicht!
Nokia 3210, GSM-Mobiltelefon, Nokia, Helsinki (FIN), 1999
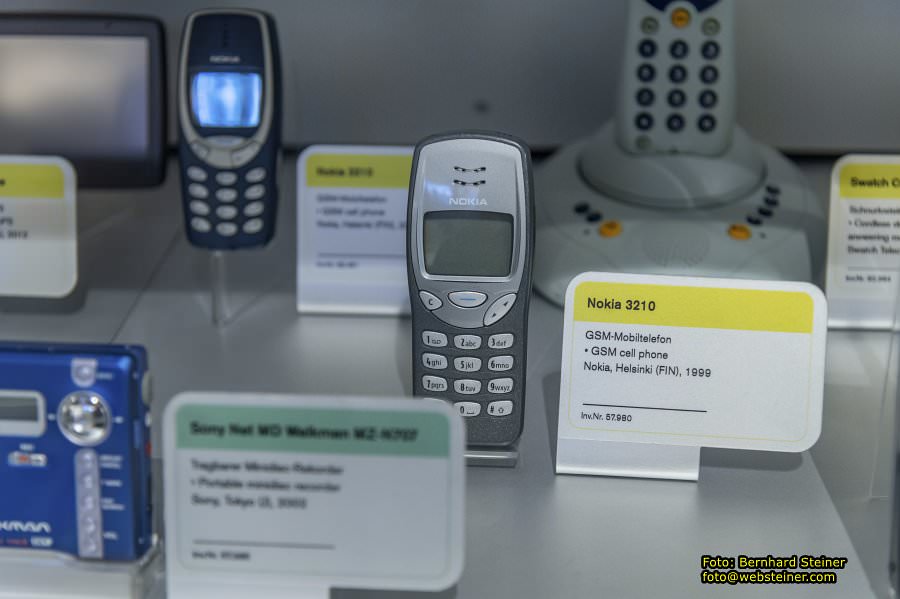
Hamann E, Elektrische Rechenmaschine, Deutsche Telephon Werke und
Kabelindustrie AG, Berlin, 1954

Time & Fun Safari, Elektronisches Taschenspiel, VTL, Hongkong
(CHN), 1981
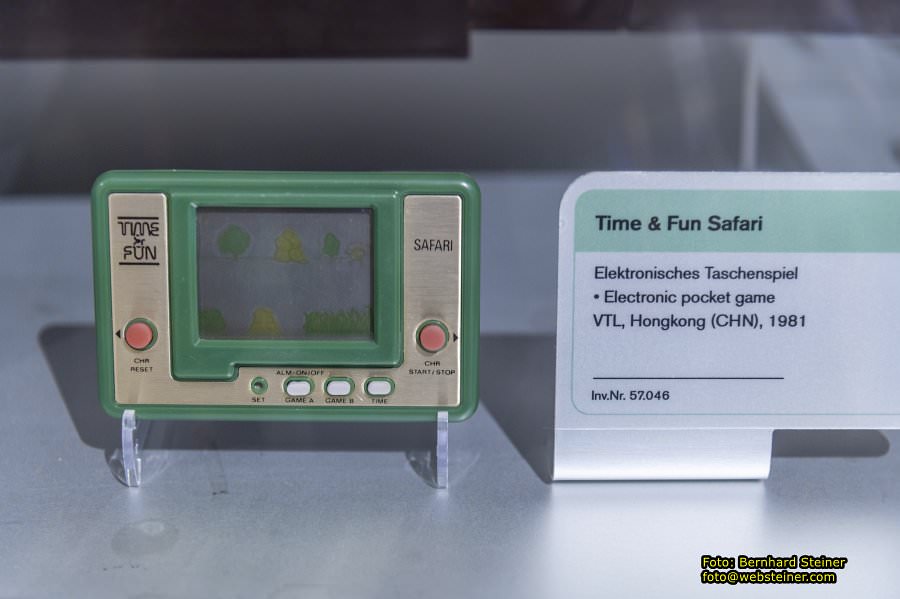
Nintendo Game Boy, Bettronisches Taschenspiel, Nintendo Co. Ltd, Kyoto
(J), 1989
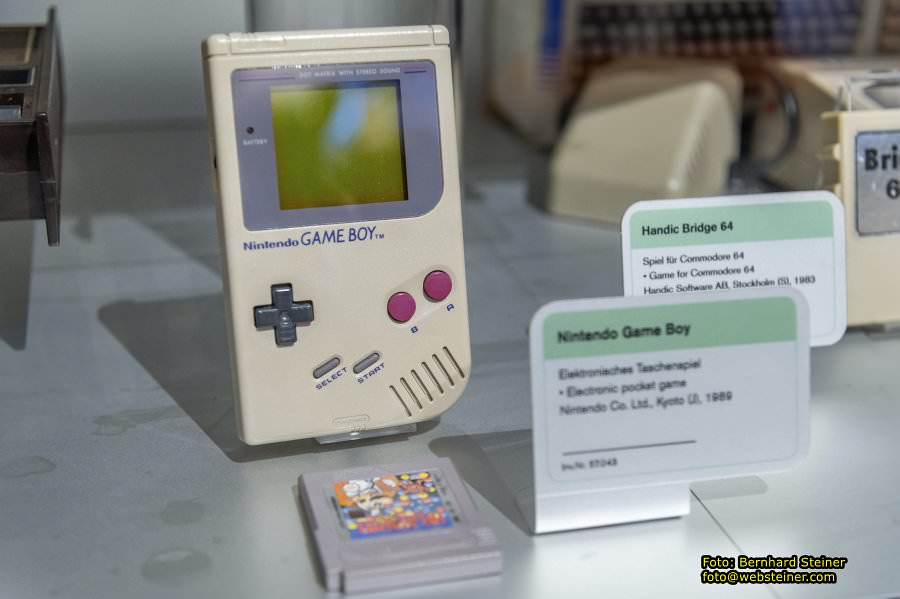
Commodore 64, Personal Computer Commodore Business Machines, Ontario
(CAN), 1982

Tonfilm
Versuche, den stummen Bildern der Leinwand Tonaufnahmen zu unterlegen,
scheitern zunächst an Problemen wie der geringen Lautstärke und dem
mangelhaften Gleichlauf zwischen Bild und Ton. Zwar gibt es seit den
1910er Jahren kaum eine Filmvorführung ohne Musikbegleitung, doch ist
die lippensynchrone Wiedergabe von Sprache erst nach langwierigen
Versuchen möglich. Als erster Tonfilm gilt The Jazz Singer, ein amerikanischer
Nadeltonfilm von 1927. Zum weltweiten Standard wird aber erst das
spätere Movietone-System, bei dem der Ton nicht von einer gleichzeitig
abgespielten Schallplatte kommt, sondern als Lichtspur direkt auf den
Filmstreifen kopiert ist. Die Umstellung auf den Tonfilm erfordert ein
Umrüsten der Projektoren und Kinos und die Festlegung der Bildfrequenz.
Der Tonfilm verändert aber auch die Verleihbedingungen radikal: Filme
sind jetzt nur mehr dann weltweit einsetzbar, wenn sie in verschiedenen
sprachlichen Versionen hergestellt werden.
Western Electric, Nadel- und Lichttonfilmprojektor, Electrical
Research, New York (USA), 1928

35mm-Filmschneidetisch, Prevost S.R.L., Mailand (I), um 1940

Reisefotografie
Das 19. Jh. ist das Zeitalter der Expeditionen und Bildungsreisen. Vom
Äquator bis zu den Polen werden Länder vermessen und erforscht. Die
Kultur- und Naturdenkmäler der Alten und Neuen Welt werden bereist und
von Fotografen dokumentiert. Doch die Arbeit außerhalb des Ateliers ist
zunächst eine beschwerliche Angelegenheit. Beim Nass-Kollodium-Verfahren, das in den 1850er Jahren gebräuchlich
wird, müssen die Chemikalien unmittelbar vor der Aufnahme auf die
Glasplatten aufgegossen und die belichteten Platten innerhalb kurzer
Zeit in vollkommener Dunkelheit entwickelt werden.

Für ausgedehnte Reisen sind fotografische Ausrüstungen bis zu einer
Tonne Gewicht nicht selten. Neben Kamera und Platten muss auch eine
Dunkelkammer mitgeführt werden. Erst nach Einführung der Trockenplatte
um 1870 wird das Fotografieren einfacher. Zusammenklappbare
Reisekameras, die fortan im Handgepäck mitgeführt werden können,
erlauben es den immer zahlreicher werdenden Touristen eigene Aufnahmen
zu machen.
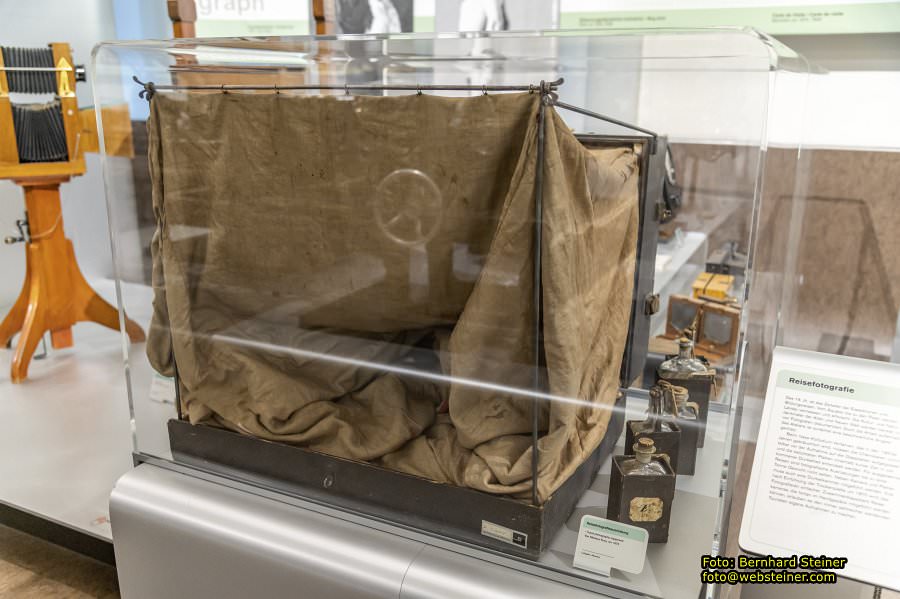
Reisekamera, G. Westmüller, Linz (A), um 1900

Reisekamera mit Stativ, Christoph Schaller, Wien (A), um 1900

Seit dem Altertum wird der Abakus von Händlern in Asien und in Europa
zum Rechnen verwendet. Am Abakus werden Zahlwerte durch Holzkugeln
dargestellt, die auf Stäben aufgefädelt sind. Die Stäbe tragen
entsprechend dem Stellenwertprinzip - im Dezimalsystem - Kugeln für
Einer, Zehner, Hunderter usw. Beim Verrechnen werden sie entsprechend
verschoben. Durch den Übertrag - eine Summe zehn wird nicht durch zehn
Einerkugeln, sondern durch eine Zehnerkugel dargestellt - herrscht
stets Überschaubarkeit.
Auf Stellenwertprinzip und Dezimalsystem basiert auch das indische
Ziffernsystem, das über Ziffern von eins bis neun und über ein Zeichen
für null verfügt. Durch die Null wird die Stellenwertschreibweise auf
Papier möglich, die aufwändige Rechenoperationen rascher durchzuführen
erlaubt als mit römischen Ziffern. Die indischen Ziffern gelangen im
Mittelalter durch arabische Kaufleute nach Europa, wo sie in den
Kontoren der Handelsstädte eine effiziente Buchführung ermöglichen.
Schtschoty, Abakus, Russland, 19. Jh.

Es gibt weltweit über hundert unterschiedliche Spurweiten. Die Wahl der
Spurweite hat wirtschaftliche und politische Gründe. Die breiteste Spur
mit 1.676 Millimeter ist die indische Breitspur. Liegt das Maß unter
1.435 Millimetern, spricht man von Schmalspur. In Europa herrscht die
Normalspur vor. Das Hauptbahnnetz in Spanien hat 1.672 Millimeter, in
Russland, Finnland und den baltischen Staaten 1.529 Millimeter.

Der 1981 gegründete österreichische Flugzeughersteller Diamond Aircraft
aus Wiener Neustadt beschäftigt über 1.200 Mitarbeiter in Österreich,
Kanada und China. Er ist weltweit einer der größten Hersteller von
Leichtflugzeugen. Mit einer DA42 von Diamond Aircraft gelang der erste
Transatlantik-Non-Stop-Flug eines dieselbetriebenen Flugzeugs. Es dient
als Reiseflugzeug, wird aber auch in der Pilotenausbildung verwendet.
Eine für Überwachungsaufgaben eingesetzte Spezialversion kann bis zu
zwölfeinhalb Stunden in der Luft bleiben und über 1.900 Kilometer weit
fliegen. Bisher wurden über 800 Stück von dieser Maschine erzeugt. Der
Erstflug dieser DA42 mit Firmengründer und Cheftestpilot Christian
Dries fand am 9. Dezember 2002 statt. Der Rumpf ist aus sehr leichten
Glas- und Karbonfasern gefertigt.
Diamond DA42 Twin Star (OE-VPS)
Prototyp, Länge: 8,56 m, Spannweite: 13,55 m, Startgewicht: 1.785 kg,
Leistung: 2 x 125 kW (170 PS), Besatzung: 4 Personen,; Diamond
Aircraft, Wiener Neustadt, 2002

Feuerwehrwagen
Im Unterschied zur selbsttätigen Feuerbekämpfung mit einzelnen Geräten,
erfordern Wagen den Einsatz einer Mannschaft oder zumindest mehrerer
Personen. Bei den ein- oder zweizylindrische Kastenspritzen wurde der
erforderliche Wasserdruck von einer Pumpmannschaft durch händisches
Bewegen der Kolbenstangen erzeugt. Wesentlich höhere Leistungen konnten
durch den Einsatz von Dampfspritzen erreicht werden. Als Dampferzeuger
fungiert ein Kessel, den eine eigens ausgebildete Fachkraft - der
Maschinist - bediente. Dampf- und Spritzenzylinder sind liegend,
stehend oder auch in schräger Anordnung auf einem vierrädrigen Wagen
montiert. In Österreich wurden seit den 1870er Jahren durch die Firma
Wm. Knaust, Linz, Dampffeuerspritzen gebaut. Die ersten Freiwilligen
Feuerwehren setzten oft kombinierte Dampf- und Handspritzen ein.
Gezogen wurden diese rund 1,5 Tonnen schweren kutschenartigen Maschinen
von Pferden. Im Unterschied zum Hand- oder Dampfbetrieb kam bei der
Motorspritze ein Benzinmotor zum Einsatz. Diese Feuerspritzen waren
schnell und ohne Zeitverzögerung durch Anheizen einsetzbar.
Das Löschwasser muss durch die Mannschaft bzw. durch Fuhrwerke zum
Kasten, auf dem sich das Pumpwerk befindet, herbeigeschafft oder über
Spritzen mit Saugvorrichtung aus Flüssen, Löschteichen oder anderen
Behältern entnommen werden.
Feuerlöschmaschine Sulldorf, einzylindrische, vierrädrige Feuerspritze
mit Wenderohr, 1742-1791

Abgesehen von den Rädern, Deichsel, Werkzeugkiste und Beplanung des
Kutschbockes ist die Feuerlöschspritze vollständig aus Metall
konstruiert. Im mittleren Teil des Rahmens sind die Dampfmaschine und
das Pumpwerk eingebaut. Die Pumpenanlage kann sowohl mit der
Dampfmaschine als auch händisch betrieben werden. Die Handpumpe besitzt
einen Wippenantrieb, dessen Ausleger ein- bzw. umgeklappt werden
können. Hinter dem Kessel befindet sich der Heizerstand mit den
Bedienarmaturen. Auf dem Boden sind eine Handspeispumpe und ein
Vorratsbehälter für Brennstoffe angebracht. Ein Funkenfänger am
Schornstein soll Funkenflug verhindern. Der einfache Kutschbock kann
vier Personen aufnehmen, darunter befindet sich eine Werkzeugkiste.
Seitlich davon hängen die Halterungen für die Schlauchhaspeln. Die für
den Betrieb notwendige Dampfleistung wird bereits bei der Anfahrt durch
Heizen erzeugt. Dampf- und Handspritze arbeiten voneinander unabhängig,
um bei einer Störung zumindest ein Werk verwenden zu können.
Feuerdampfspritze Kittsee
Kombinierte Dampf- und Handspritze der Feuerwehr Kittsee (Burgenland),
Type 134, 11 Atmosphären, ca. 1911
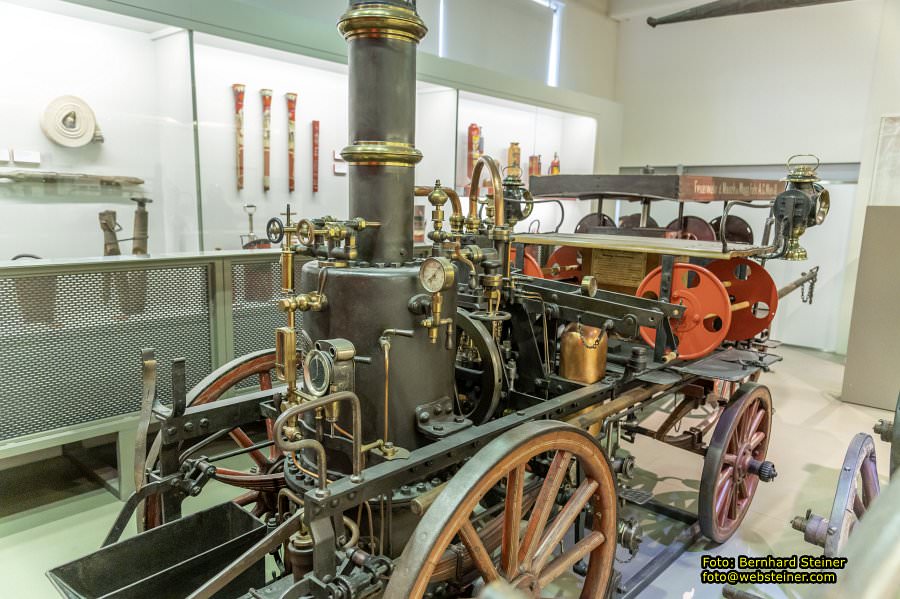
Fr. KERNREUTER, № 134, 11 Atmosphären, WIEN-HERNALS
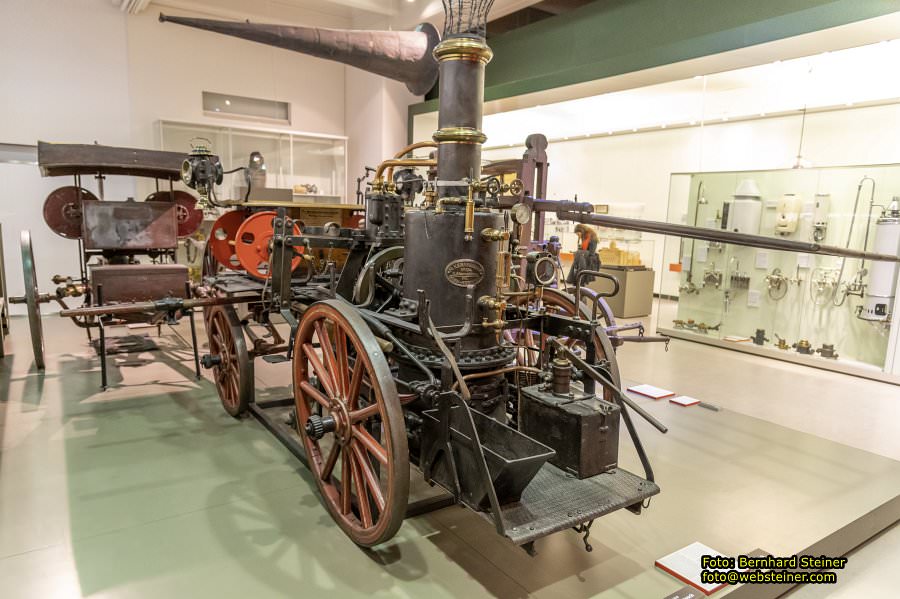
Häusliche Aborte
Dass wir heute unser Bedürfnis an fast jedem Aufenthaltsort bequem
verrichten können, ist das Ergebnis sanitärer Technik. Moderne WCs - an
ein Abwasserkanalnetz angebundene Wasserklosetts (von englisch „water
closet") - entsorgen Fäkalien geruchsarm. Bei der technischen
Entwicklung achtete man darauf, dass die als unangenehm empfundenen
Abfallstoffe immer diskreter verschwanden. Bis nach Mitte des 19.
Jahrhunderts waren Nachttöpfe, Kübel und Zimmerklosetts in Gebrauch,
die auf der Straße in die Gosse oder in Kanäle entleert werden mussten.
Plumpsklos in der Nähe der Hauseingänge kamen als Nächstes, bis ab 1870
schließlich die breite Versorgung der Häuser mit Wasser- und
Abwasserleitungen den Wiener Standard von Bassena und Gangklosett auf
den Wohnetagen etablierte.
Der nächste Schritt der Verhäuslichung des WCs, seine Integration in
den Wohnraum, blieb zunächst ein Privileg der Oberschicht.
Vorangetrieben wurde er auch durch die wachsende Bedeutung von
Intimität: Das steigende Scham- und Peinlichkeitsempfinden verlangte
nach Raumabschluss und Ungestörtheit. Erst mit dem Gemeindebau der
1920er Jahre begann die Demokratisierung dieses privaten Luxus', auf
den der größere Teil der Wiener noch bis in die 1960er und 1970er Jahre
warten musste.


Kriegsprothesen
Der Erste Weltkrieg war der erste industriell geführte Krieg: mit
massenhaftem Einsatz von Mensch und Material. Kriegsverletzte mit
früher kaum überlebbaren Versehrungen erlitten massive körperliche,
psychische wie soziale Traumata, die es zu bewältigen galt. Die
Prothesentechnik reagierte auf die verheerenden Kriegsfolgen mit einem
starken Entwicklungsschub. Der Massenbedarf an Ersatzgliedmaßen führte
zur Entwicklung von funktionellen, spezialisierten Arbeitsprothesen.
Zusätzlich entstand ein eigener Zweig der kosmetischen Prothetik, um
den zahllosen Versehrten eine neue soziale Identität zu ermöglichen. So
unterschied man etwa die „Arbeitshand" von der kosmetischen
„Sonntagshand", die privat getragen wurde. Resozialisierung bedeutete
für Kriegsinvalide vor allem Leistungsdruck, sie mussten sich mit den
körperfremden Prothesen im Rahmen ihrer Arbeit vertraut machen.
Rehabiltationsprogramme waren volkswirtschaftlich motiviert und wurden
propagandistisch beworben. Man appellierte an den Willen der
Betroffenen und erhob jenen zu einem Kriterium der Gesundheit.
Die antiken Statuen nachempfundenen Modellfiguren in halber
Lebensgrösse tragen sogenannte Immediat-Prothesen. Diese wurden
amputierten Patienten nach ihrer Erstversorgung aus kostengünstigen und
in der Größe verstellbaren Materialien vorübergehend angepasst. Sie
sollten schon im Heilungsstadium dazu motivieren, möglichst schnell
wieder gehen zu lernen, um nicht die aufwändige Fertigung des
endgültigen anatomischen Kunstbeines abwarten zu müssen.
Sechs Modellfiguren mit Immediat-Beinprothesen, anlässlich der
Kriegsausstellungen im Kaisergarten, Wiener Prater, ca. 1916/1917

Der so genannte Wiener Narrenturm wurde als „Irrenhaus" errichtet und
gilt als weltweit erste Institution dieser Art. Er geht auf Pläne des
Bauherrn Kaiser Joseph II. (1780-1790) zurück. Der ringförmige,
fünfgeschossige Bau mit seinen 139 Zellen à 12m² war zwar Teil einer
aufklärerischen Fürsorgepolitik, doch kam die Einweisung von
Geisteskranken auch einem Wegsperren aus dem öffentlichen Leben gleich.
Modell des Narrenturm in Wien, 1783
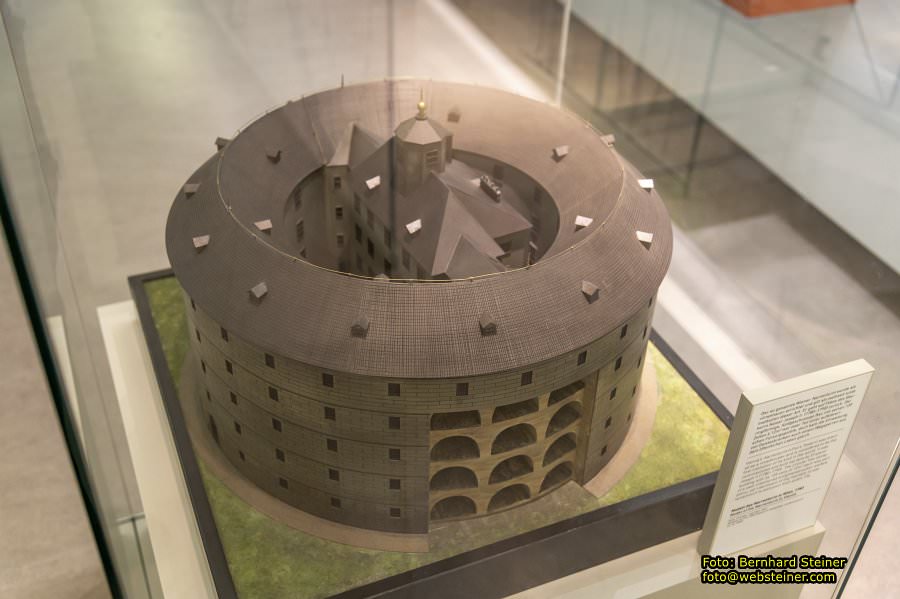
Spielzeug hat über die primäre Funktion hinaus stets auch dazu gedient,
dass sich Kinder in eine zukünftige Erwachsenen- und Geschlechterrollen
einüben. So finden Baukästen und Blechspielzeug das Technik-Spielzeug
der Buben - ihre Entsprechung in den Puppenküchen und Haushaltsgeräten
für Mädchen. In der Gestaltung der Puppenküchen spiegeln sich auch die
jeweils aktuellen Küchenkonzepte einer Zeit wider.
Puppenküche, ca. 1920

Die Küche ist aus Stahlblech gefertigt, der Herd lässt sich mit
Trockenspiritus beheizen.
Puppenküche, ca. 1962


Gaudí, die Architektur und der von der Natur inspirierte Modernismus
Antonio Gaudí (1852-1926) sagte, dass "der Architekt der Zukunft sich
auf die Nachahmung der Natur stützen wird, weil sie die rationellste,
dauerhafteste und wirtschaftlichste aller Methoden ist". Als
Wegbereiter der Nachhaltigkeit in der Architektur optimierte er die
strukturelle und bioklimatische Gestaltung seiner Gebäude, verwendete
Steine aus der unmittelbaren Umgebung, nutzte Abfallmaterialien und
ahmte die Formen der Natur in seinem eigenen, organischen Stil nach.
Modell des Drachens im Park Güell, Barcelona: Der Drache ist bedeckt
mit Trencadís, einem Mosaik aus unregelmäßigen Keramik-, Glas- oder
Marmorstücken, einer Technik, die Gaudívor einem Jahrhundert populär
machte.




Ein furchterregender Anblick
Bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts gab es unterschiedliche
und diffuse Vorstellungen über die Ursache von Krankheit. Mit der
Bakteriologie änderten sich Wahrnehmung und Bekämpfung von Krankheit:
Ein exakt definiertes Objekt, das Bakterium, war nun als Erreger
erkannt. Durch die technische Möglichkeit der Mikrofotografie gelangte
das Bild des Bakteriums massenhaft in Ausstellungen, Zeitschriften,
Merkblätter und Lichtbildvorträge. Das Foto war von Anfang an
entscheidend an der Herstellung und Verbreitung des neuen Wissens
beteiligt: Krankheit wurde durch die Augen der Wissenschaft gesehen,
hygienische Maßnahmen änderten sich grundlegend. Die in Staub und
Schmutz allgegenwärtigen bakteriellen Gefahren sollten mit neuen
technischen Konstruktionen und disziplinierenden Verhaltensmaßregeln
bekämpft werden. Robert Koch identifizierte 1882 den Tuberkelerreger
als Krankheitsursache für die Tuberkulose. Als Hauptinfektionsquelle
galt der ausgehustete Schleim der Tuberkulosekranken. Das
Auf-den-Boden-Spucken - damals alltägliche Praxis - wurde verboten, die
Benützung des Spucknapfs und Reinlichkeit wurden hygienische Pflicht.
Spucknapf auf Metallständer, 1903

Spucknäpfe gab es in allen möglichen Varianten.
Der Reform-Spucknapf wurde nach dem Vorbild des Wasserklosetts
hergestellt: mit Wasserspülung, Siphon und Deckel. Er sollte in
Schulen, öffentlichen Gebäuden, Fabriken, Warteräumen und Restaurants
aufgestellt und zu einem generellen Hauseinrichtungsgegenstand werden.
Reform-Spucknapf, 1904

7. Mai 1984
Die geplante Errichtung eines Donaukraftwerks östlich von Wien rief
Gegner auf den Plan, die einen Baustopp und die Errichtung eines
Nationalparks forderten. Schirmherr für das nach ihm benannte
Volksbegehren war Konrad Lorenz, der ungewöhnliche Unterstützung bekam:
Bei einer „Pressekonferenz der Tiere" machten Politiker, Künstler und
Journalisten auf originelle Weise auf die Zerstörung der Stopfenreuther
Au aufmerksam. Das Kraftwerk wurde nicht gebaut, 1996 der Nationalpark
Donau-Auen ausgerufen.
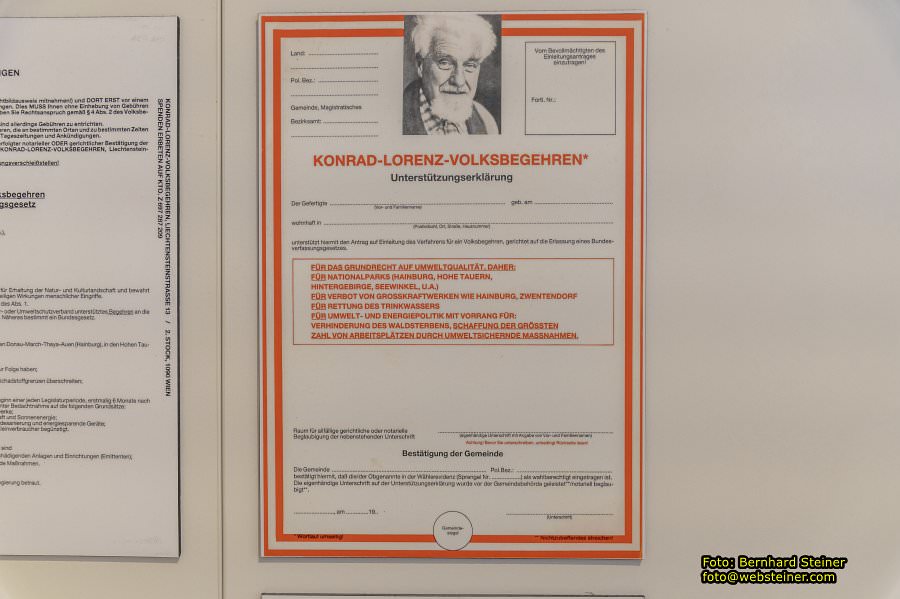

Sie ist die größte, schwerste, stärkste und schnellste Dampflokomotive,
die jemals in Österreich gebaut wurde: die 12.10! Mit den
Dampflokomotiven der Baureihe 12 setzte die junge Republik in den
1930er Jahren neue Maßstäbe auf der Hauptverkehrsachse
Wien-Salzburg. Die 12.10 wurde im Jahr 1936 in der
Lokomotivfabrik Floridsdorf gebaut. Lok und Tender sind insgesamt 22,6
Meter lang und 138 Tonnen schwer. Mit ihren 2.700 PS brachte sie es auf
eine Maximalgeschwindigkeit von 154 km/h – Rekord in der damaligen Zeit!
Aufwändige Restaurierung
Um den Stahlkoloss restaurieren und ins Haus einbringen zu können,
mussten viele organisatorische und logistische Herausforderungen
gemeistert werden. Das Gesamtgewicht der Lokomotive mit Tender macht
sie zum schwersten Objekt in der Museumssammlung. Für die Restaurierung
mussten neben vielen Kleinteilen auch die tonnenschweren Achsen
ausgebaut werden.

Vergiftungen durch Metalle
Schon im 16. Jahrhundert verwiesen Ärzte wie Paracelsus und Georg
Agricola auf Gefahren für die Beschäftigten im Berg- und Hüttenwesen.
Wer mit Blei und Quecksilber zu tun hatte, war besonders gefährdet.
Quecksilber verdampft schon bei Raumtemperatur und belastete Berg- und
Hüttenleute schwer. In der Bleiverarbeitung litten vorwiegend jene, die
Verbindungen wie Bleiweiß und Mennige erzeugten. Wer lachte, verriet
sein Leiden: Eine Überdosis dieser beiden Metalle wurde in einem
dunklen Saum am Zahnfleisch sichtbar. Die Vergiftung beeinträchtigte
die Verdauung und die Nerven. Quecksilberarbeiter litten unter starkem
Speichelfluss und zitterten. Vom Blei Geschädigte waren auffallend
blass und wurden von schmerzhaften Koliken geschüttelt. Im 19. und
frühen 20. Jahrhundert brachten Sozialreporter diese Missstände an die
Öffentlichkeit. Ärzte, Hygieniker und Arbeitsinspektoren begannen das
Problem systematisch zu studieren und begründeten die moderne
Gewerbehygiene sowie die Arbeitsmedizin. Nur mit großer Verzögerung
fanden ihre Erkenntnisse Eingang in die Gesetzgebung.
1867 schlossen sich die meisten Bleiberger Gewerken zur »Bleiberger
Bergwerks-Union« (BBU) zusammen. Bis 1902 brachten die Mitglieder
dieser Aktiengesellschaft die gesamte Kärntner Bleiindustrie mit
Ausnahme des Standortes Raibl/Cave del Predil (Italien) in ihren Besitz.
Mustervitrine der Bleiberger Bergwerks-Union
Hersteller BBU Entstehungszeit ca. 1930

Das denkmalgeschützte Hauptgebäude wurde ab 1909 nach Plänen von Hans
Schneider errichtet und am 6. Mai 1918 als „Technisches Museum für
Industrie und Gewerbe“ eröffnet. Es grenzt stadteinwärts an den
Gustav-Jäger-Park. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite liegt der
Auer-Welsbach-Park. Die hellen, mit Glaskuppeln überdachten Innenhöfe
gelten als Besonderheit des Gebäudes.
