web steiner
Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen
Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.
+43/2624/54014 - office@websteiner.com
Tulln an der Donau
die Gartenstadt, Juni 2023
Tulln an der Donau ist eine Bezirkshauptstadt im
Bundesland Niederösterreich. Der Ort wird aufgrund der vielen
Gärtnereien mit zahlreichen Rabatten auch als Gartenstadt bezeichnet.
Römermuseum, Egon Schiele Museum und DIE GARTEN TULLN zählen zu den
Sehenswürdigkeiten.
1729 wird das „Wasserkreuz" in Tulln ans Ufer geschwemmt. Die
BürgerInnen der Stadt lassen eine Kapelle errichten. Sie gedenken dort
zu Allerheiligen der unbekannten Toten, die in den wilden Wassern ihr
Leben ließen. Denn die Donau hat zwei Gesichter. Sie ist Lebensader und
Schicksalsstrom, Ernährerin und Zerstörerin. Zweimal gibt es in Egons
Kindheit Hochwasseralarm. 1897, als Reif, Hagel und Überschwemmungen
die Bewohner des Tullnerfeldes heimsuchen. Nur zwei Jahre später müssen
ganze Dörfer entlang der Donau evakuiert werden. Die Schieles, die in
einer großen Dienstwohnung am Bahnhof von Tulln leben, sind von den
Fluten nicht betroffen. Doch in der Stadt hinterlässt das Hochwasser
seine Spuren.

Im ehemaligen Frauenkloster wartet eine Zeitreise durch alle Epochen:
Das in Österreich einzigartige Virtulleum verknüpft mittels App 30
wertvolle Objekte mit 30 spannenden Orten in der Stadt. Das Römermuseum
zeigt das militärische und zivile Leben im Römerlager Comagenis auf
moderne Art.

Das STADTMUSEUM TULLN vereint das Römermuseum, die Dokumentation über
das kaiserliche Frauenstift und das Virtulleum. Im Römermuseum im Marc
Aurel-Park wird das Leben im Römerlager "Comagena" von 90 bis 488 n.
Chr. lebendig, mit Originalfunden, Dioramen, Modellen und Bildern.
Besondere Schwerpunkte sind das militärische und zivile Leben sowie die
Provinz Noricum. Ein Modell des Kastells und die Darstellung von Wegen,
die noch heute existieren, veranschaulichen die historische
Entwicklung. Eine Bilddokumentation zeigt weitere Kastelle im Tullner
Raum. Das Römermuseum Tulln wurde mehrfach mit dem Österreichischen
Museumsgütesiegel ausgezeichnet, das für exzellente Museumsarbeit
steht. Nur 223 Museen in Österreich tragen diese Auszeichnung. Das
STADTMUSEUM TULLN bietet somit nicht nur spannende Einblicke in die
Vergangenheit, sondern auch eine herausragende kulturelle Erfahrung,
die auf Qualität und Geschichte setzt.

Inhaltlich reicht der Spannungsbogen von der Zeit, als die Römer die
Grenzen ihres Imperiums bis an die Donaugrenze erweiterten, über die
Markomannen-Kriege und die Hunnen bis zur Christianisierung und dem
Wirken des Heiligen Severin, der in Comagenis predigte, bevor die
romanische Bevölkerung am Ende des 5. Jh. nach Italien abzog.

Bereits vor 2.000 Jahren beschäftigten sich die Menschen in Tulln mit
Themen wie Logistik, Mobilität, Migration, Handel, Religion, Brauchtum,
Wasser-Versorgung und Hygiene – genau wie heute. Das neu gestaltete
Römermuseum zeigt mit Comic-Animationen, Zinnfiguren-Dioramen und
lebensgroßen Figurinen römische Zivil- und Militärgeschichte und nimmt
die BesucherInnen mit auf eine lebendige Zeitreise ins historische
Tulln, damals Teil der Provinz Noricum.
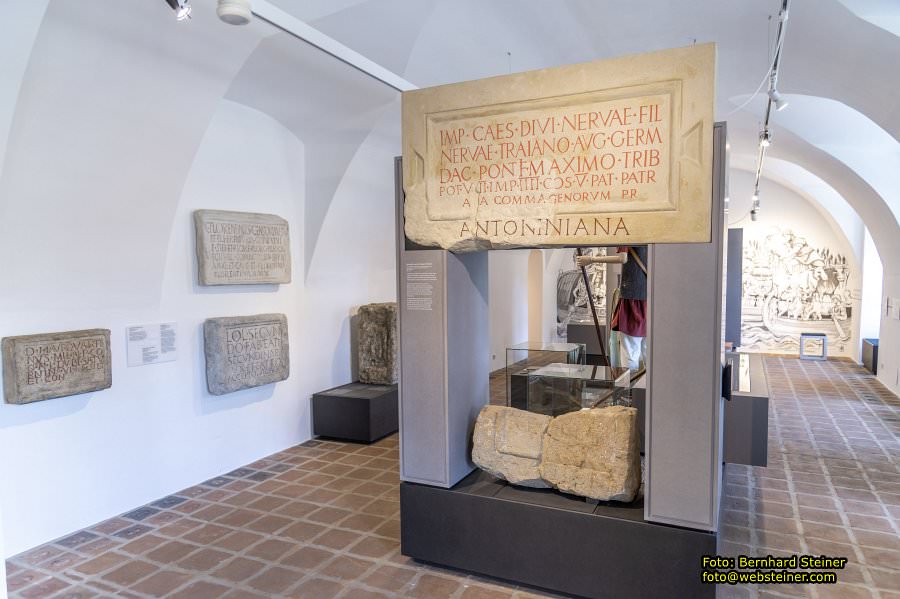
Leichter Helm der Hilfstruppen mit Kreuzbandverstärkung, 2./3. Jh. n.
Chr. (Kopie)
Römischer Legionär, spätes 2. bis frühes 3. Jh. n. Chr.
Die Bekleidung des Legionärs besteht aus einer kurzärmeligen Tunika,
die mit dem vorne mit Lederstreifen versehenen Militärgürtel (cingulum
militiae) gegürtet ist, aus einem Halstuch (focale) und Riemensandalen
(caligae). Zum Schutz des Körpers trägt er einen Streifenpanzer (lorica
segmentata) und einen schweren Infanteriehelm mit Kreuzbandverstärkung
und Stirnschild. Der große Infanterieschild (scutum) ist mit
Jupitersymbolen (Adlerflügel, Donnerkeil und Blitz) und dem Wappentier
der Legio II Italica (Wölfin mit den Zwillingen Romulus und Remus)
bemalt. Bewaffnet ist er mit dem Infanterieschwert (gladius) der
jüngeren Form mit Ortband an der Scheide, einem Dolch (pugio) und der
typischen Wurfwaffe (pilum).

Lagerbau
Jede Truppe erbaute bei Ankunft am Garnisonsort ein Lager mit allen
notwendigen Bauten und Ein-richtungen nach einem einheitlichen Schema.
Die Größe des Lagers, meist in Form eines Rechtecks mit abgerundeten
Ecken angelegt, richtete sich nach Truppenart und Mannschaftsstärke.
Kastelle waren keine Festungen, sondern durch Gräben, Mauern und Türme
gesicherte Kasernen. Mittelpunkt des Lagers war das Stabsgebäude
(principia), in dem die Diensträume des Komman-deurs untergebracht
waren sowie die Schreib-stuben der Verwaltung, die Waffenkammern und
das Fahnenheiligtum, in dessen Keller die Truppenkasse aufbewahrt
wurde. Als Zeichen der Loyalität der Soldaten waren im Stabsgebäude
lebensgroße Statuen des Kaisers als oberster Feldherr aufgestellt.
Neben den principia lagen das Wohngebäude des Truppenkommandanten,
Werkstätten, Speicherbauten und das Lazarett. Die Mannschaftsbaracken
befanden sich im vorderen und hinteren Lagerteil.
Soldaten beim Bau eines Militärlagers
Das Bild zeigt die Anlage der Lagergräben, deren Aushub zur Errichtung
des Lagerwalles aufgeschüttet wird. Der Lagerwall wurde feindseitig mit
Holzplanken, Rasensoden oder wie in Tulln mit ungebrannten Lehmziegeln
befestigt. Im Hintergrund sind Landvermesser dabei, mit dem
Vermessungsinstrument (groma) die Fluchten der Lagerstraßen und
Bauparzellen zu bestimmen und mit langen Messlatten die Straßen- und
Parzellenbreiten abzustecken.

Aufgaben der Soldaten
Neben der militärischen Funktion hatte das römische Heer auch wichtige
Aufgaben in der zivilen Verwaltung und bei der Errichtung der
Infrastruktur in den Provinzen. Der Bau von Straßen, Brücken,
Wasserleitungen und Militäranlagen sowie die Produktion von Baumaterial
in eigenen Versorgungsbetrieben wie Steinbrüchen, Kalköfen und
Ziegeleien wurden weitgehend von der Armee selbst durchgeführt. Für all
diese Bereiche gab es in der Truppe Spezialisten.
Die in den Militärziegeleien erzeugten und mit dem Namen der Einheit
gestempelten Ziegel sind neben Militärdiplomen, Grabdenkmälern und
Weihesteinen der Soldaten wichtige Quellen zur Geschichte und der
Bautätigkeit der Truppen in den Provinzen. Innerhalb der
Provinzverwaltung war das Militär auch in hoheitliche Aufgaben
eingebunden. Soldaten wurden als Verwaltungs- und Justizpersonal, bei
der Steuereinhebung, bei Polizei- und Zollaufgaben, zur Kontrolle des
Personen-und Warenverkehrs und als Eskorten eingesetzt.
Der römische Reiter
Die Ausrüstung der römischen Kavallerie unterschied sich von jener der
Infanterie. Die Reiter trugen Kniehosen (feminalia), Kettenhemd oder
Schuppenpanzer sowie Helme mit kurzem Nackenschutz und breiten, die
Ohren verdeckenden Wangenklappen. Oftmals waren die Helme aufwändig mit
nachgebildeten oder echten Haarlocken verziert. Als Waffe trugen sie
neben dem Ovalschild ein Langschwert (spatha) sowie Lanzen und
Wurfspeere. Spezialisierte berittene Einheiten wie die ala I Commagenorum sagittaria
verwendeten den aus Holz, Sehnen und Bein zusammengesetzten
orientalischen Reflex- oder Kompositbogen und Pfeile mit dreiflügeligen
Pfeilspitzen.
Die Kosten für Ausbildung und Versorgung der Reiter war fünfmal höher
als für gleich große Fußtruppen. Aufgrund ihrer Schnelligkeit und
größeren Reichweite, bis zu 80 km am Tag, waren sie ein wichtiges
taktisches Element an den römischen Grenzen. Sie wurden auch für
Kundschaftszüge, Patrouillen und Kurierdienste eingesetzt.
Römischer Hilfstruppenreiter,
1. Jh. n. Chr.
Der Reiter trägt eine kurzärmelige Tunika, wadenlange Reiterhosen und
Sandalen (caligae) mit Sporen. Als Schutzwaffen trägt er einen
Kettenpanzer (lorica hamata), einen Reiterhelm mit breiten
Wangenklappen und aufgeklebter blonder Perücke sowie einen ovalen, mit
Randbeschlägen verstärkten Schild mit bronzenem Schildbuckel (umbo).
Die Angriffswaffen bestehen aus dem über der linken Schulter am
Schwertriemen (balteus) befestigten langen Reiterschwert (spatha),
einer Reiterlanze (hasta) und drei kurzen Wurfspeeren, die in einem am
Sattel befestigten Köcher mitgeführt wurden.

Suebe in germanischer Tracht
des 2. Jhs. n. Chr.
mit langer Hose, hemdartigem Kittel und einem an der rechten Schulter
von einer Fibel zusammengehaltenen Mantel. Die Haare sind an der
rechten Schläfe zum sogenannten Suebenknoten gebunden, eine für Krieger
des germanischen Stammes der Sueben charakteristische Haartracht, wie
der römische Historiker Tacitus berichtet.

Münzdepotfund, 3. Jh. n. Chr.
Bei Bauarbeiten in Tulln wurden 1966 südlich des Kastells, knapp
außerhalb der Lagermauer, 1.745 römische Silbermünzen (1.383
Antoniniane, 362 Denare) geborgen. Die Prägungen reichen von 195 n.
Chr. (Septimius Severus) bis 257/258 n. Chr. (Valerian I.). Die
jüngsten Münzen legen einen Vergrabungszeitraum um 260 n. Chr. nahe.

DIE ROMER GEHEN - DIE SPÄTANTIKE
FESTUNGSSTADT COMAGENIS
Nach den Wirren des 3. Jhs. n. Chr. erlebte das Römische Reich in der
Regierungszeit des Kaisers Constantinus I. (306-337 n. Chr.) eine späte
Blütezeit. Er setzte die unter Diokletian begonnene Heeresreform fort,
die eine nachhaltige Sicherung und Stabilisierung der Grenzprovinzen
ermöglichte. Die Lagerbesatzungen wurden auf die vermehrte Zahl der
Kleinkastelle und Burgi aufgeteilt. Die Kastelle wurden neuen
Kampftechniken angepasst und mit über die Mauerflucht hinausragenden
Eck- und Zwischentürmen (Fächer-und Hufeisentürmen) verstärkt. Nach der
zweiten Hälfte des 4. Jhs. n. Chr. verstärkte sich der Druck der
beginnenden Völkerwanderung auf die Reichsgrenzen. Als Gegenmaßnahme
wurde im Donauraum die Grenzverteidigung ein letztes Mal unter Kaiser
Valentinian I. (364-375 n. Chr.) wieder instandgesetzt und durch
Kleinkastelle und Wachtürme verstärkt. In einer Ecke der Kastelle
entstanden Kleinfestungen (Restkastelle) mit geringer Besatzung. Im
frei gewordenen Lagerareal siedelte sich die Zivilbevölkerung an, die
Kastelle wurden zu Kleinstädten (oppida).
Eine der wichtigsten Quellen zur militärischen und zivilen Gliederung
des spätrömischen Reiches ist die Notitia Dignitatum, eine Art
Staatshandbuch mit Ämterverzeichnis aus dem frühen 5. Jh. n. Chr., in
dem Kastelle mit ihren Einheiten genannt werden. Dies ermöglicht eine
Rekonstruktion der Truppenstationierungen während der Spätantike. Für
Comagenis wird darin eine Einheit der lanciarii Comaginenses angeführt.
Es ist dies die letzte bekannte reguläre Truppe des römischen Heeres im
Tullner Lager. Im Jahr 395 n. Chr. kam es zur endgültigen Teilung des
Römischen Reiches in eine Ost- und eine Westhälfte. Noricum gehörte nun
zum Weströmischen Reich mit der neuen Hauptstadt Ravenna. Die
dramatisch verschlechterte wirtschaftliche Situation führte schließlich
im 5. Jh. n. Chr. zum Zusammenbruch der römischen Staatsverwaltung und
damit auch der Provinzverwaltung. Die Orte am Limes waren ständigen
Plünderungen und Zerstörungen durch verschiedene einfallende
Völkergruppen ausgesetzt. Um die Mitte des 5. Jhs. n. Chr. verwüsteten
Hunnen unter König Attila auf ihrem Zug nach Gallien die
Donauprovinzen. Über die Zustände in Ufernoricum, u.a. auch in
Comagenis, nach Attilas Tod im Jahr 453 n. Chr. bis zum Zusammenbruch
des Römischen Reiches berichtet die Vita des Hl. Severin.
Infanteriesoldat, 4. Jh. n. Chr.
Die Ausrüstung der Truppen des spätrömischen Grenzheeres (limitanei,
riparienses) bestand aus einer langärmeligen Tunika, langen Hosen und
einem weiten Radmantel (sagum), der an der rechten Schulter mit einer
Zwiebelknopffibel geschlossen wurde, sowie aus hochgeschlossenen
Schuhen (carbatinae). Tunika und Mantel waren mit Zierbesätzen
(segmenta) geschmückt. Charakteristisch war der breite, mit
kerbschnittverzierten Metallplatten beschlagene Ledergürtel. Den Kopf
schützte ein eiserner Kammhelm mit Nasenschutz. Die Bewaffnung bestand
aus einem Langschwert (spatha), einer Stoßlanze (hasta), mit Blei
beschwerten Wurfpfeilen (plumbatae) und einem ovalen, mit dem
Schildzeichen der Truppe bemalten Schild.

Pferdeausrüstung
Die Ausrüstung des Pferdes war für die Effektivität der Reiterei von
großer Bedeutung. Da in römischer Zeit ohne Steigbügel geritten wurde,
musste der mit vier Hörnchen versehene Sattel dem Reiter beim schnellen
Galopp und beim Kampf den nötigen Halt geben. Sattel und Riemengeschirr
bestanden aus Leder und waren mit Metallbeschlägen, Zierscheiben und
Anhängern reich verziert. Als Trensen waren sowohl einfache, bei den
Kelten verwendete Ringtrensen als auch das in seiner Wirkung
effektivere Hebelstangengebiss aus dem Mittelmeergebiet in Gebrauch.
Hufeisen wurden bei der römischen Armee nicht benutzt, die Verwendung
von Stachelsporen aus Eisen oder Bronze ist durch Funde gesichert. Im
archäologischen Fundgut sind vor allem metallene Riemenverteiler,
verzinnte oder versilberte Metallbeschläge und Anhänger, darunter auch
Phallusanhänger, die als Unheil abwehrende Amulette dienten, sowie
Melonenperlen aus Kieselkeramik anzutreffen. Über Aussehen und
Trageweise von Sattel und Pferdegeschirr geben vor allem die
detaillierten Darstellungen auf antiken Grabsteinen und Reliefs
Auskunft.
Hunnen und verbündete Germanen ziehen um 451 n. Chr. durch das Donautal
nach Gallien (Frankreich)

DAS ENDE VON COMAGENIS - DIE ZEIT DES
HEILIGEN SEVERIN
Die bedeutendste schriftliche Quelle für die spätantike Geschichte der
Donauländer ist die Vita Sancti Severini. Die 511 n. Chr. von
Eugippius, dem Abt des Severinklosters von Lucullanum bei Neapel,
verfasste Denkschrift über das Leben Severins gibt einen anschaulichen
Bericht über die Zeit des untergehenden Römischen Reiches. Der später
als Heiliger verehrte Severin wirkte von seinem Eintreffen in Noricum
nach dem Tod Attilas 454 n. Chr. bis zu seinem Tod am 8. Jänner 482 n.
Chr. in den Provinzen Noricum Ripense und Raetia Secunda. Er gründete
an mehreren Orten Mönchsgemeinschaften und arbeitete auch karitativ zum
Wohl der notleidenden Bevölkerung. Nur dank seines diplomatischen
Verhandlungsgeschicks im Umgang mit den Germanen war es möglich, ein
einigermaßen geregeltes Leben aufrechtzuerhalten.
Der Vita ist der allmähliche Zerfall der römischen Heeresorganisation
an der Donau zu entnehmen. 454 n. Chr. lösten sich die regulären
Einheiten auf, da Soldzahlungen ausblieben. Severin weilte bald nach
seiner Ankunft auch in Comagenis. Während seines Besuches der Kirche,
die bisher archäologisch nicht nachgewiesen werden konnte, ereignete
sich am 7. September 456 n. Chr. ein Erdbeben. Das oppidum Comagenis
war bei Severins Ankunft noch durch Mauern und Tore geschützt, die von
barbarischen Föderaten bewacht wurden. Mit dem Befehl Odoakers zum
Abzug der romanischen Bevölkerung nach Italien im Jahr 488 n. Chr.
erlosch das römische Leben in Comagenis endgültig.
Ankunft des heiligen Severin vor den Toren von Comagenis, 454 n. Chr.

MITHRASKULT
Der Mithraskult, der sich seit dem frühen 2. Jh. n. Chr. nahezu in
allen Provinzen des Römischen Imperiums ausbreitete, hat seinen
Ursprung im persischen Kulturraum. Mithra war ein aus dem Felsen
geborener iranischer Licht- und Sonnengott. Von Rom ausgehend, wo der
Kult eine neue Ausprägung erfuhr, gelangte Mithras vor allem durch das
Militär an die Nordgrenze des Reiches an Rhein und Donau. Ein Großteil
der Anhänger waren Soldaten, während Frauen grundsätzlich nicht
zugelassen waren.
Der Mithraskult war ein Mysterienkult, der nur den zur Geheimhaltung
von Glaubensinhalten und Ritualen verpflichteten Eingeweihten
zugänglich war. Unsere Kenntnisse über den Kult beruhen daher
weitgehend auf bildlichen Darstellungen, Inschriften und
archäologischen Befunden. Die Kultbauten für Mithras (Mithräen) waren
meist höhlenartig in den Fels gehauen oder unterirdisch angelegt.
Zentrum des Kultraumes war stets die Darstellung der Stiertötung durch
Mithras. Der Gott, der häufig den Beinamen Sol invictus trägt, wird als
Jüngling mit phrygischer Mütze und wehendem Mantel, dessen Innenseite
oft mit einem Sternenhimmel dekoriert ist, abgebildet. Das zentrale
Motiv umgeben Sol und Luna sowie Tiere - Schlange, Rabe, Hund, Skorpion
und Löwe - als Abbild des Kosmos, den Mithras am Leben erhält. Die
Szene flankieren die beiden Fackelträger Cautes und Cautopates, die als
Begleiter des Mithras die Gegensätze von Tag und Nacht oder Anfang und
Ende des kosmischen Kreislaufes symbolisieren.
Die Symbolik der Kultbilder bezieht sich auf bestimmte Konstellationen
der Sternbilder, die mit der Deutung kosmischer Zyklen in Verbindung
stehen. Die Einweihung in die Mysterien erfolgte in sieben mit
Mutproben und Einweihungsriten verbundenen Weihegraden, die mit den
Planeten und Wochengöttern gleichgesetzt wurden. Hinweise auf rituell
abgehaltene Kultmahle geben bei Ausgrabungen in den Mithräen gefundene
Keramikgefäße, Kultgeräte und Tierknochen. Unter Kaiser Theodosius I.
(379-395 n. Chr.) wurde der Mithraskult 391 n. Chr. zusammen mit
anderen heidnischen Kulten verboten.
Mithrasrelief - Um 1720
gefunden in St. Andră vor dem Hagenthale Marmor, Mitte 3. Jh. n. Chr.
In einer halbrund abgeschlossenen Nische, die das Himmelsgewölbe
andeutet, ist die Stiertötungsszene dargestellt. Mithras mit wehendem
Mantel und phrygischer Mütze kniet auf dem zusammenbrechenden Stier und
tötet ihn. Rechts und links die beiden Fackelträger Cautes und
Cautopates, darüber Büsten von Sol und Luna, ein Rabe, unter dem Stier
ein Skorpion, eine Schlange und ein Hund. Das Votivbild wurde von einem
gewissen Verus für ein Mithräum gespendet, das sich wohl im Hinterland
des Limes befand.

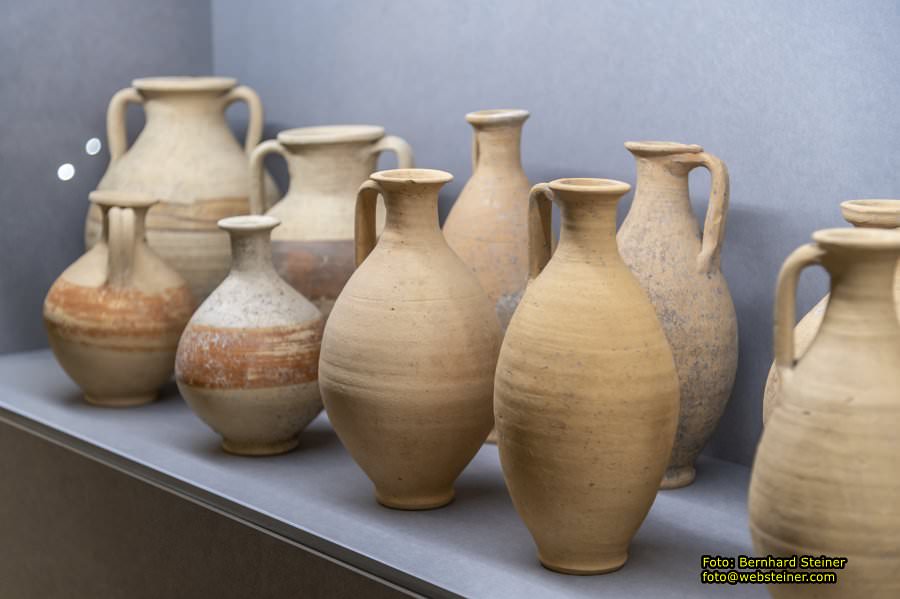
Lucius Calidius Eroticus hat diesen Grabstein für sich und seine
Liebste Fannia zu Lebzeiten machen lassen.
Wirt, lass uns abrechnen!
Du hast ein Viertel Wein und Brot - macht ein As;
Fürs Essen - zwei Asse.
Geht in Ordnung.
Ein Mädchen - macht acht Asse.
Geht in Ordnung.
Heu fürs Maultier - zwei Asse.
Dieses Maultier wird noch einmal mein
Ruin sein!


Urnengrab, Gräberfeld West, 2.
– 3. Jh. n. Chr.
Nachgestelltes Brandgrab mit Urne, zahlreichen Öllampen und einer
Räucherschale

GÖTTER UND KULTE
In der Religion der römischen Antike war im Gegensatz zum Christentum,
Judentum und Islam die Verehrung einer Vielzahl von personifizierten
und handelnden Göttern üblich. Die Römer glaubten an das Lenken der
Geschicke des Einzelnen und des Staates durch die Götter. Zu den
öffentlichen Kulten gehörte neben der Verehrung der höchsten römischen
Götterinstanz, der Kapitolinischen Trias Jupiter, Juno und Minerva, vor
allem der Kaiserkult. In den römischen Provinzen traf die
mittelmeerische Götterwelt auf einheimische Glaubensvorstellungen.
Gleichberechtigt mit den staatlichen Kulten gab es zahlreiche lokale
und private Kulte, die toleriert wurden. Mit den Soldaten und Händlern
kamen zahlreiche religiöse Strömungen aus den östlichen Reichsteilen in
die Provinzen. Ab dem 2. Jh. n. Chr. genossen Mysterienkulte (Isis,
Jupiter Dolichenus, Mithras) immer größere Popularität,
Geheimreligionen, die nur einem ausgewählten Kreis zugänglich waren.
Die meisten von ihnen scheinen Antworten auf die Fragen nach dem Sinn
des Lebens und nach dem, was die Menschen nach dem Tod erwartet,
gegeben zu haben.
Vor allem der Mithraskult, der seinen Ursprung im persischen Kulturraum
hatte, war bei den Soldaten beliebt.
Der Staatskult endete im 4. Jh. n. Chr. mit den kaiserlichen
Toleranzedikten zugunsten des Christentums und dem späteren Verbot
nichtchristlicher Religionen. Im privaten Bereich hatte die Verehrung
der Hausgötter einen festen Platz im täglichen Leben. Jede Familie
hatte ihren Kultschrein (larariurn) für die Schutzgötter des Hauses und
der Familie, die Laren und Penaten. Man brachte ihnen täglich Speise-
und Trankopfer dar und verbrannte Weihrauch in Räucherschalen. Zum
Schutz trug man Unheil abwehrende Amulette oder weihte verschiedenen
Göttern Ton- oder Bleifigürchen. Unser Wissen über die Götter des
römischen Tulln beruht auf wenigen Einzelinformationen, Steinreliefs
mit Götterdarstellungen und Funden wie Statuetten oder Votiven.
Kultbauten und Heiligtümer konnten archäologisch bisher nicht
nachgewiesen werden.

Kleidung in der Provinz
Mode war auch in römischer Zeit ein wichtiges Thema und Ausdruck einer
gesellschaftlichen und persönlichen Identität. Im Gebiet der römischen
Provinzen waren viele Völker vertreten, die ihre eigene Tracht
beibehielten und erst nach einiger Zeit die Kleidungsart der Römer
übernahmen und damit ihre Romanisierung zum Ausdruck brachten. Vor
allem Darstellungen auf Grabsteinen und Trachtbestandteile aus Gräbern
zeigen, dass Frauen im Gegensatz zu Männern oft lange Zeit an ihren
einheimischen Trachten festhielten. Kleidung kennzeichnete die Stellung
einer Person innerhalb der Gesellschaft. Die standesgemäße Kleidung
eines römischen Bürgers war die Toga, die von römischen Frauen die
Palla, ein Umhang, über einer Tunika. In den Provinzen an der mittleren
Donau trugen Männer eine knielange Tunika mit Ärmel, lange Hosen und
einen an der rechten Schulter mit einer Fibel zusammengehaltenen Mantel
(sagum). Daneben gab es auch Kapuzenmäntel aus dichtem,
wasserundurchlässigem Wollstoff (paenulae).
Frauen trugen in Noricum und Pannonien eine eigenständige Tracht: über
einem knöchellangen Untergewand ein festes ärmelloses Obergewand, das
an den Schultern mit je einer Fibel zusammengehalten wurde, sowie einen
breiten, mit Metallbeschlägen verzierten Ledergürtel. Als Schmuck
dienten Halsketten, Armreifen, Fingerringe und Broschen. Regional
unterschiedlich waren die Kopfbedeckungen, in Noricum war die
sogenannte norische Haube, ein am Hinterkopf zusammengebundenes Tuch
mit breitem Wulst, üblich. Eine besondere Rolle spielten bei regionalen
Frauentrachten Schmuck und Fibeln. Ihre Verbreitung grenzt die Region
ab, in der die Tracht getragen wurde. Typisch für die norische Tracht
sind die sogenannten Flügel- und Doppelknopffibeln sowie
mondsichelförmige Anhänger.

Spätantike Keramik, 4. - 5. Jh.
n. Chr.
Handgeformte germanische Keramik
Becher mit Radmarken auf dem Boden aus grauem und orangem Ton
Henkelkrüge mit Glasur und Einglättverzierung

Brunnenfund Tulln,
Bahnhofstraße, 2. - 3. Jh. n. Chr.
Haushaltskeramik aus dem südlichen Vicus von Comagenis, die sekundär in
einem Brunnen entsorgt wurde

DIE GRENZEN DES RÖMISCHEN REICHES
Das Imperium Romanum war flächenmäßig eines der größten Reiche der
Weltgeschichte. Seine rund um das Mittelmeer verlaufenden Grenzen
definierten und schützten seinen etwa 800-jährigen Bestand. Das
Römische Weltreich mit einer Fläche von etwa 6.250.000 km² und
mindestens 100 Millionen Einwohnern umfasste Teile von Europa, Asien
und Afrika, heute rund 50 Staaten. Seine Grenzen bildeten Flussläufe
(Rhein, Donau, Euphrat), befestigte Landgrenzen (Großbritannien,
Deutschland) und Wüstengebiete (Vorderasien, Nord-Afrika).
Entlang der etwa 7.500 km langen Grenze waren bis zu einer halben
Million Berufssoldaten stationiert, gemessen an der Ausdehnung des
Reiches eine eher geringe Anzahl. Die Truppenverteilung mit einem
Schwerpunkt vor allem an der Nord- und Ostgrenze des Reiches lässt die
Krisenzonen erkennen. Die Grenzen waren aber kein starres militärisches
Verteidigungssystem gegen Angriffe größerer Truppenkonzentrationen. Sie
bildeten eine vom Militär bewachte Kontrolllinie gegen räuberische
Überfälle und sicherten vor allem einen friedlichen Grenzverkehr von
Menschen und Waren. Sie garantierten die Stabilität und das damit
verbundene Wirtschaftswachstum des Reiches. Das Heer war die wichtigste
Stütze der Herrschaft und Verwaltung des Römischen Imperiums und hatte
durch seine hohe Mobilität maßgeblichen Einfluss auf die Verbreitung
römischer Lebensweise und Wertevorstellungen. Die Grenzen des Römischen
Reiches sind Teil des gemeinsamen Kulturerbes zahlreicher Länder auf
drei Kontinenten.

Das Römermuseum ist im ehemaligen 1280
von König Rudolf von Habsburg
gestifteten Frauenkloster untergebracht. Es zeigt anhand von
Originalfunden aus dem Stadtbereich und weiteren Objekten wie
Figurinen, Modellen und Landkarten das militärische Leben sowie das
zivile Leben im Römerlager Comagensis und die Grabkultur jener Zeit.
Das Römische Reich im späten 2. Jh. n. Chr.

DER ÖSTERREICHISCHE LIMES
Zu Beginn des 1. Jhs. n. Chr. wurde das Territorium des heutigen
Österreichs bis zur Donau in das Römische Weltreich eingegliedert. Die
Donau bildete nunmehr bis zum Ende des 5. Jhs. n. Chr. die Grenze
zwischen Römischem Imperium und Freiem Germanien. Entlang dieser
Flussgrenze entstanden in der Folge Befestigungsbauten an strategisch
wichtigen Übergangsstellen sowie Straßenverbindungen in das Hinterland.
Der österreichische Abschnitt des Donaulimes bildete die Nordgrenze der
römischen Provinz Noricum und eines Teiles der Provinz Oberpannonien.
Diesen 360 Kilometer langen Limesabschnitt sicherten eine Reihe von
militärischen Anlagen mit einer Truppenstärke von etwa 25.000-30.000
Mann: 3 Legionslager sowie 18 Hilfstruppenlager und über 20 Wachtürme
(Burgi).
Das erste befestigte Standlager am österreichischen Limes entstand um
40 n. Chr. in Carnuntum. Der systematische Ausbau der Donaulinie mit
Kastellen und Wachtürmen setzte nach der Mitte des 1. Jhs n. Chr. ein.
In Folge neuer militärischer Anforderungen an der Wende vom 3. zum 4.
Jh. n. Chr. wurden die Kastelle mit bastionsartigen Türmen, sogenannten
Fächer- und Hufeisentürmen, verstärkt. Ein letzter Ausbau erfolgte im
ausgehenden 4. Jh. n. Chr. unter Kaiser Valentinian I. In den Ecken der
älteren Lager wurden Kleinkastelle errichtet, im Lagerareal siedelte
sich die Zivilbevölkerung an. Im Lauf des 5. Jhs. n. Chr. wurden die
beiden Provinzen Pannonien (433 n. Chr.) und Noricum (488 n. Chr.) von
den Römern aufgegeben. Eine Besonderheit des österreichischen Limes
sind die an vielen Kastellorten noch gut erhaltenen Teile der römischen
Befestigungen.
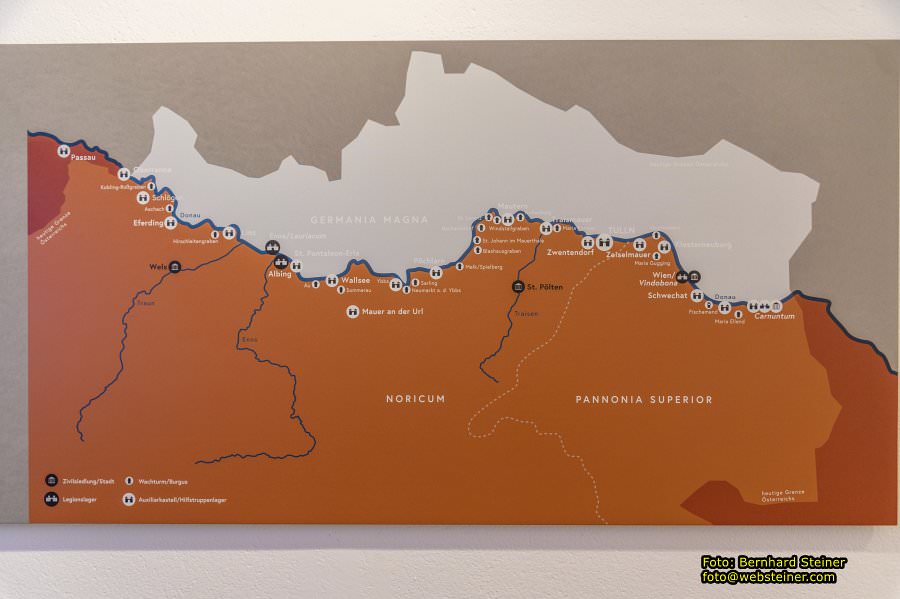
Reliquienkopf
Einer Legende nach erlitten während der Völkerwanderung die bretonische
Königstochter Ursula und ihre Begleiterinnen auf dem Rückweg von einer
Pilgerfahrt nach Rom in Köln einen gewaltsamen Tod durch die Hunnen. Im
12. Jahrhundert entdeckte man außerhalb der Stadt ein römisches
Gräberfeld und brachte es mit der Heiligenlegende in Verbindung. Die
Missinterpretation einer Inschrift dürfte dabei aus elf Märtyrerinnen
11.000 gemacht haben. Der darauf einsetzende schwunghafte Handel mit
Reliquien wurde erst gegen Ende des 14. Jahrhunderts durch ein
päpstliches Ausfuhrverbot eingedämmt.
Das Tullner Frauenstift soll mehr als 100 in Silber gefasste Köpfe der
Gefährtinnen der heiligen Ursula besessen haben. Bei der Aufhebung des
Klosters waren noch über 30 Schädel vorhanden. Auf Initiative einer
Nonne wurden sie nach Wien (St. Ursula) gebracht. Nur ein einziger
blieb erhalten.

Im Eingangsbereich des Museums widmet sich eine Dokumentation der
Geschichte des Gebäudes. Das im Jahr 1280 gegründete sogenannte
"kaiserliche Frauenstift" ist wohl das geschichtlich bedeutendste
Monument der Stadt. Es wurde von Rudolf von Habsburg zum Gedenken an
seinen Sieg über König Ottokar gestiftet. Die Dokumentation stellt
Entstehung, Geschichte, Besitz und Verwaltung des Tullner
Dominikanerinnenklosters sowie das Leben der Nonnen in einer kleinen,
aber modernen Schau dar.
Altarpyramiden mit Reliquien
von Jungfrauen aus der Gesellschaft der heiligen Ursula, die der
Legende nach im 4. Jahrhundert in Köln den Märtyrertod starben.

Ebenfalls im Stadtmuseum Tulln befindet sich das Virtulleum. Erleben
Sie Ihre ganz persönliche Stadtexpedition, entdecken Sie ausgewählte
Orte und spannende Details der Stadt. Die Virtulleum-APP gibt es in den
App-Stores von Apple oder Google Play gratis zum Herunterladen.
Hochrad, Alter: ca. 130 Jahre
Das Rad gehörte vermutlich einem Mitglied des Tullner Radfahrerclubs.
Durch die Vergrößerung des Antriebsrades beim Laufrad musste der Sattel
höhergelegt werden. Das war die Geburt des Hochrades.

Sonntagberger Gnadenstuhl,
Alter: ca. 350 Jahre
Die Holzskulptur zeigt die Hl. Dreifaltigkeit. Mit ihr sollte göttliche
Hilfe im Abwehrkampf gegen die Osmanen erbeten werden.

Marc Aurel-Denkmal an der Donaulände
DER RÖMISCHE KAISER UND HERRSCHER
MARCUS AURELIUS ANTONINUS PIUS AUGUSTUS
161 N. CHR.- 180 N. CHR.

RÖMERTURM
Vollständig erhaltener Seitenturm des römischen Kastells Commagenis aus
dem 4. Jhd. Bis ins 13. Jhd. Teil der ältesten Stadtbefestigung und
Schutzbau für den Donauhandel. Seit dem 15. Jhd. städtisches Zeughaus,
im 19. Jhd. Salzmagazin. (ehem. Salzturm) Restauriert 1984 und 2004.

Das neu gestaltete Egon Schiele Museum am
Donauufer bietet unter dem Titel „Egon Schiele privat“ mit
Original-Interviews, audiovisuellen Installationen,
Wohnzimmer-Atmosphäre und Originalwerken eine intensive Begegnung mit
Tullns berühmtestem Sohn.

Porträtstudie einer Frau mit Tuch, 1907, schwarze Kreide auf Papier
Porträtstudie eines Mannes mit Hut, 1907, schwarze Kreide auf
Papier
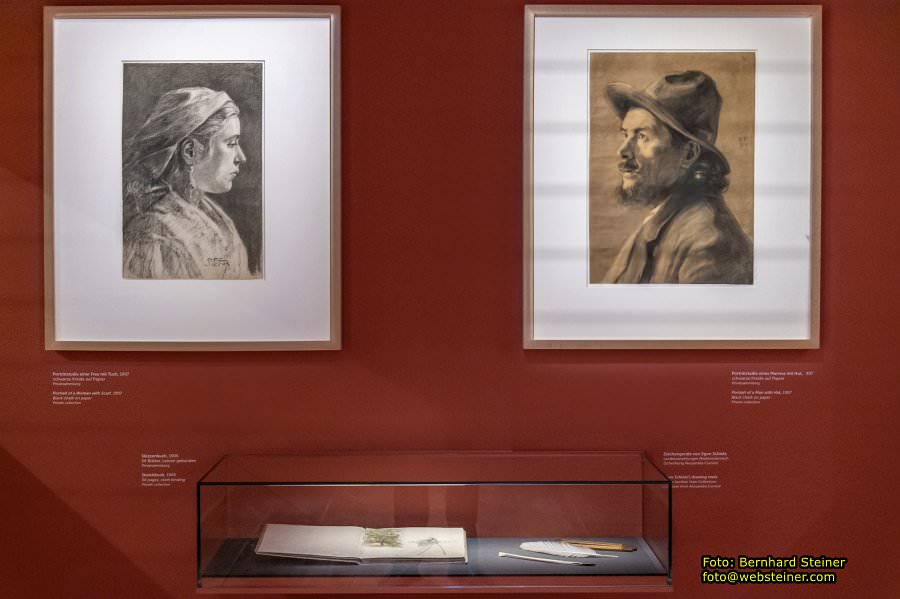
Kriegsgefangener russischer Soldat, 1916, Kreide und Bleistift auf
Papier
Edith Schieles Hund Lord, 1918, schwarze Kreide auf Papier
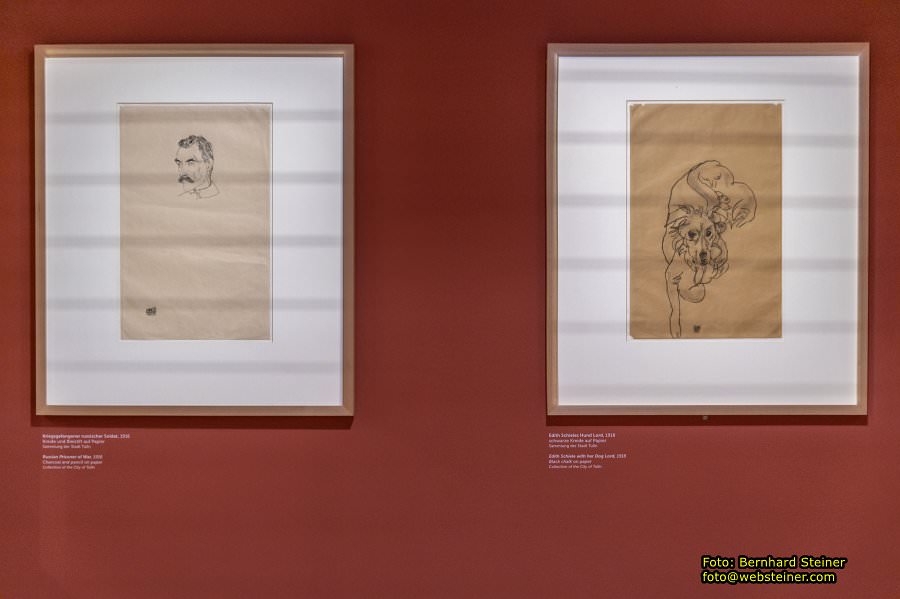
Mädchen mit grünen Strümpfen, 1914, Bleistift, Aquarell- und
Temperafarben auf Packpapier

Zwei liegende Mädchenakte, 1914, Bleistift auf Packpapier

Adolf und Marie Schiele, fotografiert von Fritz Luckhardt, Wien, o. J.,
Sammlung Gradisch
Melanie Schiele mit selbstgefertigtem Hut, um 1908, anonym/Imagno/APA
Picturedesk
Gerti Schiele vor dem Spiegel in Egon Schieles Atelier, um 1910, k.
A./Imagno/APA Picturedesk
Schieles bevorzugtes Modell Wally Neuzil, 1913 Imagno/APA Picturedesk
Edith Schiele mit Zigarette, o. J., Sammlung Gradisch

1890 Egon Schiele wird als Sohn
des Bahnhofsvorstands in Tulln geboren.
1901 Nach der Volksschule
wechselt Egon Schiele für einige Monate an das Realgymnasium in Krems.
Der Bub entwickelt eine Liebe zur Stadt am Tor zur Wachau, die ihn Zeit
seines Lebens nicht mehr loslassen wird.
1902 Schiele wechselt mit dem
zweiten Jahr in das neu errichtete Landesrealgymnasium Klosterneuburg.
Damit beginnt ein neuer Abschnitt: Die Stadt wird für die nächsten
Jahre zum Lebensmittelpunkt des Buben.
1904 Tragischer Tod des
geliebten Vaters an Syphilis. Der Onkel Leopold Czihaczek wird zum
Vormund des Buben.
1906 Beginn des Studiums an der
Wiener Kunstakademie. Schiele reibt sich von Beginn an am
Akademiebetrieb, erhält dort aber auch Impulse für sein späteres
Schaffen.
1911 Mit seiner Geliebten Wally
Neuzil wohnt Schiele zunächst in Krumau,
dann in Neulengbach. Das Lebensumfeld in Neulengbach beeindruckt ihn so
sehr, dass er für immer bleiben will.
1912 Schiele verbringt eine
dreiwöchige Untersuchungshaft im Gefängnis
Neulengbach. Die ursprüngliche Anklage wegen Kindesentführung und
Schändung wird im Urteil auf eine Verletzung der öffentlichen
Sittlichkeit reduziert.
1915 Heirat mit Edith Harms die
mit ihrer Schwester Adele das Haus gegenüber
Schieles Wohnung in der Hietzinger Hauptstraße in Wien bewohnt. Schiele
wird einberufen und dient im Ersten Weltkrieg im Verwaltungsbereich.
1916 Versetzung in ein Lager
für russische Kriegsgefangene in Mühling bei
Wieselburg. wo Schiele als Schreiber der Offiziersstation eingesetzt
wird und Ausflüge in die Umgebung unternimmt. Er malt sein
bedeutendstes Landschaftsbild, die Zerfallende Mühle'.
1918 Schiele erlebt mit einer
großen Ausstellung der Wiener Secession seinen größten Erfolg. Im
selben Jahr stirbt der Künstler 28-jährig nur wenige Tage nach seiner
Ehefrau an den Folgen der Spanischen Grippe in Wien.

Selbstbildnis mit langem Haar (Studie), 1907, Öl auf Leinwand
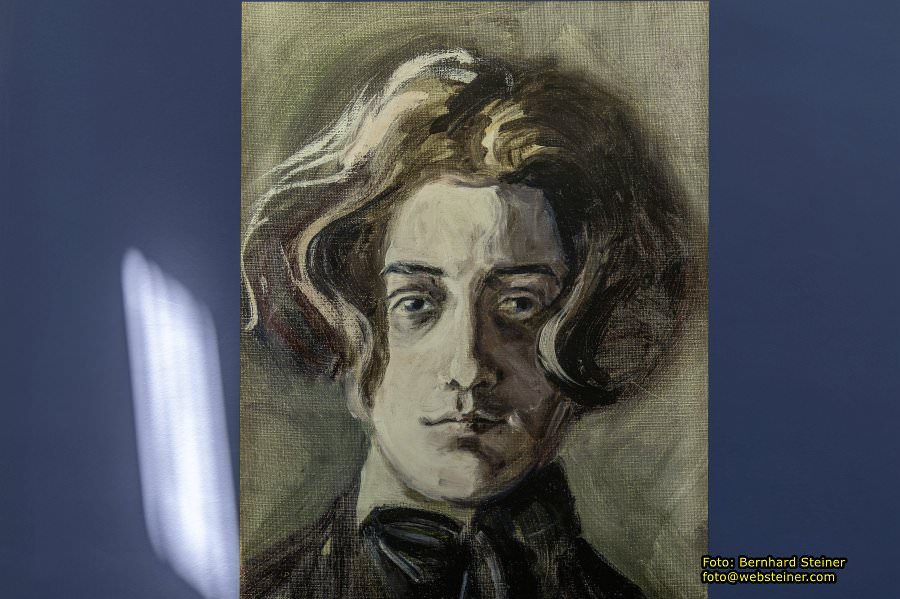
DIE FAMILIE LEOPOLD
Rudolf Leopold (1925-2010) hat ein gewaltiges Lebenswerk hinterlassen.
Der gegenwärtige Stellenwert des Schaffens von Egon Schiele wäre nicht
denkbar ohne Leopolds historische Leistung: vom Aufbau einer
einzigartigen Sammlung über Ausstellungen von New York bis Tokio und
die Gründung des Leopold Museums bis hin zur publizistischen Erfassung
und Interpretation von Schieles Werk. All das wird bis heute von
Elisabeth Leopold, der Witwe des Sammlers, und deren Familie begleitet,
fortgesetzt und vertieft. Diethard Leopold, Sohn des Sammler-Ehepaars,
kuratiert in der Vergangenheit wiederholt Ausstellungen im Leopold
Museum, publiziert Bücher über Egon Schiele und das Lebenswerk seines
Vaters. Mit Egon Schiele teilt Diethard Leopold die große Liebe zur
Kunst und Kultur Japans.
Bauernkrüge, chinesische und
japanische Figuren - Leopold Privatsammlung
Egon Schiele sammelt volkskundliche Gegenstände und asiatische Figuren.
Beides wird auch zu Sammlungsbereichen von Rudolf Leopold, die sein
Sohn Diethard bis heute weiterführt.
Zwei böhmische farbig bemalte Blumenvasen, Ende 19. Jh., Ton
Erleuchteter Mönch mit Buddhafigur hervortretend aus dem Tanden
(Bauch-Becken-Bereich), Okimono (Nippes), China, Ende 19. Jh., Elfenbein
Hofdame mit Hündchen, Okimono, China, Ende 19. Jh., gebräuntes Elfenbein
Figur des General Kann'u, Japan, Netsuke, um 1800, Elfenbein
Figuren des „Langarm und Langbein", Japan, um 1800, Elfenbein
Figur des Sei'obo, des weiblichen Bodhisattva der Langlebigkeit, Japan,
um 1800, Elfenbein
Figuren des Langarm und Langbein", Japan, erste Hälfte 19. Jh.,
Buchsbaumholz
Große Kröte, Japan, Ende 18. Jh., Elfenbein

ALESSANDRA COMINI - eine Reise, die
Geschichte schrieb
Die Egon-Schiele-Pionierin Alessandra Comini kam als junge
Wissenschaftlerin aus Dallas/Texas nach Wien, um ihr künftiges
Forscherleben jenem Künstler zu widmen, den sie in einer kleinen
Ausstellung in Berkeley/Kalifornien kennengelernt hatte. An einem
sonnigen Augustmorgen des Jahres 1963 mietete sie einen Volkswagen und
brach zu einer mittlerweile legendären Reise durch Schieles
Niederösterreich auf. Comini machte Station in Klosterneuburg, Tulln
und Neulengbach, später kamen Krems und Mühling dazu. Sie besuchte das
Gymnasium in Klosterneuburg, die Geburtswohnung in Tulln und das
Gefängnis in Neulengbach, wo Schiele 21 Tage lang eingesperrt gewesen
war. An jenem ereignisreichen Tag, den Comini als Höhepunkt ihres
Forscherlebens bezeichnet, machte sie Fotos an allen besuchten Orten
und schickte sie den Schwestern Egon Schieles. Es kam zu Treffen mit
Melanie und Gerti sowie mit Schieles Schwägerin Adele. Dabei entstanden
langjährige Freundschaften und einzigartige Tonband-Interviews, die
einen authentischen, sehr persönlichen Blick auf das Leben des
Künstlers ermöglichen.
Tonbandgerät Tandberg Series 15 SL, Kofferausführung Baujahr ca. 1969.

Porträt Alessandra Comini mit Rolleiflex-Kamera, Anfang 1960er-Jahre.
Porträt Alessandra Comini auf dem Anwesen der Familie Fogarassy in
Graz, September 1963.
Kamera Rolleiflex Automat 6x6, Baujahre 1951-1954.

WEGE ZU SCHIELE
Egon Schiele trifft den Zeitgeist in beeindruckender Weise. Er führte -
den widrigen Rahmenbedingungen seiner Zeit zum Trotz - ein modernes,
selbstbestimmtes Leben. Viele seiner Werke haben einen starken Bezug
zur Ästhetik der Gegenwart. Es scheint, als wären sie gerade erst
entstanden. Seit einem Jahrhundert arbeitet die Forschung daran, Leben
und Werk des Künstlers zu verstehen und zu deuten. So unterschiedlich
die Zugänge, so reich sind die Facetten einer Gesamtsicht auf sein
Œuvre, und das ist nicht zuletzt dessen künstlerischer Größe
geschuldet. Die Einzigartigkeit und die Rätselhaftigkeit seiner Kunst
bieten sich als Ausgangspunkt für weitere hundert Jahre der Forschung
an, die mit Sicherheit neue Entdeckungen und Erkenntnisse zutage
fördern wird.

ERWIN OSEN - Egon Schieles
Künstlerfreund
Erwin Osen (1891-1970) prägt als charismatischer Künstlerfreund Egon
Schieles die Schlüsseljahre des Wiener Frühexpressionismus mit. Osen
ist als Universalkünstler einzigartig, ein „It-Man" der Moderne.
Ausstattung und Bühnenbild, Schauspiel und Pantomime, Gesang, Kabarett
und Regie vom Theater über den Stumm- zum Tonfilm, Kameratechnik, dazu
Malerei und Grafik: Die Spielarten seiner Kunst sind schier grenzenlos.
Die facettenreiche Beziehung zu Egon Schiele erreicht eine Intensität,
die dessen radikales Schaffen beflügeln sollte. Hauptwerke der
österreichischen Kunst sind die Folge. Anders als Schiele gerät Erwin
Osen aber in Vergessenheit. Heute kann er neu entdeckt werden.
Erwin Osen, Patienten-Porträts
der „Irrenanstalt" Steinhof
1913 erhält Erwin Osen vom Mediziner und Kunsthistoriker Adolf Kronfeld
den Auftrag, Patienten und Patientinnen der Irrenanstalt" auf dem
Steinhof für den Naturforschertag" zu porträtieren. So entstehen zwölf
Bildnisse, deren Empathie beeindruckt. Osen widmet sich darin den
Menschen, die Krankheit spielt eine untergeordnete Rolle.
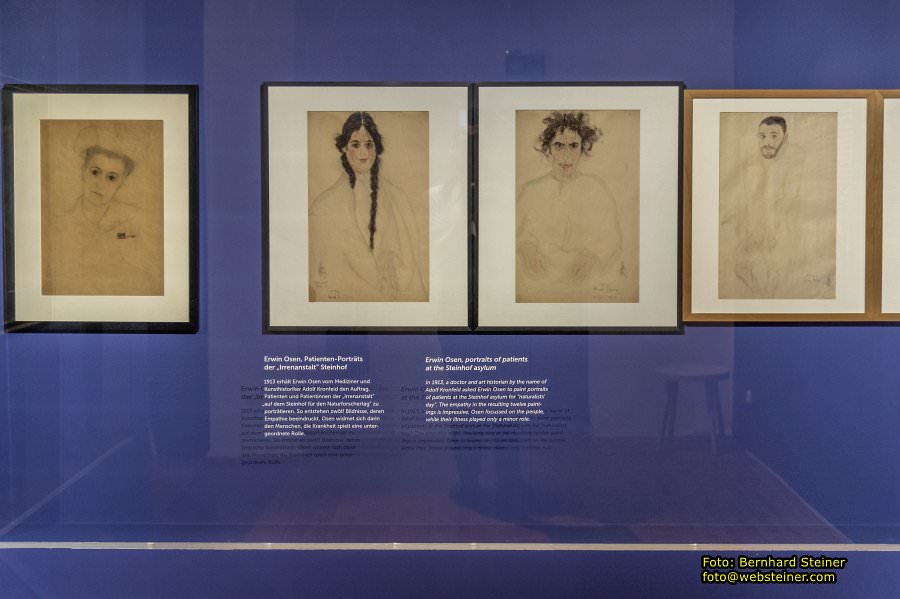
Den künstlerischen Schwerpunkt des Museums bildet seit 2011 die Epoche
von der Geburt bis zur Gründung der eigenen Künstlergruppe, der
„Neukunstgruppe“ im Jahr 1909. Mit Blickpunkt auf die Anfänge des
Künstlers wird nicht nur eine Lücke in der österreichischen
Museumspräsentation geschlossen, sondern es ist auch möglich geworden,
die Ausstellung ausschließlich mit Originalen auszustatten. Die Werke
stammen aus den Sammlungen der Stadtgemeinde Tulln und des Museums
Niederösterreich sowie einer weiteren privaten Sammlung.
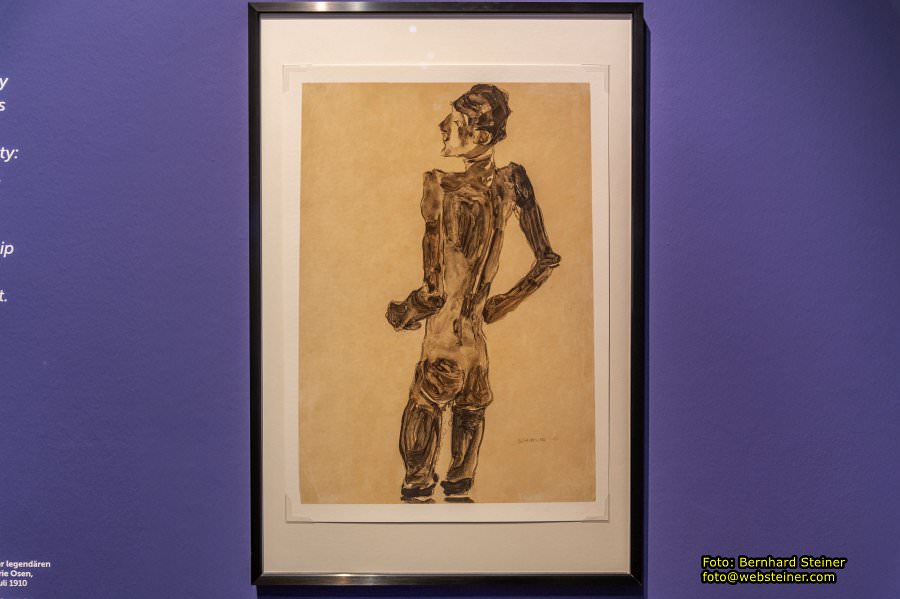
Die Stadtgemeinde Tulln begann 1980, ein eigenes Egon-Schiele-Museum in
Tulln zu planen und erwarb zu diesem Zweck das renovierungsbedürftige
Bezirksgefängnis, welches 1898 erbaut worden war. Von 1985 bis 1990
wurde das alte Gefängnisgebäude des Bezirksgerichtes Tulln saniert und
zu einem Museum adaptiert. Eine noch ursprünglich vorhandene
Gefängniszelle wurde dann jener Zelle des Neulengbacher Gefängnisses
nachempfunden, in welcher Egon Schiele im Jahr 1912 drei Wochen hatte
zubringen müssen.
Zelle 2: 11,75 m², 42,2 m³, Belag 3

DEM ANDENKEN AN IHREN GROSSEN SOHN
EGON SCHIELE
TULLN 12.VI.1890-WIEN, 31.X.1918
DER MIT SEINER KUNS DIE WELT EROBERTE, WIDMET DIE STADIGEMEINDE TULLN
MIT UNTERSTÜTZUNG DES LANDES NIEDERÖSTERREICH DIESES MUSEUM ZUM 100.
GEBURTSTAG 12.JUNI 1990

Das Egon-Schiele-Museum in Tulln an der Donau ist ein
niederösterreichisches Museum für bildende Kunst, das dem 1890 in Tulln
geborenen Maler Egon Schiele gewidmet ist.

Die Stadt Wien ist ein 1939
gebautes dieselelektrisches Rad-Motorschiff der ehemaligen
Donaudampfschiffahrtsgesellschaft DDSG. Sie befährt heute von Tulln aus
die österreichische Donau. Das Schiff besitzt zwei dieselelektrische
Antriebsanlagen, diese sind mit Baujahr 1939 noch original. Als Antrieb
dienen zwei je 460 PS starke Achtzylinder-Viertakt-Dieselmotore der
Gebrüder Sulzer AG vom Typ Mod.8 DDA 22. Diese wirken mit einer
Drehzahl von 500 Umdrehungen pro Minute auf je einen Generator, welcher
bei 240 V und 550 Ampére eine Leistung von 298 kW entwickelt.

Zum Nibelungenlied
Der König des Burgunderreiches am Rhein, Gunther, hat mit Hilfe des
berühmten Siegfried, der eine Tarnkappe besitzt, die mächtige Königin
Brunhild erobert. Siegfried erhält dafür seine geliebte Kriemhild,
Gunthers schöne Schwester, zur Frau. Doch Siegfrieds Verhalten bei
dieser Eroberung bleibt im Dunklen, deshalb kommt es zwischen den
beiden Königinnen zum Streit: Kriemhild nennt ihre Schwägerin in aller
Öffentlichkeit eine Dirne und beleidigt damit Brunhilde tödlich. Diese
fordert daraufhin vom düsteren Hagen Hilfe und der ermordet Siegfried
hinterlistig. König Gunther aber sühnt diesen Mord nicht, und Hagen
nimmt Kriemhild auch Siegfrieds Hort, einen reichen Schatz, weg.
Deshalb sinnt Kriemhild auf Rache: Als der mächtige Hunnenkönig Etzel
um sie wirbt, heiratet sie ihn, weil sie hofft, mit seiner Macht ihre
Rachepläne ausführen zu können. Sie lädt ihre Brüder und die
burgundischen Großen samt Gefolgschaft ins Hunnenland ein und lockt sie
so ins Verderben. Einzig Hagen durchschaut Kriemhilds Absicht. Da sie
diesen, ihren Todfeind, aber nicht allein in ihre Gewalt bringen kann,
lässt sie alle Burgunden und auch ihre königlichen Brüder in einem
blutigen Gemetzel umbringen. In diesem Kampf sterben aber auch viele
hunnische und germanische Gefolgsleute Etzels. Zuletzt stirbt auch
Hagen durch Kriemhilds Hand, weil er das Versteck des Hortes nicht
preisgeben will.
Doch auch Kriemhild überlebt ihren blutigen Sieg nicht: Der
Waffenmeister Hildebrand, der es nicht ertragen kann, dass der
heldenhafte Hagen durch eine Frau sterben musste, haut Kriemhild in
Stücke. Der Verfasser dieses berühmtesten deutschen Heldenepos war
vermutlich ein Zeitgenosse Walthers von der Vogelweide, der im Donautal
zwischen Passau und Wien beheimatet war. Die Schauplätze des
Nibelungenliedes sind Worms, Pöchlarn, Traismauer und Tulln, dann Wien
und zuletzt die Arpadenburg in Estergom, die in dieser Dichtung Etzels
Burg darstellt. Das Werk wurde um 1200 geschrieben.
Schauplatz
Auf ihrer Brautfahrt ins Hunnenland trifft Kriemhild, von Traismauer
kommend, hier in Tulln den König Etzel und sein Gefolge. Dieses Treffen
schildert der Dichter in den adeligen Lebensformen der Zeit um 1200:
Kriemhild steigt vom Pferd, zwei Fürsten tragen ihre Schleppe, und
Markgraf Rüdiger, ihr Begleiter, stellt ihr den König und dessen
zahlreiche Gefolgsleute, Hunnen und Germanen, vor. Zu Ehren der
künftigen Königin finden dann auf dem Tullnerfeld ritterliche
Kampfspiele statt, in denen Etzel die tausendfache Heeresmacht seines
Reiches zur Schau stellt. Dem Dichter ist dieses Ereignis hundert Verse
wert. Von Tulln zieht man weiter nach Wien, wo in aller Pracht Hochzeit
gefeiert wird. Dass der Dichter Kriemhild und Etzel hier in Tulln
einander begegnen lässt, zeigt die Bedeutung der Stadt um 1200. Sicher
schwingt auch die Erinnerung des Dichters mit, dass 250 Jahre vor
seiner Zeit etwa hier die Grenze zwischen dem Westen (damals
Deutschland) und dem Osten (damals Ungarn) verlief.
Nibelungendenkmal
Die Figurengruppe links umfasst zwei schleppetragende Fürsten, Markgraf
Rüdiger und Kriemhild, jene rechts den König Etzel, seinen Bruder Bleda
und die Könige Dietrich von Bern und Gibich. Mit dem Kind weist der
Dichter auf die Nachkommen aus dieser Verbindung hin. Die verschränkten
Fontänen des Brunnens sollen die Verbindung zwischen West und Ost
symbolisieren. Das aufgeschlagene Buch weist auf die schriftliche
Überlieferung des Liedes hin. Die rechte Seite ist leer - die Zukunft
ist noch ein unbeschriebenes Blatt. Die Figuren bestehen aus Bronze,
hergestellt im Hohlgussverfahren. Sie stammen vom Bildhauer Prof.
Michail Nogin, der Brunnen von Prof. Hans Muhr. Das Denkmal wurde im
Sommer 2005 errichtet. Das Denkmal liegt, nur ca. 250 m vom Hauptplatz
entfernt, direkt an der Donaulände am nördlichen Ende des
Nibelungenplatzes.

Die Regentag ist eine ursprünglich im Jahr 1910 als reines Motorschiff
gebaute hölzerne Ketsch, die Ende der 1960er Jahre von dem
österreichischen Künstler Friedensreich Hundertwasser erworben und
umgebaut wurde, bis zu seinem Tod in dessen Besitz war und auf der
dieser über zehn Jahre lang lebte und arbeitete. 2004, vier Jahre nach
dem Tod des Künstlers, wurde die Regentag anlässlich einer
Hundertwasser-Ausstellung nach Tulln an der Donau gebracht.

Ob Bauerngarten, Rosengarten oder
Forschergarten – DIE GARTEN TULLN, Europas erste ökologische
Gartenschau mit 70 Schaugärten, bietet ein abwechslungsreiches
Programm. Niederösterreichs größter Abenteuer- und Naturspielplatz, der
30 Meter hohe Baumwipfelweg und bunte Veranstaltungen garantieren einen
unvergesslichen Ausflug für die ganze Familie.



DIE GARTEN TULLN, Europas erste ökologische Gartenschau und
Top-Ausflugsziel in Niederösterreich, präsentiert sich als begehbares
Bilderbuch und als Ruheoase für Erholungssuchende. Das gesamte Gelände
der GARTEN TULLN ist barrierefrei gestaltet und wird streng nach den
Kriterien von „Natur im Garten" gepflegt.



Bezaubernde Schaugärten, der 30 Meter hohe Baumwipfelweg, der große
Abenteuer- und Naturspielplatz, der Wasserpark mit Bootsrundkurs und
das bunte Veranstaltungsprogramm garantieren erholsame und spannende
Stunden auf der GARTEN TULLN.


Die Garten Tulln ist eine im Jahr 2008 eingerichtete Landesgartenschau
des Bundeslandes Niederösterreich in Tulln an der Donau und wurde
anschließend eine Dauereinrichtung.



Das Gelände liegt westlich der Stadt zwischen dem Tullner Messegelände
und der Rosenbrücke über die Donau. Sie gliedert sich in zwei Bereiche,
wovon der kleinere Teil mit einer Größe von etwa sieben ha Schaugärten
und Pflanzen zeigt, während der größere, 45 ha große Teil aus frei
zugänglichem Auwald besteht, der durch Anpflanzung verschiedener Bäume
und Sträucher renaturiert sowie mit Weganlagen ausgestattet wurde. So
wurden über 27.000 Stauden, 3500 Sträucher und 6000 Sumpf- und
Wasserpflanzen in den etwa 60 Schau- und Mustergärten gepflanzt.





















Baumwipfelweg am Areal DIE GARTEN TULLN
















Wem der viele Text zu lange war und lieber Bewegtbilder mit Musik mag,
kann sich gerne dieses Video antun: