web steiner
Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen
Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.
+43/2624/54014 - office@websteiner.com
Weitra
die Kuenringerstadt, Mai 2023
Weitra (tschechisch Vitoraz) ist eine österreichische
Stadtgemeinde im Bezirk Gmünd in Niederösterreich und führt den
Beinamen Kuenringerstadt. Weitra liegt im Waldviertel in
Niederösterreich im Tal der Lainsitz.
* * *
OBERES STADTTOR - 1526 NEU ERBAUT, ZINNENBEKRÖNUNG ENDE 17. JH. ANLAGE DER STADTMAUER 13.JH. ERWEITERUNGEN BIS IN DAS 15.JH.
DAS STADTTOR - Das sogenannte „Zwettler Tor" ist Teil der fast gänzlich
erhaltenen Stadtmauer Weitras und bietet schon beim Betreten der Stadt
ein eindrucksvolles Bild. Auf dem Stadttor zu sehen ist das Wappen der
Stadt Weitra, umgeben von zwei weiteren Wappen. Im Jahr 2017 wurde eine
neue Beleuchtungsanlage installiert, welche es ermöglicht, das Tor in
verschiedenen Farben zu beleuchten.

Das prachtvolle Renaissanceschloss, hoch über der Stadt Weitra gelegen,
lädt dazu ein, seine Geschichte – vom Keller bis zum Turm – zu
erforschen: Schlossmuseum, „Erlebniswelt Bier“, „Schauplatz Eiserner
Vorhang“, abwechselnde Sonderausstellungen, wunderschöner Ausblick vom
Schlossturm!

Authentisch, gastfreundlich, gemütlich so ist Weitra und so sind auch
die Menschen, die hier leben. Ihre Geschichte und ihre Traditionen sind
hier auf Schritt und Tritt spürbar. Die historische Altstadt mit ihren
schmucken Bürgerhäusern und das Renaissanceschloss, das hoch über ihr
thront, zeugen von Weitras geschichtsträchtiger Vergangenheit.

DAS RATHAUS UND DER RATHAUSPLATZ
1892/93 wurde das Rathaus im Still der italienischen Spätrenaissance
erbaut. Im ersten Stockes befindet sich der Festsaal mit seinem
eindrucksvollen Deckengemälde von Wolfram Köberl, das die Gründungssage
der Stadt Weitra darstellt: Veit Ursini von Rosenberg übergibt jedem
seiner fünf Söhne durch die Überreichung einer Rose eine der fünf von
ihm gegründeten Städte: Gratzen (Nové Hrady), Wittingau (Třeboň),
Neuhaus (Jindřichův Hradec), Krumau (Český Krumlov) und Weitra. Heute
wird der Saal für Hochzeiten und Veranstaltungen genutzt. Die
Bürgerhäuser des Rathausplatzes bilden ein farblich abgestimmtes und
harmonisches Ensemble, stammen großteils aus dem Mittelalter und sind
mit Renaissance- und Barockfassaden ausgestattet.

DAS SGRAFFITOHAUS - Besondere Aufmerksamkeit verdient das prachtvolle
Sgraffitohaus (Nr. 4) aus der Renaissancezeit. Den Schwerpunkt der
Darstellungen bilden Szenen aus der sagenhaften römischen
Frühgeschichte in der Form, wie sie uns Titus Livius überliefert hat.
Die unterste Bilderreihe zeigt uns den Mann in seinen Lebensjahrzehnten
(10 bis 100 Jahre) und vergleicht ihn in jeder Phase seines Lebens mit
einem Tier. In Weitra befinden sich noch zwei weitere Häuser, die Reste
von Sgraffiti aufweisen.

Folgt man der Biermeile durch die malerische Altstadt, kann man das
Thema Bier aus neun ungewöhnlichen Perspektiven betrachten. Die als
Hopfengärten angelegten interaktiven Stationen dienen nicht nur der
Information, sondern laden auch zum Verweilen ein. Jede Station ist
einem eigenen Thema gewidmet. Die in den Boden eingelassenen
Hopfendolden sind Wegweiser zwischen den Stationen.
Das zweigeschoßige Eckhaus mit Apotheke in der Auhofgasse 125 besitzt eine neobarocke Fassade aus der Zeit um 1900.

Bei dem erst 1569 genannten Auhof dürfte es sich um einen knapp vor
1500 entstandenen landesfürstlichen Kammerhof handeln, der schon im 16.
Jahrhundert in bürgerliche Hände gelangte. Bemerkenswert ist die
spätgotische Balkendecke der Stube in Form eines korbbogigen
Tonnengewölbes.
TEIL DES EНЕМ. AUHOFES, SPÄTGOT. GESCHNITZTE BALKENDECKE, KAMIN 17. JH.


Die Pfarrkirche Weitra steht in
der Stadt Weitra in der Stadtgemeinde Weitra in Niederösterreich. Die
römisch-katholische Pfarrkirche Hll. Peter und Paul gehört zum Dekanat
Gmünd in der Diözese St. Pölten. Die romanische einschiffige Kirche mit
einem Ostturm stammt aus dem Anfang des 13. Jahrhunderts. 1439 erfolgte
eine Einwölbung des ostseitigen Turmjoches und davon ostseitig der
Anbau eines gotischen Chores und der nordseitige Anbau einer
Barbarakapelle. Im 3. Viertel des 15. Jahrhunderts wurde das Langhaus
zu einem dreischiffigen Saalraum erweitert und das Mittelschiff
überwölbt. Südlich des Turmjoches wurde 1760/1761 als Stiftung des
Franz Josef Keufel von Ullberg eine nach Süden ausgerichtete
Heilig-Kreuz-Kapelle angebaut. Die Kirche war bis 1792 von einem
Friedhof umgeben.

Stadtpfarrkirche St. Peter und Paul zu Weitra
Der Kuenringer Hadmar II. gründete im Zuge der Kolonisation unseres
Gebietes zwischen 1201 und 1208 planmäßig die Stadt Weitra. Im Rahmen
der Gesamtanlage war der nördliche Bereich der Stadt für den Sitz der
Pfarre (Pfarrhof und Kirche) vorgesehen. Der sich hier öffnende
Steilabfall zur Lainsitz bildete nicht nur einen natürlichen Beitrag
zur Befestigung der Stadt, er lieferte auch als Steinbruch die für die
Bauten notwendigen Materialien. Den ursprünglichen romanischen Kern der
Kirche bildete das rechteckige Langhaus, dem im Osten ein Chorquadrat
angefügt war. Über diesem erhob sich der mächtige Turm; daran schloss
sich der eigentliche Altarraum: er war der aufgehenden Sonne zugewendet
und von einer halbkreisförmigen Apsis umschlossen.
Zu Beginn des 15. Jahrhunderts erfolgte die erste gotische Erweiterung:
die Halbkreisapsis wurde durch ein aus zwei Jochen und einem
5/8-Chorabschluss bestehendes geräumiges Presbyterium ersetzt. An die
Nordflanke des Turmes errichtete man eine Seitenkapelle zu Ehren der
hl. Maria Magdalena. Diese 1439 geweihten Erweiterungen dürfte ein
Thaman Mawrer von sand Wolfgang (Thomas Maurer von St. Wolfgang) mit
seiner Bauhütte durchgeführt haben. Dieser hatte schon vorher, um 1410,
in Pfaffenschlag (= St. Wolfgang) die gotische Hallenkirche errichtet
und danach in Weitra die Befestigungsanlagen (Stadtmauern) erweitert
und das alte Rathaus erbaut. Gegen Ende des 15. Jahrhunderts erfolgten
an der Kirche mehrere Erweiterungen: an das Langhaus wurden im Norden
und im Süden Seitenschiffe angebaut. Danach wurde noch das nunmehrige
Mittelschiff um ca. fünf Meter erhöht und mit einem spätgotischen
Netzgewölbe versehen. Der Ostturm wurde schließlich noch um ein Geschoß
erhöht und mit einem hohen Pyramidendach ausgestattet.

Fresko (um 1740) – fastentuchartiger Passionszyklus, bestehend aus 35
Szenen aus dem Leiden, dem Sterben und der Verherr-lichung Jesu.

Marienaltar: (1747) Johann Walser, Altarbild Mariae Himmelfahrt von Johann Georg Schmidt (Wiener Schmidt), signiert mit 1747

Nach dem Dreißigjährigen Krieg (1618-1648) begann allmählich das
Zeitalter des Barocks: Schritt für Schritt wurde die Einrichtung dem
Geschmack der Zeit entsprechend ergänzt und erneuert. Diverse barocke
Altäre wurden in Auftrag gegeben. Die bedeutendste Anschaffung erfolgte
schließlich 1749 mit dem neuen Hochaltar. Diesen schuf der aus Tirol
stammende und in Böhmisch Budweis wirkende Bildhauer Johann Walser. Dem
Spätbarock sind noch zwei bedeutende Werke zuzuordnen: die prunkvolle
Kanzel und die 1760/1761 an den Turm im Süden angebaute Kapelle zum hl.
Kreuz mit ihrem eindrucksvollen Baldachinaltar. Nach ihren Stiftern
Anton und Franz Joseph von Keuffel wird sie Keuffel'sche Kapelle
genannt. Seit 2015 dient sie als Taufkapelle. Im späten 19. und frühen
20. Jahrhundert erfolgten weitere Veränderungen im Sinn des
Historismus. 1904 wurde schließlich das Innere der Kirche grundlegend
renoviert und umgestaltet. Zudem schaffte man zwei neugotische
Seitenaltäre (Herz Jesu und Maria) von der Firma Josef Rifesser aus St.
Ulrich in Gröden (Südtirol) an. Die Orgelempore wurde erneuert und eine
neue Rieger-Orgel gebaut. Nach Errichtung des städtischen E-Werkes
(1902) erhielt die Kirche eine elektrische Beleuchtung. Die
Renovierungen nach 1950 entfernten weitgehend die historisierenden
Umgestaltungen. 2015 wurde eine, von der Firma Pircher aus Steinach am
Brenner gebaute neue Orgel geweiht.

Johannes Altar: (1745) aus Stuck gebaut. Altarbild: Verklärung des hl. Johann von Nepomuk von Joseph Kessler (1875)

Statue des hl. Josef mit Jesuskind vermutlich von Josef Rifesser (1874)
Herz Jesu Bild von Joseph Kessler (1872)

Hochaltar: (1749) Johann Walser, barocker Tabernakelaufbau mit
Tafelreliquiaren und adorierenden Engeln. Großes Altarbild von Johann
Daysigner (?) (1774) - Abschied der Apostel Petrus und Paulus vor ihrem
Martyrium in Rom.
Oberhalb: Wappenkartusche der Patronatsherren (Fürstenberg), ovales Dreifaltigkeitsbild von Johann Daysigner (?) (1774).
Überlebensgroße Apostelfiguren: hl. Judas Thaddäus (links), hl. Simon (rechts).
An den Seiten: Hl. Leonhard - Viehpatron und Hl. Florian - Patron gegen Feuer

Das dreischiffige, basilikale Langhaus hat ein Mittelschiff mit einem
ursprünglich flachgedeckten romanischen Saalraum. In den ungegliederten
Seitenwänden sind vermauerte Rundbogenfenster wie auch romanisches
Quadermauerwerk über den Seitenschiffgewölben erkennbar. Im südseitigen
zweiten Seitenschiffjoch ist ein romanisches Rundbogentor erhalten. Zu
den Seitenschiffen sind ungleich weite niedrige spitzbogige
Spitzbogenarkaden. Eine spätgotische Erhöhung des Mittelschiffes um
1505 erfolgte mit einem Netzrippengewölbe auf Konsolen und Stichkappen
über den hoch gelegenen Spitzbogenfenstern. Die dreiachsige
kreuzrippenunterwölbte Westempore über gekehlten Rundbogenarkaden auf
Achtseitpfeilern hat einen Sockelaufsatz in der Brüstung. Das
neugotische Emporenobergeschoß aus Holz mit Maßwerkbrüstung ist aus der
2. Hälfte des 19. Jahrhunderts.

Keuffel'sche Kapelle zum hl. Kreuz: (1760/61) gestiftet vom
herrschaftlichen Rentmeister Franz Joseph Keuffel von Ullberg, auf den
die Buchstaben FJ K VU und das Wappen am prunkvollen schmiedeeisernen
Gittertor hinweisen. Der Baldachin des prachtvollen Altares wird von
vier knorrigen Eichenstämmen getragen. Engel beten das Auge Gottes und
das Lamm Gottes auf dem Buch mit sieben Siegeln aus der Offenbarung des
Johannes an.
Kruzifix: gotisierend, an der Westwand der Kapelle angebracht.
Das gotische Taufbecken weist auf die derzeitige Verwendung des Raumes als Taufkapelle hin.

Barockkanzel: „Gesetz und
Gericht", vermutlich nach einem Entwurf aus der Werkstätte des Johann
Nikolaus Moll. Schalldeckel: Jesus kommt zum Weltgericht. Relief: Hölle
und Fegefeuer, Mose mit den Gesetzestafeln (links), Engel mit offenem
Prophetenbuch (rechts)
Christus an der Martersäule: Kopie der Gnadenstatue der Wieskirche in Bayern
Seitenaltar: hl. Antonius von Padua mit Jesuskind (19., 20. Jh.)

Barocker Kredenzaltar großes Bild: die hl. Margaretha von
Antiochia überantwortet Christus ihr Leben; kleines Bild: im Kreis der
Apostel wird Margarethe von der Himmelskönigin aufgenommen.

Hl. Sebastian: (1749) - die Barockfigur steht in der Nische eines ehemaligen romanischen Rundbogenfensters
Kreuzwegbilder nach Josef Führich (1904)

Marienaltar: Josef Rifesser aus St. Ulrich in Gröden (1904),
neugotisch, Maria Lourdes (Mitte), hl. Joachim (links), hl. Anna
(rechts), hl. Barbara (im Gesprenge); Reliefbilder: Verkündigung an
Maria, 12-jähriger Jesus im Tempel.

CASTELLIHAUS - ZEITW. WOHNUNG DES DICHTERS I. F. CASTELLI.
ERB. ENDE 18.JH. UNTER VERWENDUNG VON BAUTEILEN DES ALTEN KARNERS (SPÄTGOT. PORTALE 1520)
Die zeitweilige Wohnung des österreichischen Dichters und Dramatikers
Ignaz Franz Castelli wurde 1787 durch dessen Vater unter Verwendung von
Bauteilen des alten Karners erbaut. Die spätgotischen Portale stammen
aus dem Jahr 1520.

Kath. Pfarrkirche hll. Peter und Paul
Die Anfang des 13. Jahrhunderts erbaute, ursprünglich romanische Kirche
wurde im 15. Jahrhundert durch spätgotische Erweiterungsbauten zu einer
dreischiffigen Basilika umgewandelt. Der Hochaltar ist ein Werk von
Johann Walser aus dem Jahr 1749. Das Altarblatt eines Seitenaltars
wurde 1747 von Martin Johann Schmidt gemalt. Josef Rifesser schuf 1904
die neugotischen Altäre in der Barbarakapelle.

Wilhelm Szabo, Lyriker, 1901-1986
Wilhelm Szabo war ein österreichischer Dichter und Autor, der
stilistisch der sogenannten Anti-Heimatdichtung zuzuordnen ist. 1901 in
Wien geboren, wuchs er bei kleinbäuerlichen Zieheltern im
niederösterreichischen Waldviertel in Lichtenau bei Gföhl auf. Szabo
absolvierte eine Tischlerlehre in Wien, schloss mit Erfolg die
Lehrerbildungsanstalt St. Pölten ab und arbeitete in Folge als Volks-,
dann als Hauptschullehrer an verschiedenen Schulen im Waldviertel. 1933
machte er mit der Veröffentlichung des Gedichtbandes „Das fremde Dorf“
das erste Mal literarisch auf sich aufmerksam. Nach 1945 war er wieder
in seinem ursprünglichen Beruf tätig und wurde schließlich
Schuldirektor und Oberschulrat in Weitra im Waldviertel. Von 1945-1966
wohnte er im Castellihaus in Weitra.

Bürgerspital und Spitalkirche
Als Versorgungsstätte für alte, kranke und verarmte Bürger 1340/41
gegründet. Spitalsbau 1729-1731 neu errichtet. In der Kirche sind
gotische Wandmalereien und Inschriften aus dem 14. und 15. Jh. sichtbar.
(Schlüssel erhältlich in der Bleikristallschleiferei Ruß)

Die Glasschleiferei Ruß öffnete
im Jahre 1988 ihre Pforten. Fortan wurde in der Weitraer Vorstadt
Bleikristallgläsern ein individueller Schliff verliehen und somit in
mühevollster Kleinarbeit unverwechselbare Originale gefertigt.
Schauplatz der künstlerischen Arbeit mit Glas ist die Werkstatt in
diesem alten und historischen Haus.
Reichlicher Schliffdekor nach alter böhmischer Tradition steht dem
modernen Design mit weniger und leichtem Schliffdekor auch noch heute
gegenüber. Ergänzt wird das breite Spektrum dieses alten Kunsthandwerks
durch das mit Farbglas überzogene Überfangglas, welches seinen Schliff
durch das Wegschleifen der Farbschicht erhält.
Dem Unternehmen ist es ein besonderes Anliegen die Bedürfnisse seiner
Kunden in hohem Maße zu befriedigen. Hierfür erfolgt die Anpassung der
Gläser durch ein persönliches Logo, Monogramm oder Signet. Ein weiterer
Kundendienst ist die „Glasklinik", in der z. B. am Rand abgeschlagene
Gläser abgeschliffen werden und so manchem beschädigten Lieblingsstück
wieder zu neuem Glanz verholfen wird.

Ehem. Bürgerspital Zum hl. Geist: Das Bürgerspital wurde 1340 gestiftet
und von 1729 bis 1731 im Barockstil neu erbaut. Dabei blieben ein
mittelalterlicher Schüttkasten und die gotische Spitalskirche mit
Wandmalereien aus dem 14. Jahrhundert erhalten.

Spuren mittelalterlicher Spiritualität in der Heiligengeistkirche
Im Chorraum (Apsis) der Kirche finden sich reiche Inschriften in
gotischer Minuskelschrift, die in die früheste Zeit der Stiftung, das
14. Jahrhundert, zurückweisen. Philosophisch–theologische literarische
Texte in geschliffenen lateinischen Hexametern preisen die einzelnen
göttlichen Personen und verherrlichen Gott als Weltvernunft. Weitere
Verse mit typisch mittelalterlichen Wort- und Buchstabenspielereien
haben das Lob der Gottesmutter Maria zum Inhalt.

An der Nordwand der Apsis
finden sich insgesamt 25 schöne Hexameter aus dem fünften Buch des
„Anticlaudianus" des Alanus ab Insulis (Alain de Lille, ca. 1120-1204),
in denen die einzelnen göttlichen Personen gepriesen werden.
Die Inschriften an der Südwand
sind nur fragmentarisch erhalten, konnten auch bislang nur teilweise
identifiziert werden. Den Bruchstücken kann man aber entnehmen, dass
sie das Lob der Gottesmutter Maria zum Inhalt haben.
Zusammenfassend finden sich an der Ostwand
der Apsis in den beiden unteren Kolumnen Verse aus dem im Mittelalter
weit verbreiteten Werk „de philosophiae consolatione" des römischen
Philosophen Anicius Boethius (ca. 480-524), die Gott als Weltvernunft
verherrlichen.
Ausgeklügelte Wort- und Buchstabenspielereien bieten die sechs Disticha, die sich an der südwestlichen Apsiswand
finden: Die sechs Hexameter beginnen alle mit dem Wort „Virgo"
(Jungfrau), das, mit einer Initiale ausgestattet, der Kolumne
vorgesetzt erscheint und daher nur einmal geschrieben ist. All diese
Verszeilen beginnen mit Anrufungen der Jungfrau Maria, die Wort für
Wort wie ein Echo in den zweiten Hälften der Pentameter wiederkehren
(Echostichon). Außerdem endet jeder Hexameter mit dem Buchstaben, mit
dem auch der dazugehörige folgende Pentameter beginnt. Das letzte
Zeilenpaar bringt allerdings eine gewisse Unregelmäßigkeit. Von oben
nach unten gelesen ergeben diese Buchstaben das Wort „Johannes".

Zur Geschichte der Bürgerspitalstiftung in Weitra
Aus dem ersten Drittel des 14. Jahrhunderts sind für Weitra alle jene
Merkmale überliefert, die den Rechtscharakter einer Stadt ausmachten:
Ausbildung eines eigenen Stadtgerichtes, Verwaltung durch das autonome
Organ des Stadtrates („Geschworene"), Siegelführung sowie Erlangung
einer Stadtrechtsurkunde, mit der König Friedrich der Schöne 1321 auch
spezifische Wirtschaftsfreiheiten, etwa das Bannmeilenrecht, erteilte.
Im Vergleich zu den anderen Städten des Waldviertels erfolgte in Weitra
schon sehr früh auch die Gründung eines (Bürger-) Spitals, einer
wichtigen, zukunftsweisenden sozialen Einrichtung: Der erste namentlich
bekannte Stadtrichter von Weitra, Chunrat Marchart, bzw. nach dessen
Tod seine Witwe Margareta und ihr Schwager, der ehemalige Weitraer
Landrichter, Ludwig von Zwettl (Kleinzwettl), begründeten mit einer
umfangreichen Stiftung eine Institution, deren Hauptaufgabe es war,
alten, verarmten und kranken Bürgern von Weitra als Versorgungsstätte
zu dienen. 1341 waren auch die notwendigen Baumaßnahmen abgeschlossen:
„Vor der stat tze Weytra an der Luensnitz pruken" war „daz spital ze
Weitra an dem Ledertal" mit einer anschließenden Kirche „ze eren und ze
lob dem heiligen geist und unser Vrowen Sand Marein" errichtet worden.
Am 25. März 1341 wurde schließlich die endgültige Gründungsurkunde
ausgestellt, in der als Aufgaben und Zweck der Stiftung die Hilfe für
die Armen und Siechen und das Seelenheil der Stifter, ihrer Vorfahren
und Nachkommen angeführt werden. Der Pfarrer wurde verpflichtet, einen
eigenen Priester zu unterhalten, der täglich in der Spitalkirche eine
Messe zu lesen hatte. Den „besten Zwölf" der Stadt (dem Rat) wurde die
Sorge um die Einhaltung der Stiftungsbestimmungen übertragen. Vom
heutigen Baubestand des Bürgerspitalskomplexes stammen noch die beiden
ersten kreuzgratgewölbten Joche des Kirchenschiffes und der
rippengewölbte Chorraum mit 5/8 - Schluss aus der Stiftungszeit

In den folgenden Jahren machten vor allem Weitraer Bürger immer wieder
Stiftungen, Vermächtnisse und andere Zuwendungen zum Spital. In den
Jahren 1381, 1383 und 1403 kaufte die Stadt drittelweise das Dorf
Wielands (Oberwielands) „mit allen Rechten, Nutzen und Freiheiten" für
das Spital, in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts erwarb die Stadt
noch dazu die Ortsobrigkeit über Wultschau. In beiden Dörfern setzte
die Stadt den Dorfrichter ein, die Abgaben und Dienste kamen der
Stiftung zugute. Ein 1407/1425 angelegtes Grundbuch verzeichnet den
bereits recht umfangreichen Spitalsbesitz, auch im Umfeld der Stadt.
Außerdem besaß das Hospital Weingärten in Langenlois, Zöbing, Engabrunn
und Wagram. Zur Verwaltung des Spitales wurde alljährlich von der Stadt
der Spitalmeister gewählt, der einem eigenen Ausschuss die
Jahresrechnungen vorzulegen hatte. Für die wirtschaftlichen
Erfordernisse standen ein im Nordwesten an den Spitalsbau
anschließender Wirtschaftshof und ein Getreidekasten in der Nähe des
Rathauses zur Verfügung
1527 unterstanden dem Spitalmeister ein Bauknecht, ein Junge, eine
Köchin und eine Viehdirn. Das weitere Dienst- und Pflegepersonal kam
vor allem aus den beiden untertänigen Dörfern Wultschau und Wielands.
Im Spital fanden 25 Personen Platz. In erster Linie wurden verarmte und
gebrechliche Weitraer Bürger, Witwen und Kinder aufgenommen, später
auch Spitalsuntertanen der Dörfer Wielands und Wultschau.
Gegebenenfalls wurden alte, verarmte Personen, die aus Platzmangel
woanders wohnen mussten, auch vom Spital aus betreut. Zeitweise trugen
die Spitalsbewohner sogar eine eigene Kleidung. Diese war z. B. 1731
aus blauem Tuch gefertigt und mit weißem Kragen und Aufschlägen
versehen. Für kranke „Inleute" (Nichtbürger, also die soziale
Unterschicht), in der Stadt erkrankte Fremde und Soldaten gab es das
bereits 1389 urkundlich erwähnte Siechenhaus an der Zwettlerstraße
(heute Nordwaldheim).

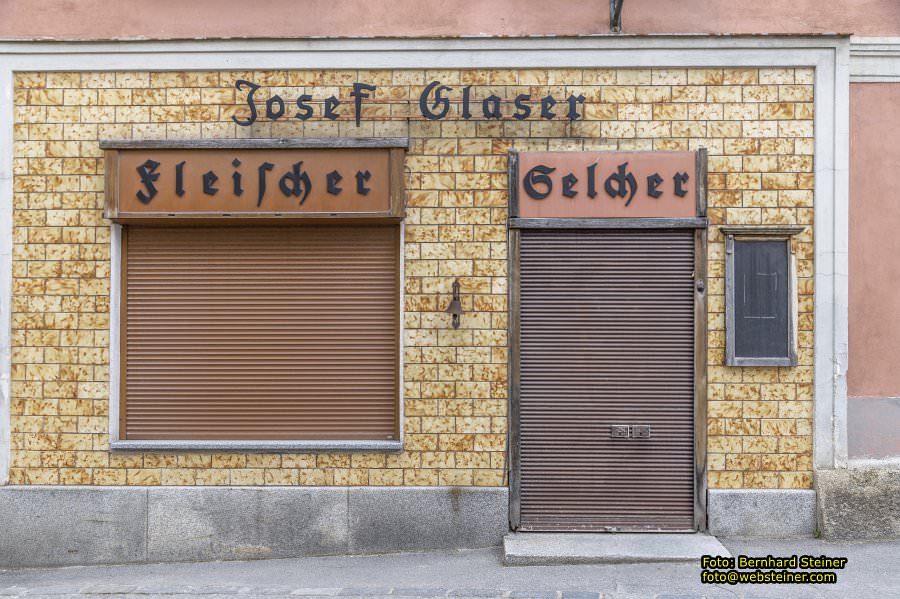
Bürgerhaus in der Untere Landstraße 147: Das zweigeschoßige Gebäude
besitzt eine spätbarocke Fassade aus der zweiten Hälfte des 18.
Jahrhunderts.

Die Geschichte Weitras
Zwischen 1201 bis 1208, erbaute Hadmar II. von Kuenring die Burgstadt
Weitra. Am höchsten Punkt wurde die Burg erbaut und am steil zur
Lainsitz abfallenden Nordende die Stadtpfarrkirche. Die Burgstadt blieb
bis 1296 im Besitz der Kuenringer. Danach verloren sie die Stadt an die
Fürstenfamilie Habsburg, die bis zum 15. Jh Besitzer blieben. Kaiser
Rudolf II. von Habsburg belehnte schließlich Wolf Rumpf Freiherr zu
Wielroß mit „Herrschaft, Stadt und Feste". Das Lehen ging 1592 in das
Eigentum von Wolf Rumpf über. Dessen Witwe heiratete 1606 den
schwäbischen Grafen Friedrich zu Fürstenberg. Die Familie Fürstenberg
ist noch heute im Besitz des Schlosses und des Gutes.
Im 13. Jahrhundert bildete sich eine bürgerliche Gemeinde mit
Selbstverwaltung und bereits 1321 verlieh König Friedrich der Schöne
den damaligen Bürgern der Stadt ein Privileg, welches das Bierbrauen im
Umkreis von einer Meile um die Stadt verbot. Somit wurde die Stadt zur
„ältesten Braustadt Österreichs" und erlebte in den folgenden
Jahrhunderten eine Blütezeit der Braukultur. Um 1645 gab es 33
bürgerliche Brauhäuser, ein städtisches und ein herrschaftliches
Hofbräuhaus.

Die Herrschaft Weitra gehörte ursprünglich nach Böhmen. 1201 gründete
der Kuenringer Hadmar II. die Burgstadt Weitra oberhalb der geringfügig
älteren Siedlung Altweitra, die vermutlich nach einem Slawen namens Vit
Vitohrad (tschech. für Veitsburg) benannt wurde (daher auch der heutige
tschechische Name Vitoraz). In die Kuenringer-Herrschaft fällt
vermutlich auch bereits die erstmalige Verleihung des Stadtrechts. Den
Kern der Bevölkerung bildeten Ackerbürger. Da die Kuenringer Ottokar
II. Přemysl unterstützt hatten, wurde nach seinem Tode (1278) Weitra
von den Habsburgern beansprucht; seit 1296 war die Stadt endgültig in
deren Besitz.[4] Vom 26. Mai 1321 (Friedrich der Schöne) ist die
älteste Urkunde erhalten, die Weitras Bürger mit Brau- und
Schank-Privilegien ausstattete.

Persönlichkeitsdenkmal Kaiser Josef II. - Die Joseph II. darstellende Büste ist mit der Jahreszahl 1881 bezeichnet.
Dem Schätzer der Menschheit, 1781
Der Landw. Bezirks-Verein Weitra, 1881

DIE ZISTERNE - Das wohl bedeutendste unterirdische Bauwerk Weitras, die sogenannte Zisterne
aus dem 14. Jh, fällt mit seinem schlichten Holztor erst bei genauerem
Hinsehen auf. Über die frühere Verwendung wird bis heute gerätselt. Zum
einen könnte es im Mittelalter bei Belagerungen als
Wasserversorgungsstätte innerhalb der Stadtmauer gedient haben, sie
könnte aber auch in Verbindung mit den nahe gelegenen Fleischbänken als
Kühlraum verwendet worden sein. Die Zisterne mit dem beeindruckend
gotischen Kreuzrippengewölbe wird von drei Wasserquellen gespeist:
Regenwasser, Grundwasser und dem Überlauf des Brunnens im Haus
Rathausplatz 24. Zugang jederzeit frei möglich.
Die Anlage diente ursprünglich als Wasserversorgungssystem der
Bevölkerung. Sie besteht aus einem Sammelbecken in Form eines
Brunnnens, der sich im Keller des Hauses „Rathausplatz 24" befindet,
aus einem Verbindungsgang, welcher aus dem Fels herausgeschlagen wurde
und aus einer Zisterne. Die Zisterne wurde um 1300 erbaut und bekam in
verschiedenen Zeitepochen Zu- und Umbauten. Von fast quadratischem
Grundriss (ca. 8 x 9 m), ist die Zisterne durch die Wölbung
west-ost-orientiert. Vor allem der südliche (hintere) Raumteil ist
großteils aus dem Fels geschlagen. In zwei sehr schmalen queroblogen
Jochen gewölbt, weist der Raum ein reguläres Kreuzrippengewölbe auf.
Der Gurtbogen ist in der Dimensionierung gegenüber den Diagonalrippen
maßdifferenziert, jedoch profilgleich. Die Nord- und Südwand sind aus
Trapezrippen mit breiten Schrägen mit poygonalen Wandvorlagen (auf die
Jochteilung bezogen). Die Gewölbescheitel verlaufen im südlichen
Raumteil annährend horizontal, im nördlichen abfallend. Aufgrund des
Mauerwerks, der Gewölbefiguration und Rippenprofile ist der
Ursprungsbau auf das frühe 14. Jahrhundert zu setzen.
Mittelalterliche Zisterne - Im Mittelalter wurde dieses Wasserreservoir
für die Stadt angelegt. Gespeist wird das frühgotische Gewölbe durch
drei „Quellen": vom Regenwasser, das von oben hereinsickert, vom
Grundwasser, das sich trotz felsiger Höhe einstellt, und vom Überlauf
eines Brunnens im Haus Rathausplatz 24 schräg oberhalb der Zisterne.
Sie geriet im Laufe der Geschichte in Vergessenheit und wurde erst 1993
wiederentdeckt.


"STROBEL'SCHES HAUS", 1585-1714 IM BESITZ DER HERRSCHAFT, 1714-1765 ALS
BRAU-UND SCHANKHAUS IM BESITZ DER FAMILIE KEUFFEL (VON ULLBERG), DANN
HOFTAVERNE

Die mit der Jahreszahl 1748 bezeichnete Dreifaltigkeitssäule wurde von Johann Walser geschaffen.
Ehem. Brauhaus am Rathausplatz 6: Das Eckhaus war in der ersten Hälfte
des 17. Jahrhunderts ein Hofbräuhaus und eine Hoftaverne. Die Fassade
stammt aus dem dritten Viertel des 19. Jahrhunderts.



Mit diesem Originalstück Nr. 296 der Berliner Mauer, einer Leihgabe des
Hauses der Geschichte in Bonn, möchten wir auf die Ausstellung
SCHAUPLATZ EISERNER VORHANG - EUROPA: GEWALTSAM GETEILT UND WIEDER VEREINT
in Schloss Weitra hinweisen. Begeben Sie sich auf eine Zeitreise in die
Vergangenheit des „Kalten Krieges", erfahren Sie, wie die Trennung in
Ost und West überwunden wurde und ein vereintes Europa entstand.

Der Kuenringer Hadmar II. errichtete zwischen 1201 und 1208 auf dem die
Stadt überragenden Felsen eine zwei-türmige Burg. Sie war durch
Vorwerke und Mauern in die Stadtbefestigung eingebunden. Unter Wolf
Rumpf Freiherrn zum Wielroß wurde sie durch das mächtige
Renaissanceschloss (1590-1606) ersetzt. Mauern der alten Burg sind in
den Kellern des Schlosses noch heute zu erkennen, auch die Nordfront
des Schlosses dürfte bis in das erste Stockwerk hinauf mittelalterliche
Mauerteile besitzen. Die Pläne für den Neubau stammen von Pietro
Ferrabosco, die ausführenden Arbeiten leitete Meister Anton Muys.
Das Renaissanceschloss ist ein dreigeschossiger Vierecksbau, die
nördliche Längsseite wird vom Turm überragt. Der rechteckige Hof
besitzt an seinen Schmalseiten dreigeschossige Arkaden. Der Südtrakt
über dem Bergfelsen hat zwei Kellergeschosse. Nach Bränden von Turm und
Dach 1747 und 1757 errichtete man an den Schmalseiten je vier
Volutengiebel. Den hohen Helm des Turmes stellte man nicht wieder her,
sondern ließ einen geraden Turmabschluss, den man mit einer
Steinbalustrade ausstattete. Die Kapelle wurde in das Erdgeschoss
verlegt und mit einem Barockchor ausgestattet. Im ersten Stock befindet
sich ein historisierendes Theater im Rokokostil, das 1885 an Stelle
eines Barocktheaters von A. Führer aus Wien errichtet wurde. Seit 1605
ist das Schloss im Besitz der Familie Fürstenberg.

SCHLOSS WEITRA - Die Burg wurde wie die Stadt Weitra zwischen 1201 und
1208 durch Hadmar II. von Kuenring gegründet. Sie hielt allen
Belagerungen des Dreißigjährigen Krieges stand. Im großartig erhaltenen
Renais sanceschloss, es steht direkt über der ursprünglichen
Burganlage, sind heute zwei Museen und die Dauerausstellung „Schauplatz
Eiserner Vorhang" untergebracht. Im einzigartigen Schlosshof findet
seit 2006 jährlich das "Schloss Weitra Festival" statt. Heute gehört
das Schloss Weitra Prinz Johannes und Prinzessin Stephanie zu
Fürstenberg.

DIE STADTMAUER - Die 1292 erstmals urkundlich erwähnte Stadtmauer
stammt vorwiegend aus dem 14. und 15. Jahrhundert. Schützend umgibt sie
die Altstadt und ist noch heute beinahe vollständig erhalten. Dort wo
die Zwinger waren, liegen jetzt Stadtgärten und Promenaden. Durch das
nach Zwettl weisende Tor betritt man die Stadt, das Untere Tor wurde
abgetragen. Besonders malerisch steht auf den Resten eines Turmes ein
Jahrhundertwende-Pavillon die sogenannte „Aussichtswarte" im
südwestlichen Mauerabschnitt. Von hier lässt sich ein einzigartiger
Ausblick genießen.

TURM: Während der Umgestaltung der alten Kuenringerburg in ein
Renaissanceschloß erhielt das Gebäude in der Mitte der nördlichen
Längsseite einen mächtigen Turm mit quadratischem Umriß. Nachdem in der
Nacht vom 10. auf den 11. Juli 1747 der bestehende hohe Turmhelm durch
einen Brand zerstört wurde, stellte man ihn in seiner ursprünglichen
Form nicht mehr her. Man entschied sich für den geraden Turmabschluß
und errichtete dort eine Steinbalustrade. Die Gesamthöhe des Turmes
beträgt 35 m.

Schlossturm Besteigung - Ausblick vom Schlossturm
Erlebnisreich ist der Aufstieg auf den imposanten Schlossturm! Oben
angekommen, erwartet den Besucher ein grandioser Ausblick auf das
Weitraer Land bis hinein nach Böhmen sowie der interessante Blick auf
die historische Altstadt Weitras aus der Vogelperspektive.

Die Gründung der Stadt Weitra, die Anlage der Stadt und ihre bauliche Entwicklung
Im Zuge der immer tieferen Erschließung und Kolonialisierung des
Waldviertels begannen die Kuenringer im 12. Jahrhundert mit der
planmäßigen Besiedlung des Gebietes um Weitra. Die ersten urkundlichen
Nennungen sind in die Zeit zwischen 1182 und 1185 zu datieren, beziehen
sich aber noch auf das heutige Altweitra. Aus städtebaulichen und
strategischen Gründen verlegte Hadmar II. zwischen 1201 und 1208 den
Zentralort und ließ drei Kilometer südwestlich von der Altsiedlung die
Stadt Weitra erbauen: Sie liegt auf einem nach Nordwesten stufenförmig
abfallendem Granitplateau. Im Süden, auf dem höchsten Punkt, errichtete
man die Burg, die mittlere, breiteste Zone war für den großen
Dreiecksplatz bestimmt, am steil zur Lainsitz abfallenden Nordende
erbaute man die Stadtpfarrkirche. Damit sind auch die
Hauptfunktionsträger der neuen Stadt genannt: Die Burg hatte als
Residenz und Verwaltungszentrum zu dienen, der Platz bot genügend Raum
für Märkte und nötigenfalls für Truppenkonzentrationen. Nach der
Übertragung der Pfarrechte von der ursprünglichen Pfarrkirche im
nunmehrigen Altweitra an die Stadtkirche waren auch die kirchlichen
Mittelpunktsfunktionen an die Neugründung übergegangen.
Spätestens zu Beginn des 14. Jhdts. wurde durch die Errichtung der
„Mittleren Zeile" der große Platz verkleinert, nach dem Bau eines
Rathauses auf dem Platz (1431) durch den Gebäudekomplex des Grätzels.
Außerhalb der Stadtmauern war schon zu Beginn des 14. Jhdts. in der
Niederung an der Lainsitz die Vorstadt „Ledertal" entstanden. Als
wichtige städtische soziale Institution wurde hier 1340/41 das
Bürgerspital gestiftet. Der Umfang dieses Baubestandes blieb - von
geringfügigen Erweiterungen abgesehen - bis in das späte 16. Jh.
gleich. Gegen Ende des 18. Jhdts. entstanden außerhalb der Stadtmauern,
am Fuß des Schloßberges und parallel dazu links vom Weiherbach, die
beiden „Berg- und Wasserzeile" genannten Reihen eingeschossiger Häuser,
wo Leinweber wohnten und arbeiteten. Nach dem Bau der Schmalspurbahn
Gmünd - Groß Gerungs entstand zu Beginn des 20. Jhdts. an der den
Bahnhof mit der Stadt verbindenden Straße eine Reihe von Villen.

Turmglocken Schloß Weitra:
1. von Hans Lang 1606 in Steyr gegossen mit 200 kg
2. von F. Vötterlechner 1756 in Krems gegossen mit 80 kg

DER BAROCKE DACHSTUHL UND DAS GEWÖLBE DER ALTEN SCHLOSS-KAPELLE
Nach dem Brand von 1747, dem der Turmhelm zum Opfer fiel, kam es 1757
neuerlich zum Ausbruch eines Feuers, welches große Teile des
Dachstuhles und die Schloßkapelle im 2. Stock vernichtete. Daraufhin
verlegte man die Kapelle in das Erdgeschoß. Der Dachstuhl wurde
erneuert und befindet sich nun größtenteils im barocken
Originalzustand. Aus der zerstörten Kapelle, dessen Gewölbe hier zu
sehen ist, wurde anläßlich der NÖ. Landesausstellung 1994 ein Festsaal
eingerichtet, der zahlreichen Veranstaltungen dient.

Erforschen Sie die Geschichte und die Geheimnisse des Schlosses vom
Turm bis zu den Kellern. Das Schloss ist ein mächtiger Vierecksbau,
dessen nördliche Längsseite ein Turm überragt. Der rechteckige Hof hat
an seinen Schmalseiten dreigeschossige Arkaden auf Granitpfeilern. Sie
sind mit Löwenköpfen, Muscheln und stilisierten Schwertern geziert -
Symbolen von Santiago de Compostela, da Schloss-Erbauer Wolf Rumpf
Freiherr von Wielroß Großmeister des gleichnamigen Ritterordens war. In
der Mitte befindet sich ein Renaissancebrunnen. Über den Arkadenhof
gelangen Sie in das außergewöhnlich schöne Schlosstheater, das 1885 im
Rokokostil adaptiert wurde.

Die Kuenringerburg wurde im Zuge der Gründung der Stadt Weitra (1201 -
1208) durch den Kuenringer Hadmar II. errichtet und nahm den höchsten
Punkt der Gesamtanlage ein. In ihrem Grundriß war sie von der Form des
den Berg bekrönenden Felsens bestimmt. Die Anlage erstreckte sich
zwischen zwei Türmen in West-Ostrichtung. Das Hauptgebäude gruppierte
sich in drei Flügeln um einen annähernd rechteckigen Hof, der im Süden
durch eine starke Schildmauer begrenzt war. Die Burg besaß vermutlich
zwei Wohngeschosse und war an einigen Stellen unterkellert. Küche und
Vorratskammern waren im Erdgeschoß untergebracht, während sich im
Obergeschoß ein Saal und eine heizbare Gaststube befanden.
Nach dem endgültigen Sturz der Weitraer Kuenringer (1296) gingen Burg,
Herrschaft und Stadt an die habsburgischen Landesfürsten über. Diese
gaben in den folgenden drei Jahrhunderten Weitra an verschiedene
Pfandinhaber weiter, bis schließlich 1581 Wolf Rumpf Freiherr zu
Wielroß, der ehemalige Kämmerer Kaiser Rudolfs II., Inhaber der
Herrschaft Weitra wurde.
Modell der Stadt Weitra (von O. Chmelik)
Vor allem auf der Basis des Bildes von 1730 wurde 1971 dieses Modell erstellt.

Ansicht der Stadt Weitra, Ölgemälde von 1730/1731
Die tatsächliche Blickrichtung des Bildes ist eher Nord-Süd. Der Maler
hat sich am unteren Bildrand selbst dargestellt. Ganz links ist der
Galgenberg mit dem Galgen zu erkennen, vor dem oberen Stadttor befinden
sich der Stadtteich, die herrschaftlichen Stadel, die 1724 errichtete
Statue des Hl. Johannes von Nepomuk und das überbrückte Röhrenteichel.
Entlang der äußeren Stadtmauer läuft der Stadtgraben. Unmittelbar
rechts neben dem oberen Tor befindet sich stadtseitig das Zeughaus;
unterhalb des Torturmes die Oswaldkapelle. Den Platz vor dem Rathaus
nehmen der Pranger aus Stein und die hölzerne Dreifaltigkeitssäule ein.
Eine, die heutige Auhofgasse fortsetzende Gasse, trennt den Komplex
Rathaus - Brotbänke - Waaghaus vom sogenannten Grätzel, einem Komplex
von zuletzt acht Wohnhäusern und dem Spitalkasten. Gegenüber der
Einmündung der Fleischgasse in den Rathausplatz sieht man die
gemauerten Fleischbänke, rechts davon sind ein Keller und das mittlere
Wasserkar zu erkennen. Das untere Wasserkar steht vor den
"Seitz-Bräuer'schen" Häusern. Durch das untere Stadttor und die
vorgelagerte Barbakane (= Vorwerk) gelangt man in das Ledertal, das vom
Gebäudekomplex des Bürgerspitales beherrscht wird.
Entlang der Lainsitz finden sich Mühlen. Der Turm der Stadtpfarrkirche
trägt noch die vier, 1772 entfernten gotischen Ecktürmchen. Um die
Kirche liegt der Friedhof, an dessen Südostecke das Bruderschafts- und
spätere Schulhaus steht. Parallel zur Kirche (südlich) befindet sich
die Friedhofskirche (der Karner), die gegen Ende des 18. Jahrhunderts
zum "Castellihaus" umgebaut wurde. Der Pfarrhof steht ungefähr
rechtwinkelig zur Kirche. Er wurde 1793 durch das heutige, in
West-Ost-Richtung verlaufende Gebäude ersetzt. Aus den Rauchfängen all
der Häuser, die die "Braugerechtigkeit" (das Braurecht) besaßen und
ausübten, steigt Rauch auf. Durch das untere Stadttor ist eine
sechsspännige Kutsche, der ein Herold vorausläuft, gefahren. In ihr
dürfte Frobenius Fürst zu Fürstenberg seinen Einzug in die Stadt
halten. Zu seiner Begrüßung werden im Basteigarten neben dem Schloß
Böller abgeschossen. Die Bürger, die erst einige Jahre davor nach einem
langen Prozeß unterworfen worden sind, scheinen von der Ankunft des
Fürsten demonstrativ kaum Notiz zu nehmen.

Mit dem Tod des Fürsten Joseph Maria Benedikt (1758-1796) erbt der
minderjährige Fürst Karl Egon II. (1796-1854) von der böhmischen Linie
auch die schwäbischen Besitzungen. Er ist der letzte Souverän des
Hauses Fürstenberg, bevor die Neuordnung Europas durch Napoleon dem
System des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation (1806) ein Ende
macht. Von da ab sind die Fürstenberger - wie schon zuvor in Böhmen und
Niederösterreich - auch in Schwaben nur noch mit hohen Privilegien
ausgestattete Untertanen (im Großherzogtum Baden, im Königreich
Württemberg und auf den Gebieten einer katholischen Linie des Hauses
Hohenzollern).
Karl Egon II. (1796-1854)

Landgraf Joachim Egon von Fürstenberg Eisenguß (unbekannter K.), Anfang 19. Jh.
Die Büste stammt aus dem Fürstenbergischen Eisengußwerk
Neu-Joachimsthal auf der Herrschaft Pürglitz. Landgraf Joachim Egon
(1749-1828) im Ornat des Ordens der Ritter vom Goldenen Vlies.

Mehr als 800 Jahre Geschichte von Stadt und Schloss Weitra erwarten Sie
im liebevoll gestalteten Schlossmuseum. Von den Kuenringern bis zu den
heutigen Hausherren, der Familie Fürstenberg, spannt sich der
historische Bogen an Kunstwerken und Exponaten, der unter anderem auch
Einblick in das Handwerk und die regionale Wirtschaftsgeschichte des
Waldviertel bietet.

Wie in allen adeligen Häusern gab und gibt es auch auf Schloß Weitra
einen Kunst- und Kunsthandwerksbestand, der sich im Lauf der
Jahrhunderte angesammelt hat und die Interessen der jeweiligen
Herrschaftsinhaber widerspiegelt. Bis zum Jahr 1945 ist auch Schloß
Weitra in diesem Sinne voll eingerichtet gewesen. Das meiste davon ist
dann allerdings in den Wirren danach zugrunde- oder verlorengegangen.
In den beiden folgenden Räumen können Exponate besichtigt werden, die
einen Eindruck über die ehemals exquisite und gut sortierte
landgräfliche Sammlung und Hofhaltung vermitteln.
Auch die meisten dieser Kunstwerke waren nach dem Krieg mehr oder
weniger stark beschädigt und wurden teils im Auftrag von Prinz und
Landgraf Johannes Eduard Egon (geb. 1956) und teils für die
Landesausstellung 1994 durch das Land Niederösterreich restauriert.
Nicht aus Weitra, sondern aus den F. F. Sammlungen in Donaueschingen
stammen das Bildnis Rudolphs II. von dessen Hofmaler Hans von Aachen
und das Faksimile des Nibelungenliedes.

Schäfchensammlung Prinzessin Wilhelmine
Die Großmutter des heutigen Schlossbesitzers, Wilhelmine Prinzessin zu
Fürstenberg, geborene Gräfin von Schönburg-Glauchau (1902-1964), wuchs
in Sachsen auf, das ein traditionelles Zentrum europäischer
Porzellankunst war. Die Königlich Sächsische Manufaktur Meissen lag
sozusagen vor ihrer Haustüre, und schon in jungen Jahren begann
Prinzessin Wilhelmine intensiv Porzellan zu sammeln, speziell mit dem
Thema Schafe und Schäferszenen. Beispiele dieser Sammelleidenschaft,
gefertigt von nahezu allen großen und bedeutenden Manufakturen des
alten Europas, sind hier zu bestaunen: Meissen, Nymphenburg, Berlin,
Wien, Ludwigsburg und andere.

Max Egon zu Fürstenberg 1899
F.E. Laszlo von Lombos (1869-1937), Öl auf Leinwand
Rechts unten signiert und datiert: Laszlo F.E. 1899 VII.
Links oben Inschrift: MAXIMILIANUS EGONUS PRINCEPS DE FUERSTENBERG
Irma Prinzessin zu Fürstenberg 1899
F.E. Laszlo von Lombos (1869-1937), Öl auf Leinwand
Rechts unten signiert und datiert: Laszlo F.E. 1899 Aug.
Links oben Inschrift: IRMA PRINCIPESSA DE FUERSTENBERG
Fülöp Elek (Philipp Alexius) Laszlo von Lombos (1869-1937)
Laszlo von Lombos war ein in Paris und München ausgebildeter
Gesellschaftsmaler; er war vor allem an den europäischen Fürstenhöfen
für den Hochadel tätig. Er unterhielt Ateliers in Budapest und London
und wurde vielfach ausgezeichnet. Später, als naturalisierter
Engländer, war er Präsident der Royal Society of British Artists. Von
der Kritik wegen seiner eklektizistischen Malweise herb getadelt, tat
dies seiner großen Beliebtheit in höchsten Kreisen keinen Abbruch.

Mehr als 800 Jahre Geschichte von Stadt und Schloss Weitra erwarten Sie
im liebevoll gestalteten Schlossmuseum. Von den Kuenringern bis zu den
heutigen Hausherren, der Familie Fürstenberg, spannt sich der
historische Bogen an Kunstwerken und Exponaten, der unter anderem auch
Einblick in das Handwerk und die regionale Wirtschaftsgeschichte des
Waldviertels bietet.
Karl Egon III. (1820-1892)

Landgraf Fürst Karl Egon V. zu Fürstenberg (John Quincy Adams, 1929, Öl auf Leinwand)
Rechts unten signiert und datiert: John Quincy Adams 1929.
Fürstin Franziska ("Mena") zu Fürstenberg (John Quincy Adams, 1927, Öl auf Leinwand)
Links unten signiert und datiert: John Quincy Adams 1927.
John Quincy Adams (1874-1933)
Der Porträt-, Genre- und Landschaftsmaler John Quincy Adams bildete
sich nach dem Studium an der Wiener Akademie bei S. l'Allemand und A.
Eisenmenger an der Münchner Akademie bei K. Marr, und H. Herterich
sowie an der Académie Julien in Paris bei J.B. Laurens und B. Constant
weiter aus. Besonders als Porträtist war er in den Kreisen des Adels
und des Großbürgertums sehr beliebt.

Schnapphahnflinte - Erzeuger unbekannt, um 1650, Schnapphahnflinte bzw. Miqueletschloß

Holzkohlenmeiler - Holzkohle entsteht durch "Verschwelung" (Verbrennen
ohne Luftzufuhr). Dazu wurde das Holz wie im Modell aufgesetzt und dann
mit lehmiger Erde (Luftabschluß) bedeckt. Der Abbrand dauerte 4-6 Tage
und mußte ständig überwacht werden.

Holztransport - Bis zum Aufkommen von Traktor und LKW wurde fast alles gewonnene Holz mit Zugtieren (Pferde, Ochsen) aus dem Wald gebracht.
Hinterer Schlittenbock - Für den Transport von Bloch- und Langholz
wurden im Winter Pferdeschlitten verwendet. Bei längeren Transportwegen
wurde das Holz auf zwei Schlittenböcke geladen. Wegen der starken
Belastung wurde der Schlittenbock in der Regel aus Eichenholz gefertigt.
Deichsel und Trittel zum Einspannen der Pferde.
Zwei Sappel: Zum Verladen (Stoßen) von Rundholz (gerade), zum Ziehen von Rundholz (schräg).
Sonstige Forstgeräte
Schwemmhaken wurde bei der Holztrift zur Lenkung des Holzes und zur Öffnung von Verklausungen verwendet.
Mit dem Verschulrechen wurden im Forstgarten die Rillen gezogen, in die die kleinen Sämlinge gepflanzt wurden.
Der Drehhaken wurde zum Fällen der Bäume (wenn der Baum beim Fällen an
einem stehenden Baum hängen blieb) und zum Drehen des gefällten Baumes
zur Entrindung und Entastung verwendet.

Kardinal Friedrich Landgraf zu Fürstenberg (1813–1892), der letzte hochadelige Erzbischof von Olmütz (Olomouc)
Friedrich Landgraf zu Fürstenberg entstammte der 1755 begründeten
Landgräflichen Weitraer Linie des Hauses Fürstenberg. Seine Eltern
waren Friedrich Egon Landgraf zu Fürstenberg (1774-1856) und Theresa,
geb. Prinzessin Schwarzenberg (1780-1870). Schon früh für die
geistliche Laufbahn bestimmt, absolvierte er seine philosophisch
theologischen Ausbildungen in Wien und Olmütz, wo er 1839 zum Doktor
der Theologie promoviert wurde. Schon 1836 war er von seinem Cousin
Friedrich Fürst Schwarzenberg, dem damaligen Erzbischof von Salzburg
und späteren Erzbischof von Prag, in der Pfarrkirche von Weitra zum
Priester geweiht worden. Nachdem er Kooperator in der Pfarre St.
Michael in Olmütz gewesen war, kam er - 1839 von seinem Vater, dem
zuständigen Patron, präsentiert - als Pfarrer auf die fürstenbergische
Patronatspfarre Harbach bei Weitra. Schon 1843 wurde er Dechant und
Propst des Kollegiats - Kapitels St. Mauritz in Kremsier (Kroměříž),
1849 Domkapitular in Olmütz. 1853 wählte ihn schließlich das Domkapitel
zum Fürsterzbischof von Olmütz. Die Bischofsweihe erteilte ihm wieder
sein Cousin Friedrich Fürst Schwarzenberg, der inzwischen Kardinal und
Erzbischof von Prag geworden war. 1879 kreierte ihn Papst Leo XIII. zum
Kardinal.
Das Erzbistum Olmütz war eines der am reichsten dotierten Bistümer der
Österreichischen Monarchie. Nach den Fürsten Liechtenstein nahm das
Erzbistum Olmütz mit insgesamt 36.000 Hektar Grundfläche die zweite
Stelle unter den Großgrundbesitzern in Mähren ein. Außerdem verfügte es
noch über Güter im damaligen Österreichisch - Schlesien und im
damaligen Preußisch - Schlesien. Kardinal Fürstenberg war der letzte
Hochadelige in der Reihe der Ölmützer Erzbischöfe. Verschiedene seiner
Aktionen lassen aber schon auf eine gewisse soziale Einstellung den
unteren Bevölkerungsschichten gegenüber schließen. Unter seiner
Amtszeit wurden nach ungefähr 200 Jahren wieder Nichtadelige in das
Domkapitel, dem auch die Wahl des Erzbischofs oblag, aufgenommen, so
dass bei seinem Tode (20. August 1892) sieben adeligen Domherren sieben
bürgerlicher Herkunft gegenüberstanden. Diese wählten einen
Nichtadeligen jüdischer Abstammung zum neuen Erzbischof, nämlich den
Professor für Kirchenrecht Dr. Theodor Kohn.

Der Ornat von Friedrich Kardinal und Landgraf zu Fürstenberg:
Der kostbare Doppelornat wurde für die Priesterweihe und die Primiz von
Friedrich Landgraf zu Fürstenberg (1836) von den Verwandten des
Neupriesters gestickt: Die Seitenteile der liturgischen Gewänder sind
aus Gold- und Silberbrokat, die Mittelteile sind in Gobelinstickerei in
den Farben Weiß, Rot und Gold ausgeführt. Echte Goldborten bilden die
Einfassungen, die Ränder sind in Samt eingefasst. An den Dalmatiken
sind Goldquasten zu befestigen, deren Mittelstücke feinste Handarbeit
sind. Da der Ornat für die Priesterweihe geschaffen wurde, ist er in
doppelter Ausführung verfertigt: Für den die Weihe spendenden
Erzbischof und seine Assistenz sowie für den zu weihenden Kandidaten.
Daher besteht der gesamte Doppelornat aus zwei Messgewänder Casulae),
zwei Vespermänteln (Pluviale), vier Dalmatiken, fünf Stolen, sechs
Mampeln, zwei Kelchvelen und zwei Bursen. Nach dem Tod des Kardinals
kam der gesamte Doppelornat an die Pfarrkirche in Weitra.
Nur einige Stücke davon sind hier ausgestellt:
1 Messgewand (Casula): Der Erzbischof, der die Messe mit dem
Weihekandidaten gemeinsam zelebrierte, trug ein Messgewand aus
Goldbrokat, der Neupriester eines aus Silberbrokat.
1 Vespermantel (Pluviale): Der Archidiakon (Presbyter assistens,
Manuductor) hatte den Neugeweihten bei sei-ner ersten Messfeier
einzuführen und trug einen prunkvollen Vespermantel.
2 Dalmatiken (dalmaticae): Die assistierenden Diakone bzw. Subdiakone trugen Dalmatiken.
4 Stolen: Die Stola ist ein Amtszeichen für Priester und Diakon
2 Manipel: Den Manipel, der historisch auf ein Handtuch zurückgeht,
trugen der zelebrierende Priester und seine Assistenz am linken Arm.
1 Kelch - Velum: Mit dem Kelch - Velum war während des
Wortgottesdienstes der Kelch zugedeckt. (Darauf lag die Bursa, eine
quadratische Stofftasche, in der das Corporale steckte, ein
quadratisches Tuch aus Leinen, auf das während der Messe die Hostie
gelegt wurde)
1 Palla: Mit der Palla wurde der Kelch von der Gabenbereitung bis zur Kommunion zugedeckt.

Ackerbürgerstadt Weitra
Wie in allen niederösterreichischen Kleinstädten gehörte auch in Weitra
der überwiegende Teil der Bürger der Stadt dem Typ der Ackerbürger an:
Man übte zwar ein Gewerbe aus, zum Haus gehörten aber auch
landwirtschaftliche Gründe außerhalb der städtischen Siedlung. Somit
war mit dem Haus eine Landwirtschaft verbunden. Jahrhunderte hindurch
lebten die Weitraer Bürger in der Regel von ihrem Gewerbe und von ihrer
Landwirtschaft. Erst im 20. Jahrhundert, vor allem in der Zeit nach dem
Zweiten Weltkrieg, setzte hier eine grundlegende Änderung ein: Die
Mechanisierung der Landwirtschaft erforderte mehr und größere
Betriebsflächen, traditionelle Gewerbe verschwanden allmählich. Für die
Ackerbürger zahlte sich der Ankauf der teuren landwirtschaftlichen
Maschinen und Geräte nicht aus. Die Bauern der umliegenden Dörfer
benötigten zusätzliche Flächen, damit sich der Ankauf der Maschinen
rechnete. Nach und nach gaben somit die Stadtbewohner ihre
Landwirtschaften auf, verpachteten ihre Gründe und wechselten z. T. in
andere Berufe über. Viele wurden Unselbständige.

Ein typisches Ackerbürgerhaus mit relativ großem Grundbesitz war das
Haus Rathausplatz 20 (alte Nummer 143). Es war von 1779 bis 1959 im
Besitz der Familie Brunner und diente Generationen hindurch als
Fleischhauerei, Gasthaus, zeitweise auch als Brauhaus. Die hier
ausgestellten Möbel und Einrichtungsgegenstände stammen aus diesem Haus
und zeigen den typischen Wohnstil kleinstädtischen Bürgertums im 19.
Jhdt.

Seit dem 18. Jahrhundert befindet sich an dieser Stelle ein Schloßtheater.
1885 wurde dieses, veranlaßt durch Landgraf Eduard Egon (1843-1932), im
Rokokostil umgestaltet und vergrößert. Die Pläne für diesen Umbau
stammen von A. Führer aus Wien, die Baumeisterarbeiten führte die
Weitraer Firma H. Schneider durch, die Tischlerarbeiten K. Romeder aus
Weitra (Proszenium, Portale), Franz Wildschek aus Gratzen (Bänke). H.
Schattauer, ebenfalls Gratzen, machte Bildhauer- und Vergolderarbeiten,
während die reichen Ornamente und die Rosette im Plafond von der Firma
M. Hentschel aus Wien geliefert wurden. Um eine rasche Verwandlung zu
ermöglichen, wurde das Theater mit einem Schnürboden ausgestattet und
erhielt eine Gasbeleuchtung.

Das neue Theater wurde besonders in den ersten Jahren nach dem Umbau
von der Landgräflichen Familie, Verwandten und Angestellten des
Gutsbetriebes häufig bespielt. Aus dieser Zeit stammen die im Foyer
hängenden „Theaterzettel". 1983 wurde im Rahmen der
800-Jahr-Feierlichkeiten der Stadt Weitra das Schloßtheater von Grund
auf renoviert und dient seitdem als Aufführungsort für die
verschiedensten kulturellen Veranstaltungen. Das Fassungsvermögen des
Theaters beträgt 155 Sitzplätze.

Schauplatz Eiserner Vorhang - Von den dramatischen Ereignissen am Ende
des 2. Weltkriegs über die Teilung in Ost und West bis zum Fall des
Eiserner Vorhangs. In einer Zeitreise können Sie den Hintergründen der
Teilung auf die Spur gehen, das Leben in Ost und West nachempfinden
sowie letztlich den Sieg der Freiheit 1989 erleben.
"FROM STETTIN IN THE BALTIC TO TRIESTE IN THE ADRIATIC AN IRON CURTAIN HAS DESCENDED ACROSS THE CONTINENT"
SIR WINSTON CHURCHILL
Die Ausstellung entführt Sie in eine bewegende Zeit der Geschichte. Die
Ausstellung beleuchtet die Teilung Europas, die Auswirkungen des Kalten
Krieges und die dramatischen Schicksale an der
österreichisch-tschechischen Grenze. Schloss Weitra bietet den idealen
Rahmen für diese spannende und lehrreiche Zeitreise.

VOM ZWEITEN WELTKRIEG DIREKT IN DEN KALTEN KRIEG
Am 8. Mai 1945 kapituliert das „Dritte Reich" - der Zweite Weltkrieg
ist in Europa zu Ende. Kurz davor zeichnen sich aber schon neue
Konfliktlinien ab, diesmal unter den Alliierten. Hatte der Kampf gegen
den Nationalsozialismus die Allianz zwischen den Demokratien USA und
Großbritannien einerseits und der kommunistisch-stalinistischen
Sowjetunion andererseits geeint, hielt diese Zweckgemeinschaft nur so
lange, als es das Kriegsgeschehen erforderte: Schon auf der Konferenz
von Jalta im Februar 1945 beginnt die Einheit zu bröckeln. Franklin D.
Roosevelt, Winston Churchill und Josef Stalin teilen Europa in
Einflusssphären auf, mit denen auch die Besatzungszonen in Deutschland
und Österreich grundsätzlich feststehen. Die Details verhandelt man bei
weiteren Treffen. Nach Roosevelts Tod im April 1945 zerbricht die
Koalition mehr und mehr - während die Sowjetunion an der Bildung eines
strategischen Sicherheitsgürtels von Satellitenstaaten arbeitet,
versuchen die Westalliierten eine Ausbreitung des Kommunismus in Europa
zu verhindern. Der „Kalte Krieg" bricht aus. In dieser Atmosphäre
spricht Winston Churchill in seiner berühmten Rede in Fulton 1946 von
einem „Eisernen Vorhang": „Von Stettin an der Ostsee bis Triest an der
Adria hat sich ein Eiserner Vorhang über den Kontinent gesenkt."
DER „EISERNE VORHANG" WIRD WIRKLICHKEIT
In Osteuropa sehen sich die kommunistischen Parteien schon bald nach
ihrer Machtergreifung mit einem Problem konfrontiert, das alle Staaten
gleichermaßen betrifft: einer starken Fluchtbewegung ihrer Bevölkerung
nach dem Westen. An den Grenzen zwischen Ost und West werden
Absperrungen hochgezogen. Der „Eiserne Vorhang" - bis dahin eine
Metapher für die Blockbildung in Europa - manifestiert sich ab Ende der
1940er-Jahre konkret... und in Etappen: Ungarn beginnt 1948 die Grenze
zu sperren, die Tschechoslowakei errichtet ab 1950 Sicherheitsstreifen,
und an der innerdeutschen Grenze wird von 1952 an eine fünf Kilometer
breite Sperrzone eingerichtet. Die kommunistische Propaganda
kommuniziert den Zweck der Absperrungen freilich anders: Sie seien
gegen den kapitalistischen Westen gerichtet, mögen Eindringlingen,
Spionen und Konterrevolutionären ebenso Einhalt gebieten wie einer
heraufbeschworenen militärischen Expansion des Westens. Der „Eiserne
Vorhang" wird in den kommunistischen Regimen zum Instrument der inneren
Konsolidierung und der Unterdrückung der eigenen Bevölkerung.

BÜNDNIS ODER ZWANGSSYSTEM?
Der ideologische und machtpolitische Gegensatz zwischen der Sowjetunion
und den USA verschärft sich nach 1945 zusehends. Schon 1949 schließen
sich die wichtigsten demokratisch regierten Staaten Europas (anfangs
mit Ausnahme West-Deutschlands) mit den USA zur NATO zusammen. Diesem
Verteidigungsbündnis setzt die Sowjetunion 1955 in Form der Warschauer
Vertragsorganisation ihr eigenes Bündnis entgegen. Das militärische
Rückgrat der NATO und des „Warschauer Pakts" bilden die Streitkräfte
der USA und der Sowjetunion. Während des Kalten Krieges sind zeitweilig
rund 270.000 US-Soldaten in Westeuropa stationiert. Die Sowjetarmee hat
sogar bis zu 600.000 Mann in den kommunistischen „Bruderstaaten" stehen.
"ALL FREE MEN, WHEREVER THEY MAY LIVE, ARE CITIZENS OF BERLIN. AND
THEREFORE AS A FREE MAN, I TAKE PRIDE IN THE WORDS: ICH BIN EIN
BERLINER."
JOHN F. KENNEDY, Westberlin, 26. Juni 1963

Alliierte Reiseerlaubnis für Hugo Wazlawik, 8. Oktober 1945
Der Verkehr zwischen den alliierten Besatzungszonen wird anfangs
rigoros geregelt. Um die Demarkationslinien zu überwinden, braucht es
eigene Passierscheine, die in Deutsch und zusätzlich meist in den
Sprachen der Besatzungsmächte ausgestellt sind. Während die westlichen
Besatzungsmächte die Beschränkungen bald reduzieren, erlaubt die
Sowjetunion erst 1953 Lockerungen.
Schillingnoten der Alliierten Militärbehörde, um 1945
Nach dem Zusammenbruch des „Dritten Reichs" trachten die Alliierten
danach, die österreichische Wirtschaft ehestmöglich wieder in Gang zu
bringen. Eine stabile Währung stellt die Grundlage hierfür, vor allem
aber auch für eine erfolgreiche Besatzungspolitik dar. Die alliierten
„Militärschillinge" sind der erste Schritt von der Reichsmark der
NS-Zeit zum Schilling der Zweiten Republik.
Gutscheine für den Bezug von Fahrscheinen und Zeitungen, um 1947
In den unmittelbaren Nachkriegsjahren sind solche Gutscheine oft Teil
des Gehalts oder werden ausgegeben, um den Erscheinungen der
Mangelwirtschaft zu begegnen.
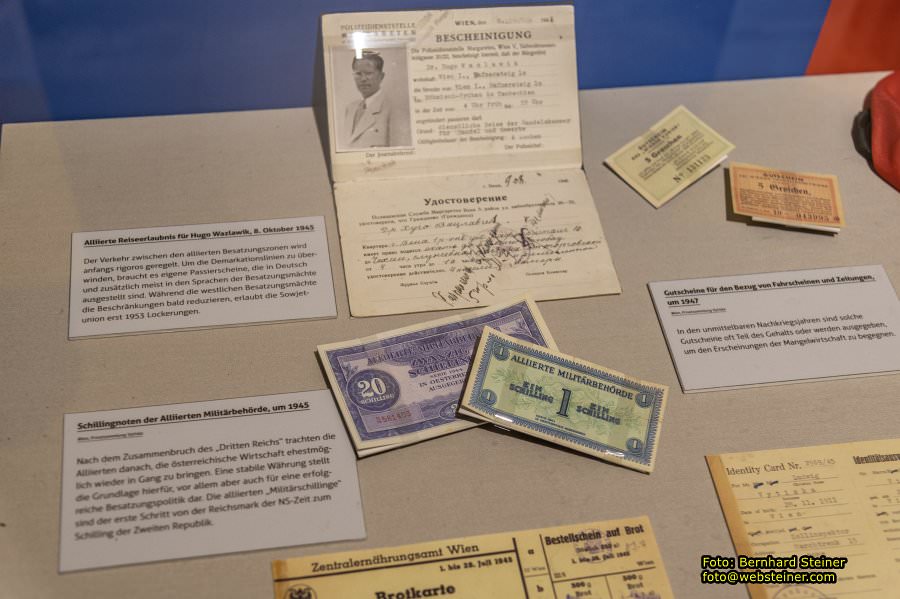
OST-WEST-TEILUNG
Nach 1945 werden die im Einflussbereich der Sowjetunion liegenden
Staaten immer mehr von Moskau abhängig. Die Rote Armee kam, befreite
die Länder von der deutschen NS-Besatzung... und blieb, offiziell
freilich, um die Nachschubwege ins besetzte Deutschland und Österreich
zu sichern. Die Soldaten verleihen der sowjetischen Machtpolitik
wirkungsvoll Nachdruck. Die Sowjetunion fördert die Machtergreifung der
einheimischen kommunistischen Parteien oder installiert selbst
sozialistische Regierungen. Spätestens ab 1948 stehen einander in
Europa zwei Blöcke gegenüber: politisch, gesellschaftlich, ideologisch,
wirtschaftlich und in weiterer Folge militärisch. Europa ist geteilt:
Auf der einen Seite der demokratische „Westen" - unterstützt von den
USA, ist er dank des „Marshallplans" marktwirtschaftlich ausgerichtet
und setzt erste integrationspolitische Maßnahmen. Auf der anderen Seite
der „Osten" - unter der Hegemonie der Sowjetunion werden
Planwirtschaft, Kollektivierung und Verstaatlichung forciert.
ÖSTERREICHS ROLLE IM GETEILTEN EUROPA
Österreich ist vom NS-Regime befreit... und doch nicht frei. Die
Siegermächte USA, Großbritannien, UdSSR und Frankreich besetzen das
Land und teilen es im Juli 1945 in vier Besatzungszonen auf. Die
Regierungen in Bund und Ländern unterstehen der alliierten Kontrolle -
erst 1955 wird Österreich seine staatliche Souveränität wiedererlangen.
Dennoch steht das Land 1945 erstmals nach zwölf Jahren wieder auf dem
Boden der Demokratie. Aus den Nationalratswahlen vom 25. Oktober 1945
geht die ÖVP mit absoluter Mehrheit hervor. Unter Leopold Figl (ÖVP)
wird eine Konzentrationsregierung aus ÖVP, SPÖ und KPÖ gebildet, aus
der die KPÖ 1947 jedoch ausscheidet. Nun beginnt die Ära der Großen
Koalition, als verbindende Klammer wirken der Mythos der Lagerstraße
und die alliierte Besatzung. Wirtschaftlich profitiert Österreich -
ausgenommen die sowjetische Besatzungszone - vom „Marshallplan" der
USA. Nach dem Tod Stalins rückt der Abschluss eines Staatsvertrages in
die Nähe. Mit der Unterzeichnung am 15. Mai 1955 und der Zusicherung
„immerwährende Neutralität" zu üben, beginnt Österreichs Weg zurück in
die internationale Staatengemeinschaft. Wegen seiner Lage zwischen den
beiden Blöcken wird Wien ab 1961 vermehrt als Verhandlungsort zwischen
der Sowjetunion und den USA genutzt.
WAPPENADLER DER ZWEITEN REPUBLIK
Seit 1955 liegt Österreich als souveräner und neutraler Kleinstaat
zwischen den Machtblöcken. Die Neutralität ist in der Verfassung
festgeschrieben und verpflichtet die Republik zur militärischen
Verteidigung ihres Territoriums. Das Österreichische Bundesheer wäre im
Ernstfall dazu jedoch kaum in der Lage gewesen. Das hat seine Ursache
nicht nur in der gewaltigen Übermacht der potentiellen Angreifer,
sondern auch in der innenpolitischen Situation des Landes. Beide
Regierungsparteien halten militärischen Widerstand insgeheim für
aussichtslos und wollen daher nicht zu große Summen in die
Landesverteidigung investieren. Und eine dieser Regierungsparteien
pflegt zudem ein historisch belastetes Verhältnis zum Thema Militär.
Dies nicht zuletzt deshalb, weil es in ihren Reihen lange Zeit für
möglich gehalten wird, dass das Heer im (unwahrscheinlichen)
Bürgerkriegsfall sich gegen die Partei wendet.

DIE AUSBILDUNG DES „OSTBLOCKS"
Die sowjetische Besatzung in Teilen Österreichs und Deutschlands
festigt den kommunistischen Einfluss in den östlich angrenzenden
Staaten. Die starke Präsenz der Roten Armee ermöglicht die
Machtübernahme der Kommunisten in Polen, im sowjetisch besetzten Teil
Deutschlands, in Rumänien und Ungarn. In Jugoslawien und Albanien ist
der Erfolg der kommunistischen Parteien von der Partisanenbewegung
getragen. Lediglich in der Tschechoslowakei und in Bulgarien kommen die
kommunistischen Parteien durch Wahlen an die Macht. Die neuen
Volksdemokratien bilden politisch und wirtschaftlich eine Gegenwelt zum
freien Westen: In Einparteiensystemen diktieren die nach
stalinistischem Modell organisierten kommunistischen Parteien das
Geschehen. Politische Gegner, oftmals aber auch unliebsame
Parteimitglieder werden verfolgt und in Schauprozessen drakonisch
abgeurteilt. Die autoritär strukturierten Staaten befinden sich fest in
der Hand der kommunistischen Parteien. Die Medien werden kontrolliert,
die Kultur wird staatlich gelenkt und die Meinung streng überwacht. Ein
immenser Sicherheitsapparat mit einem dichten Netz an Informanten sorgt
für die Unterdrückung jeglicher Opposition - auch wenn die Meinung nur
in privatem Rahmen geäußert wird.
Uniform der Nationalen Volksarmee der DDR
Mit dem Aufbau der Befestigungsanlagen entlang der Grenze ab 1952 und
dem vereinbarten Rückzug der Roten Armee aus der DDR von Mitte der
1950er-Jahre an erfolgt die schrittweise Umbildung der Grenzpolizei in
militärische Grenztruppen. Nach dem Mauerbau 1961 werden diese dem
Ministerium für die Nationale Verteidigung unterstellt und bilden wenig
später die Grenztruppen der Nationalen Volksarmee (NVA). Als ab 1962
militärische Grenzregimenter aufgestellt werden, bekommt die Sicherung
der Grenze wie auch in anderen Staaten des Ostblocks streng
militärischen Charakter.

DER WEG DES WESTENS IN DIE INTEGRATION
Nach dem Zweiten Weltkrieg ziehen sich die USA nicht wie 1918 aus
Europa zurück. An der Spitze der westlichen Alliierten stehend, räumen
sie dem raschen wirtschaftlichen wie auch politischen Aufbau
Westeuropas Priorität ein. Nur so könne die Expansion der Kommunisten -
die nach 1945 auch in Italien und Frankreich durch starke Parteien
vertreten sind - aufgehalten werden. Auf politischer Ebene will man die
westlichen Demokratien zu mehr Zusammenarbeit führen. Der über
Jahrhunderte zerstrittene Kontinent soll nun kooperieren: 1949 wird der
Europarat als erstes Forum für den europäischen Austausch gegründet.
Damit einher geht die Zusammenarbeit auf wirtschaftlicher Ebene. Die
massiven Zollgrenzen und Handelsschranken der Zwischenkriegszeit sollen
der Vergangenheit angehören. Die USA unterstützen den Wiederaufbau mit
dem „Marshallplan". Um die Empfängerstaaten in die Entscheidungen
einzubinden, wird 1948 die Organisation für europäische wirtschaftliche
Zusammenarbeit (OEEC) ins Leben gerufen. Mit der später gegründeten
Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) ist der Grundstein
für die heutige Europäische Union gelegt. Militärisch schließt sich der
Westen 1949 in der NATO (Organisation des Nordatlantikpakts) zusammen.
DIE GRENZWACHE IN ÖSTERREICH
Über 40 Jahre hinweg stehen einander am „Eisernen Vorhang" Organe
beider Staaten zu dessen Überwachung gegenüber. Für die Republik
Österreich wird diese Aufgabe von der Zollwache und der Gendarmerie
übernommen. Sollte es zu einem Krieg kommen, so der Plan, würden sie
vom österreichischen Bundesheer unterstützt beziehungsweise durch
dieses ersetzt werden. Als dieser Fall im Sommer 1968 beinahe eintritt,
sieht die österreichische Bundesregierung aus diplomatischem Kalkül
davon ab, das Bundesheer direkt an die
österreichisch-tschechoslowakische Grenze zu schicken. Im Gegenteil:
Garnisonen werden aus dem unmittelbaren Grenzgebiet sogar abgezogen.
Einzig die Zollwache und die Gendarmerie verbleiben an der Grenze. Sie
vermitteln der Bevölkerung, in der die Erinnerung an die sowjetische
Besatzungszeit noch allzu präsent ist, zumindest ein Mindestmaß an
Sicherheitsgefühl.

Spitzenhaube auf einer Klöppelrolle
Von König Ottokar II. Přemysl bereits im 13. Jahrhundert nach Böhmen
geholt, leben deutsche Handwerker und Bauern bis ins 19. Jahrhundert
nachbarschaftlich mit den Tschechen in den Ländern der böhmischen Krone
zusammen und entwickeln ihre eigenen Bräuche. In den deutsch
besiedelten Gebieten Böhmens und Mährens ist etwa das Klöppeln weit
verbreitet. Diese Kunstfertigkeit wird auch nach der Vertreibung 1945
an die Jugend weitergegeben.

ALLTAG - KINDERZIMMER
Die Trennung der beiden Blöcke wirkt sich auch stark auf die
Lebensrealität der Kinder und Jugendlichen dies- und jenseits des
„Eisernen Vorhangs" aus. Die unmittelbaren Nachkriegsjahre sind noch
allgemein vom Verlust von Familienangehörigen, von Mangel und
Entbehrungen gekennzeichnet. Im Zuge des „Wirtschaftswunders" hält eine
wachsende Vielzahl von Konsumartikeln und Spielsachen Einzug in
westliche Kinderzimmer - im Osten trachtet das sozialistische System
danach, die Kinder und Jugendlichen auch in der Freizeit zu
vereinnahmen und mit dem angebotenen Spielzeug zu indoktrinieren.
Jugendliche Subkulturen finden im Westen öffentliche Plattformen und
werden rasch kapitalistisch vermarktet; im Osten betrachtet man
ähnliche Phänomene als subversiv, Anhänger müssen mit Verfolgung
rechnen. Vor allem die Musik und zu Helden stilisierte Persönlichkeiten
überwinden jedoch den „Eisernen Vorhang" - Mao Tse-tung und Ernesto
„Che" Guevara werden zu Leitfiguren der westlichen Jugendbewegungen,
die Beatles, Coca-Cola und Jeans zu Objekten der Begierde für die
Jugendlichen des Ostens.
WOHNEN UND ALLTAG IN WEST UND OST
Aufgrund der Kriegsschäden des Zweiten Weltkriegs und der
Flüchtlingsströme herrscht zunächst sowohl im Westen als auch im Osten
starke Wohnungsnot. In der BRD kann die Wohnungssituation bis in die
1970er- und 1980er-Jahre - durch Bauprogramme und finanziert unter
anderem durch die im Lastenausgleichsgesetz 1952 bestimmten
Zwangshypotheken - einigermaßen konsolidiert werden. Wesentlich für das
Alltagsleben im Westen ist, dass seit den ersten Nachkriegsjahrzehnten
nach US-amerikanischem Vorbild immer mehr elektrische Geräte Einzug im
Haushalt halten und bedeutende Arbeitserleichterung bieten. Auch das
Fernsehen tritt seinen Siegeszug als Massenmedium an. Von Mitte der
1970er-Jahre an werden auch die Jugendzimmer mittels Stereoanlagen,
später auch Walkmans oder erster Heimcomputer regelrecht
„elektrifiziert".
KONSUM
In der westlichen Jugendkultur erscheinen Individualismus und
Konsumismus als die beiden Seiten derselben Medaille. Im Laufe der
Nachkriegszeit hält eine wachsende Vielzahl von Konsumartikeln und
Spielsachen auch in westlichen Kinderzimmern Einzug, bis schließlich
der Überfluss immer deutlicher wird, woran auch Kritik geübt wird.
Gezielte Vereinnahmung findet bereits ab dem Kindesalter statt und mit
höchst professionellem Marketing versuchen die Firmen, die Kunden
dauerhaft an sich zu binden. Marken und Logos spielen dabei eine
zentrale Rolle. Tatsächlich wird von den Jugendlichen auch mit den
Marken und den Images gespielt. Jeder stellt sich seinen eigenen
Stilmix zusammen. Gleichzeitig versuchen manche Firmen sich auch
gesellschaftskritisch zu geben, wie etwa mehrere Werbelinien der Firma
Benetton zeigen.
KULTUR - LITERATUR - MUSIK
Weitestgehend frei von Zensur kann sich im Westen die moderne
Literatur, auch mit kritischen Werken, entfalten. Daneben boomen
Unterhaltungs- und Trivialliteratur - eine regelrechte Industrie
bedient die rasch steigende Zahl an Lesern. Auch verschiedene Bereiche
von Hobby und Freizeit werden publizistisch vermarktet, und nicht
zuletzt prägen Jugendzeitschriften wie „Bravo" Generationen
heranwachsender Jugendlicher in Deutschland und Österreich. Kaum etwas
symbolisiert die Verbreitung der US-amerikanischen Populärkultur im
Westen stärker als Walt Disneys „Micky Maus"-Hefte, hier Exemplare aus
den Jahren 1984 bis 1989. Für deren große Popularität im
deutschsprachigen Raum ist in hohem Maße Erika Fuchs verantwortlich,
die als Übersetzerin der Abenteuer ins Deutsche einen sehr
charakteristischen Sprachstil entwickelt. Doch auch aus der
Tschechoslowakei stammende Unterhaltung - vor allem Serien wie „Der
kleine Maulwurf" oder „Pan Tau" - begleitet die Kindheit einer ganzen
Generation von Fernsehzuschauern im Westen. Für Jugendliche auf beiden
Seiten des Eisernen Vorhangs ist Musik ein wichtiges
Identifikationsmittel. Im Westen deckt eine rasant wachsende Industrie
die große Nachfrage nach Alben international bekannter Künstler. Neben
Massen kommerzieller Musik - hier LPs von David Hasselhoff, Lionel
Richie etc. - finden auf diesem Weg auch kritische Gedanken Verbreitung.
IDOLE - POLITIK
Während sich im Westen die traditionelle Bindung größerer
Bevölkerungsteile an politische Parteien im Laufe der Nachkriegszeit
allmählich auflöst, kommen im Zuge der 1968er-Bewegung andere Formen
politischen Engagements auf - die Zivilgesellschaft und eine kritische
Öffentlichkeit entstehen. Andererseits spielt auch die Inszenierung
durch die Medien und die „Ikonisierung" unabhängig vom tatsächlichen
Inhalt eine Rolle. So können Mao Tse-tung und Ernesto Che Guevara
ebenso zu Leitfiguren der westlichen Jugendbewegungen werden wie Papst
Johannes Paul II. Im Westen haben Sportidole wie Boris Becker und
Steffi Graf eine ungeheure Breitenwirkung und Strahlkraft, ohne dass
dabei der Sport insgesamt so stark politisch aufgeladen wäre wie im
Osten.
REISEN
Fremdenverkehr und Reisen nehmen im Laufe der Nachkriegszeit im Westen
beständig zu. Auf unterschiedlichen Preisniveaus ist Reisen möglich.
Campingurlaube auch für weniger begüterte Familien oder die berühmten
Interrail-Reisen als Rucksacktouristen ermöglichen preisgünstiges
Reisen durch ganz Europa. Schließlich werden seit den 1980er-Jahren
auch Fernreisen für immer breitere Kreise erschwinglicher.
Gehen Sie auf die Suche nach berühmten Marken und poppigen Ikonen vergangener Zeiten!
Eine Auswahl: a-ha, Alf, Bandana, Batman, Benetton, Dieter Bohlen,
James Bond (Sean Connery), Coca Cola (mehrfach), Phil Collins, James
Dean, Donald Duck, Daisy Duck, M. C. Escher, Esprit, E.T., Samantha
Fox, Ernesto Che Guevara, Morten Harket (a-ha), David Hasselhoff, Papst
Johannes Paul II., Die Kinder vom Bahnhof Zoo, Bruce Lee, Madonna,
Micky Maus, Minnie Maus, Miami Vice, George Michael, Milli Vanilli,
Marilyn Monroe, „Palästinensertuch", Pepsi Cola, Toni Polster, Elvis
Presley, Rambo (Sylvester Stallone), Lionel Richie, Scorpions, Smiley,
Snoopy, Styx, Swatch.

WOHNEN UND ALLTAG IN OST UND WEST
Die Schaffung von ausreichendem Wohnraum ist ein zentrales Thema in der
DDR. Die Erfüllung der Versprechen hinkt indes der Realität hinterher.
Von den zu Beginn der 1970er-Jahre durch Erich Honecker versprochenen
drei Millionen neugebauten Wohnungen bis 1990 werden nur weniger als
2/3-in der berühmten „Plattenbauweise" - tatsächlich errichtet und die
Zahlen müssen geschönt werden. Deshalb ist das Leben in der tatsächlich
begehrten „Platte" für weniger Menschen Realität als das Wohnen in
heruntergekommenen Altbauten im Vorkriegszustand.
Hinsichtlich des Alltagslebens ist zu betonen, dass in der DDR nicht
nur die Versorgung mit Nahrungsmitteln sichergestellt ist und es alles
Lebenswichtige gibt, sondern, dass auch die meisten technischen
Produkte und Haushaltsgeräte vorhanden sind. Dabei ist jedoch im
Vergleich mit dem Westen die Markenvielfalt massiv eingeschränkt und
die Produkte sind nur schwierig und vor allem mit langen Wartezeiten zu
bekommen (Telefon, Auto, Kühlschrank).
KONSUM
In der DDR wird ein großes Spektrum der für den Alltag benötigten
Gebrauchsgüter in den sogenannten Volkseigenen Betrieben (VEB)
hergestellt. Es gibt durchaus den Versuch, alles zu haben: aber jeden
Produkttyp nur in einer Ausführung, außerdem nur in geringerer Anzahl
und in etwas mangelhafter Qualität, Teilweise produzieren die VEB auch
für den Westen wie beispielsweise für den „Otto-Versand", was dann aber
auf Kosten des Angebots im eigenen Land gehen kann. Auch gute
Waschmaschinen werden in den Westen exportiert. Ähnliches ist auch im
Chemie- und Pharmasektor zu bemerken, wo bestimmte Medikamente nur für
den Export produziert werden. Nicht zuletzt ist an einige Hersteller
von ostdeutschen Hochqualitätsprodukten zu denken (Carl Zeiss, Jenaer
Glas), oder auch an bestimmte weltberühmte traditionelle
Porzellanmanufakturen.
KULTUR - LITERATUR - MUSIK
Klassische Abenteuerliteratur, wie etwa die Romane von Karl May oder
Jack London, findet auf beiden Seiten des Eisernen Vorhangs Verbreitung
und lässt die Jugendlichen von fernen Ländern träumen. Die „Helden des
Ostens" werden vom Personenkult um die politischen Führer bestimmt und
ebenfalls in literarischer Form verewigt. Nicht zu vergessen ist, dass
in der DDR auch die Erinnerung an die deutsche Klassik und die
Goethezeit gepflegt wird. Eine Besonderheit ist etwa die
DEFA-Verfilmung von Thomas Manns „Lotte in Weimar" unter Einbindung
auch der westdeutschen Schauspielerin Lilli Palmer. Ein ebenso hoher
Stellenwert wie im Westen kommt Musik bei der Jugend im Osten zu.
Ähnlich wie im Westen dient sie abseits des Kommerzes, wie er in der
DDR etwa von den Puhdys oder Kreis bedient und mit der Sendung
„Beatkiste" populär gemacht wird, auch als Protestmedium. Zu erwähnen
sind etwa progressive DDR-Liedermacher wie Wolf Biermann oder Manfred
Krug. Hier können sehr kritische Musikstücke allerdings nur unter der
Hand - in Form des sogenannten Samisdat (von russ. Eigenauflage) oder
auch Magnitisdat (selbstgemachte Tonbandaufnahmen) - weitergegeben und
konsumiert werden.
IDOLE - POLITIK
Die Partei SED spielt stets mehr oder weniger stark in das Alltagsleben
der Menschen hinein. Und auch die Freizeit der Jugendlichen wird im
Osten teilweise vom Staat gestaltet. Eine Mitgliedschaft in der Freien
Deutschen Jugend (FDJ) der DDR oder bei den Pionieren wie es sie auch
in der Tschechoslowakei gibt, ist quasi verpflichtend. Neben
politischer Indoktrination, paramilitärischen Übungen oder Einsätzen
etwa als Erntehelfer oder Hilfspolizei bieten diese Organisationen aber
auch Aktivitäten, die jenen der Pfadfinder durchaus ähneln. Die Kinder-
und Jugendmagazine, ebenfalls nicht frei von staatlicher Kontrolle,
lassen sich als für Jugendliche maßgeschneiderte Parteiorgane
charakterisieren. Als besonders bedeutsam erweisen sich für die Regime
Vorbilder aus dem Sport, die der Welt durch ihre Leistungen die
Bedeutung der sozialistischen Staaten vor Augen führen sollen.
REISEN
Bürger der kommunistischen Staaten Mittel- und Osteuropas können von
Reisefreiheit nur träumen. Sie dürfen ihr Land ausschließlich mit einer
speziellen Genehmigung unter teils strengen Auflagen und dann nur in
Richtung der „sozialistischen Bruderstaaten" verlassen.
Tschechoslowaken entdecken ab den 1960er-Jahren vor allem Jugoslawien
als attraktives Reiseziel, Ostdeutsche reisen gerne nach Ungarn an den
Plattensee, und auch die Sowjetunion kann besucht werden. Tourismus
über den „Eisernen Vorhang" hinweg ist - selten gewährte Besuche bei
Verwandten ausgenommen - ausgeschlossen.
In Anspielung an den Film „Das Leben der Anderen", der von der
Stasi-Bespitzelung handelt, können Sie geheim durch du den
Einbauschrank mit Vitrine hindurch in die DDR-Wohnung spähen. Finden
Sie die Hinweise auf die Parteinähe der Familie und ihre gute Führung:
Wimpel der FDJ; VII. Parlament der Freien Deutschen Jugend: Statut der
Freien Deutschen Jugend (Berlin 1963); Jugendmagazin „Neues Leben";
Pioniermagazin „FRÖSI" (FRÖhlich sein und Singen", 1986).

VERTREIBUNG UND AUSSIEDLUNG NACH DEM ZWEITEN WELTKRIEG
Die Geschichte des „Eisernen Vorhangs" ist eng verknüpft mit den
umfassendsten Vertreibungen und Umsiedlungen in der Geschichte Europas.
Während des Zweiten Weltkriegs führt das nationalsozialistische
Deutsche Reich ethnische Säuberungen in Ostmitteleuropa durch, die von
Deportationen bis zur Vernichtung reichen. Nach Kriegsende strömen in
ganz Mitteleuropa Millionen Menschen zurück in ihre Heimat... oder sind
auf der Flucht: Denn nun richtet sich der aufgestaute Hass gegen alle
Deutschen, auch gegen jene, die seit Jahrhunderten in Ostmittel- und
Südosteuropa leben. Getrieben vom Volkszorn werden etwa in der
Tschechoslowakei bis Juli 1945 750.000 Deutsche brutal fortgejagt. Die
Alliierten billigen die Vertreibungen und Aussiedlungen in der
Tschechoslowakei, in Polen, Ungarn, Rumänien und Jugoslawien: 13
Millionen Menschen deutscher Herkunft verlieren ihre Heimat. Gerade im
deutsch-tschechoslowakischen und österreichisch-tschechoslowakischen
Grenzraum entsteht so ein großteils entvölkerter Landstrich, der es
leicht macht, die für den „Eisernen Vorhang" notwendigen Vorrichtungen
wie etwa Sperranlagen und militärische Sperrgebiete zu errichten.
PROPAGANDA
Der „Kalte Krieg" spielt sich auch auf der Ebene der
Informationspolitik ab. Im Osten gilt es zum einen die Bevölkerung
ideologisch zu festigen und hinter der kommunistischen Partei zu
sammeln. Printmedien und Rundfunk werden gleichgeschaltet, die
Informationspolitik von der kommunistischen Partei zentral gesteuert.
Plakate, Flugblätter und Karikaturen zeichnen Bilder eines heißen"
Krieges: Für die Darstellung des Konflikts bedient man sich einer
ideologisch aufgeladenen und stark symbolhaften Sprache, der Gegner
wird verunglimpft. Zum anderen versucht man dies- und jenseits des
„Eisernen Vorhangs", die Bevölkerung der jeweils anderen Seite zu
erreichen und aufzuklären. Weltweit werden staatliche, halboffizielle
und private Rundfunkstationen zur psychologischen Kriegsführung
ausgebaut. Westen wie Osten tragen via Radio Free Europe oder Radio
Moskau den „Kalten Krieg" auch im Äther aus.
ÜBER DEN KLEINEN UND DEN GROSSEN GRENZVERKEHR
Mit den Sperranlagen des „Eisernen Vorhangs" werden viele über
Jahrhunderte gewachsene mitteleuropäische Verkehrswege jäh
unterbrochen. Die kommunistischen Staaten unterbinden auch den „kleinen
Grenzverkehr" - den in der Zwischenkriegszeit durch bilaterale Abkommen
geregelten Übertritt von Bewohnern der Grenzregionen - weitgehend. Auf
den großen Transitrouten hat der „Eiserne Vorhang" weitreichende
Folgen: Für Reisen in oder durch den Ostblock müssen lange Wartezeiten
an den Grenzen in Kauf genommen werden. Die Kontrollen sind rigoros,
die den Reisenden gestellten Auflagen streng. Trotz der Restriktionen
werden aber auch neue Verbindungen eingerichtet: So führt ab 1962 der
Zug „Vindobona" von Wien auf der Strecke der ehemaligen
Franz-Josefs-Bahn über Gmünd durch die Tschechoslowakei und die DDR in
die geteilte deutsche Stadt Berlin.

SPIONAGE: VOM „DRITTEN MANN" ZU JAMES BOND
Um militärische, politische oder wirtschaftliche Informationen über den
Gegner zu erhalten, betreiben beide Blöcke über den „Eisernen Vorhang"
hinweg intensiv Spionage. Inwieweit diese Tätigkeiten dazu beitragen,
dass aus dem „Kalten Krieg" niemals ein heißer wird, ist bis heute
ungeklärt. Die Geheimdienstapparate werden jedenfalls stetig ausgebaut
und technologisch aufgerüstet, Agentennetzwerke aufwendig betrieben.
Der allergrößte Teil ihrer Tätigkeit beruht auf der Sammlung frei
zugänglicher Informationen aus ausländischen Medien sowie auf dem
Abhören „feindlicher" Kommunikation. Spektakuläre Spionagefälle wie
jener rund um den Verrat der Atombombentechnologie an die Sowjetunion
oder Entführungen tschechoslowakischer Flüchtlinge aus Österreich
bleiben hingegen die Ausnahme. Beide Seiten stellen neben dem Ausland
auch die eigene Bevölkerung unter Beobachtung. Wie in allen
sozialistischen Staaten ist in der Tschechoslowakei die Überwachung mit
massiver Repression verbunden. Das neutrale, an der Grenzlinie zwischen
den Blöcken gelegene Österreich erweist sich für Spione aller
Nationalitäten als idealer Ort, um einander zu beobachten oder gar
Informationen auszutauschen.
FLUCHT UND FLÜCHTLINGE
Beim Versuch, den „Eisernen Vorhang" zu überwinden, um dem Regime, der
Überwachung und den Lebensumständen zu entfliehen, riskieren tausende
Bürger von Staaten des Ostblocks ihr Leben. Ob zu Fuß mithilfe von
Schleppern, die Grenzflüsse - vor allem die Donau bei
Bratislava/Pressburg - durchschwimmend oder fliegend mit selbst
gebauten Heißluftballons, Motordrachen und gestohlenen Flugzeugen: Der
Drang nach Freiheit spornt die Flüchtenden zu riskanten
Höchstleistungen an. Beim Grenzübergang Gmünd wird gar ein Lkw als
Rammfahrzeug in den Westen genutzt; und Flüchtlinge aus der DDR
„überschweben" die Grenze nach Österreich entlang einer
Hochspannungsleitung per Guerilla-Rutsche.
Flucht mit Ultraleichtflugzeugen, Mai 1989
Bereits 1975 flieht Ingo Bethke mit einer Luftmatratze, 1983 dann sein
Bruder Holger mittels einer Seilbahnkonstruktion aus der DDR in den
Westen. Im Mai 1989 verhelfen sie schließlich auch ihrem Bruder Egbert
zur Flucht: Mit zwei Ultraleichtflugzeugen fliegen Ingo und Holger
Bethke unter den Radarschirmen von West- nach Ostberlin, setzen in
einem Park kurz auf und holen Egbert in den Westen. Zur Tarnung bemalen
sie die Gleiter mit sowjetischen Hoheitszeichen.

VERFOLGUNG DER KIRCHE IM OSTEN
Die sozialistischen Volksdemokratien fürchten den Einfluss der Kirchen
- vor allem jenen der römisch-katholischen. Gleich nach der
kommunistischen Machtübernahme setzen die Repressionen gegen Opposition
und Kirchenvertreter ein. Auch Bischöfe, Kardinäle und Ordensobere sind
Opfer der Verfolgung, in Schauprozessen führt man die Kirchenmänner
vor. In Ungarn wird bereits Ende 1948 Kardinal József Mindszenty
verhaftet und wenig später zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe
verurteilt. In der Tschechoslowakei kommt es 1948 zur Verhaftung von
etwa 50 Priestern, 1949 wird der Prager Erzbischof Josef Beran
interniert. In Polen verurteilt man Kardinal Stefan Wyszyński 1953 zu
drei Jahren Haft. Allein in der Tschechoslowakei kommen bis 1956
tausende Geistliche, unter ihnen mehr als 400 Priester, in
Gefangenschaft. Ab 1962 besucht der Wiener Erzbischof Kardinal Franz
König im Auftrag des Papstes konsequent die Länder hinter dem „Eisernen
Vorhang". Er gilt heute als einer der Wegbereiter für die Überwindung
der Isolation der Kirche im kommunistischen Machtbereich.
REPRESSION UND WIDERSTAND
Im Zuge eines „kalten Putsches" an der Wahlurne vollzieht die
Tschechoslowakei im Februar 1948 den Wechsel zum Kommunismus. Rasch
erfolgt die Umsetzung eines stalinistischen Herrschaftsapparates, der
keinerlei Opposition duldet. Politische Gegner, Unternehmer,
Grundbesitzer, Vertreter der Kirchen oder Intellektuelle geraten in das
Fadenkreuz des neuen Regimes. Das Innenministerium richtet mit dem
Staatssicherheitsdienst eine allmächtige Geheimpolizei ein, die auch
mit Spitzeln nach mutmaßlichen Regimegegnern fahndet. Wer einmal in die
Fänge der Staatssicherheit gerät, wird nicht selten unter Folter zum
Geständnis gezwungen, in einem Schauprozess abgeurteilt, für lange
Jahren ins Gefängnis gesteckt, zu Zwangsarbeit verurteilt oder gar
hingerichtet. Dennoch kann das Regime den Widerstand nicht vollständig
unterdrücken. Wichtige Träger kritischen Gedankengutes sind neben der
katholischen Kirche auch jugendliche Subkulturen und Künstler; nicht
selten versuchen sie aus dem österreichischen Exil über den „Eisernen
Vorhang" hinweg zu wirken - zum Beispiel mittels „Samisdat"-Literatur.
DIE EROSION DES OSTBLOCKS - WIRTSCHAFTSKRISEN UND HELSINKI-SCHLUSSAKTE
Der Ungarn-Aufstand 1956, insbesondere aber der „Prager Frühling"
zwischen 1964 und 1968 offenbart die internen Probleme des Ostblocks.
Die größten Schwachstellen des Systems bleiben dem Westen dennoch lange
Zeit verborgen: In den 1960er-Jahren kämpft die Sowjetunion vor allem
im Agrarbereich mit einer massiven Wirtschaftskrise, in den folgenden
Jahrzehnten vermag sie das Wettrüsten mit den Westmächten
wirtschaftlich kaum durchzuhalten. Enorme Belastungen für den
Militäretat bringen auch „Stellvertreterkriege" in Zentral- und
Südostasien, Afrika und Südamerika. Zudem gewinnen die
Nationalkonflikte an Sprengkraft. All das mindert das Potenzial, das es
für dringend notwendige interne Reformen des Sowjetsystems brauchte.
Der KSZE-Prozess und die Unterzeichnung der Schlussakte von Helsinki
1975 geben den Bürgerrechtsbewegungen erstmals eine völkerrechtliche
Grundlage dafür, gegen die sozialistischen Regime aufzutreten wenn auch
zunächst ohne großen Erfolg. Erst die Katastrophe von Tschernobyl 1986
und die neue Politik von Glasnost und Perestroika unter Michail
Gorbatschow ab 1985 haben epochale Wirkung. Binnen weniger Jahre
erodiert der Ostblock von innen.

DIE OPFER DES „EISERNEN VORHANGS"
Der tschechoslowakisch-österreichische Abschnitt des „Eisernen
Vorhangs" ist besonders gefährlich: Ein ausgeklügeltes, weit ins
Hinterland gestaffeltes System aus Drahthindernissen, eine Zeit lang
gar mit tödlichem Starkstrom aufgeladenen Zäunen, Minen und Wachtürmen
macht jeden Versuch, diese Grenze unerlaubt zu passieren, zu einem
lebensgefährlichen Unterfangen. Doch auch für die Soldaten der
Grenzbataillone ist der Dienst hier alles andere als einfach. Bei den
meisten bekannten Opfern dieses Abschnitts des „Eisernen Vorhangs"
handelt es sich um junge Soldaten, die in Ausübung ihrer Pflicht, bei
Unfällen oder durch Selbstmord ums Leben kommen. Für Österreicher
stellt der „Eiserne Vorhang" ebenfalls eine Bedrohung dar, insbesondere
weil die Grenze nur allzu leicht aus Versehen überschritten werden
kann. Von Grenzsoldaten aufgegriffene Österreicher verbringen im besten
Fall einige Tage im Gefängnis; im schlimmsten Fall kommt es zum
tödlichen Waffengebrauch.
1989 Schicksalsjahr für Europa - Medienwirksam durchschnitt der
damalige Außenminister Alois Mock im Jahr 1989 den Stacheldraht bei
Klingenbach bzw. bei Laa an der Thaya. Was damals wenige wussten: Mock
verfügte über ein weitgespanntes Netzwerk an (außen-) politischen
Kontakten und hatte einen wesentlichen Anteil an der politischen
Entwicklung Europas. Zugleich war Mock für die Weichenstellung für
Österreichs Weg in die Europäische Union verantwortlich. Erleben Sie
eine spannende Zeitreise!
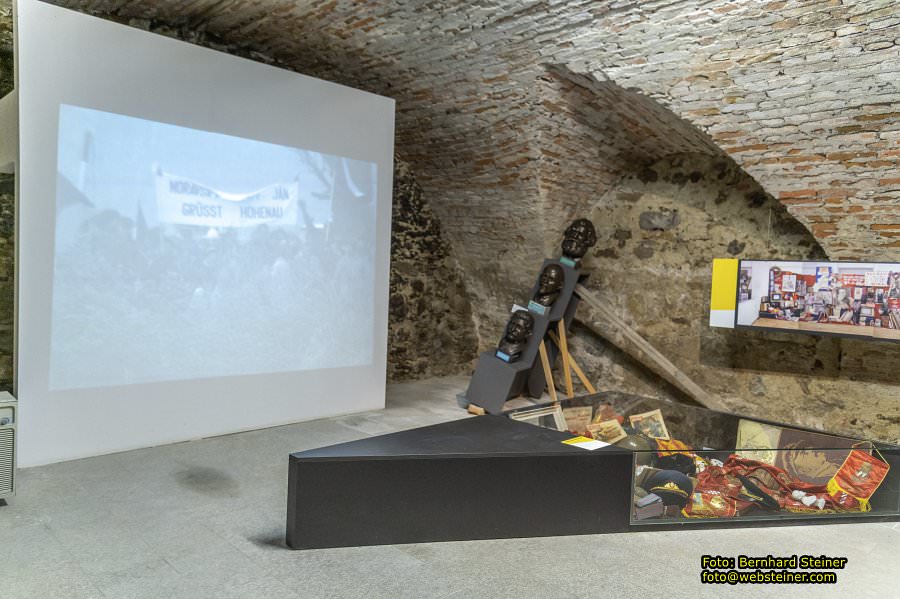
VOLKSAUFSTAND IN DER DDR - 1953
Am 16. Juni 1953 beginnen an zwei Großbaustellen Ostberlins Streiks und Demonstrationen.
Auslöser ist die Anhebung der Arbeitsnorm, bald fordern die Arbeiter
aber nicht weniger als das Ende der Diktatur. Am 17. weiten sich die
Proteste aus, Hunderttausende gehen auf die Straße. Gefängnisse,
Stasi-Einrichtungen und SED-Parteilokale werden gestürmt. In anderen
Städten der DDR kommt es zu ähnlichen Szenen. Die Menschen fordern
freie Wahlen, den Abzug der sowjetischen Truppen und die
Wiedervereinigung Deutschlands.
Das Regime und seine Schutzherren reagieren mit Gewalt. In Berlin
stellen 15.000 Mann der Volkspolizei und 20.000 Sowjetsoldaten mit
schwerem Gerät die „Ordnung" wieder her. Bis zum Abend ist der
Widerstand in der gesamten DDR erstickt. 50 bis 125 DDR-Bürger sind
tot, bis zu 13.000 werden verhaftet. Nach dem Volksaufstand baut die
SED ihren Repressionsapparat weiter aus. Dennoch formiert sich eine
Widerstandsbewegung, die von Intellektuellen, Künstlern und den Kirchen
getragen wird.
UNGARN ERHEBT SICH - 1956
Im Oktober 1956 gerät die KP-Diktatur in Budapest ins Wanken. Bei
Massendemonstrationen werden freie Wahlen und ein Ende der Repression
gefordert. Regimetreue Kräfte schießen in die Menge. Im ganzen Land
beginnen nun Streiks und Demonstrationen. Die KP-Führung ist gezwungen,
den Reformkommunisten Imre Nagy zum Ministerpräsidenten auszurufen. Am
30. Oktober gibt die kommunistische Partei ihren Führungsanspruch auf.
Nagy bildet eine Regierung mit Ministern aus mehreren Parteien. Ungarn
tritt aus dem Warschauer Pakt aus und verlangt den Abzug der
sowjetischen Truppen. Moskau reagiert mit Härte und verlegt zusätzliche
Kräfte nach Ungarn. Bis Mitte November kämpfen die russischen Verbände
die hoffnungslos unterlegenen ungarischen Freiwilligen nieder. Mehr als
2.500 Ungarn und zumindest 700 sowjetische Soldaten fallen, 200.000
Menschen flüchten, der Großteil nach Österreich. Dem Sieg der
Sowjetmacht folgen Massenverhaftungen und rund 350 Hinrichtungen.
DAS ENDE DER ILLUSION - TSCHECHOSLOWAKEI 1968
Anfang 1968 gelangt in Prag mit Alexander Dubček ein Reformer an die
KP-Spitze. Er möchte der allgemeinen Unzufriedenheit über die
Einparteienherrschaft durch ein „Aktionsprogramm" begegnen. Zwar soll
der Führungsanspruch der Partei nicht angetastet werden, der
Sozialismus aber durch Liberalisierung und marktwirtschaftliche Ansätze
ein „menschliches Gesicht" erhalten. Die Zensur wird aufgehoben,
Meinungs-, Presse- und Versammlungsfreiheit werden zugelassen. In der
ČSSR herrscht Aufbruchsstimmung. Die dortigen Reformen könnten Vorbild
für ähnliche Bestrebungen in der eigenen Bevölkerung werden. Moskau
entscheidet schließlich, das Experiment zu beenden. In der Nacht von
20. auf 21. August marschieren Truppen des Warschauer Pakts in die ČSSR
ein. Nach einigen Tagen stehen mehr als 750.000 Soldaten im Land. Die
Bevölkerung leistet gewaltlosen Widerstand, der bis Anfang September
zumindest 70 Demonstranten das Leben kostet. Dubček und seine
Mitstreiter werden gezwungen, die Reformen zurückzunehmen. Dann
verschwinden sie von der politischen Bühne. Die KP-Führer der
„Bruderstaaten" beobachten den „Prager Frühling" mit wachsendem
Misstrauen.
EINE UNABHÄNGIGE GEWERKSCHAFT ENTSTEHT - POLEN 1980/81
In Polen reicht die Tradition des Widerstandes gegen die KP-Diktatur
bis in die 1950er-Jahre zurück. Seine wichtigsten Stützen sind die
Katholische Kirche, hinter der weite Teile der Bevölkerung stehen, und
die Arbeiterschaft. Im Sommer 1980 löst die Erhöhung von
Lebensmittelpreisen landesweit Streiks aus. Als auf der Leninwerft in
Danzig ein legendärer Streikführer von 1970 entlassen wird, beginnt
auch dort ein Arbeitskampf. Das Streikkomitee unter dem charismatischen
Lech Walesa legt eine Liste mit 21 Forderungen vor. Von Lohnerhöhungen
über die Aufhebung der Zensur bis zur Zulassung freier Gewerkschaften.
Im ganzen Land wandelt sich die Streikwelle zu einer Volksbewegung mit
politischen Zielen. Das Regime weicht zurück und schon im September
wird die unabhängige Gewerkschaft, „Solidarnošč" offiziell gegründet.
Ein Jahr später zählt sie rund zehn Millionen Mitglieder und stellt das
Machtmonopol der KP in Frage. Die Sowjetunion setzt diesmal ihre Panzer
nicht in Marsch, sondern findet eine indirekte Lösung. An die Spitze
der Regierung tritt mit General Jaruzelski ein linientreuer Kommunist.
Im Dezember 1981 verhängt er das Kriegsrecht über Polen. „Solidarnošč"
wird verboten, etwa 10.000 Gewerkschafter und Oppositionelle werden
verhaftet, die Proteste mit harter Hand niedergeschlagen.
DIE ÖFFNUNG DES EISERNEN VORHANGS"
Ab 1985 wirkt der neue Vorsitzende der KPDSU, Michail Gorbatschow,
entscheidend als Wegbereiter für Reformen im Ostblock. Mit seiner
Politik der Transparenz (Glasnost) und Umgestaltung (Perestroika)
leitet er eine neue Ära in der Sowjetunion ein. Im Januar 1987
kritisiert er die Fehler der KPdSU und fordert eine demokratische
Umgestaltung von Partei und Gesellschaft. Als entscheidend für die
Auflösung des Ostblocks erweist sich die Aufhebung der
„Breschnew-Doktrin": Gorbatschow sichert den Staaten außerhalb der
UdSSR zu, ihre Eigenständigkeit zu achten und keinesfalls militärisch
einzugreifen. Damit öffnet er den Weg zur Demokratisierung. Während
Polen und Ungarn politische Reformen durchführen, hält die SED in der
DDR an ihrem starren Kurs fest. Jeder Fortschritt in den
„Bruderstaaten" wird jedoch von den DDR-Bürgern registriert.
Ferienreisen in die Reformländer verstärken ihren Wunsch nach
Veränderung. Als im Frühjahr 1989 Ungarn den „Eisernen Vorhang" zu
Österreich durchschneidet, beginnt ein Exodus von DDR-Bürgern über
Österreich nach Westdeutschland. In den Ostblockstaaten entwickeln die
Ereignisse rasch eine Eigendynamik: Nach und nach weichen die
kommunistischen Regime dem Wunsch der Bürger nach Demokratisierung.
Ende 1989 ist die in Jalta 1945 beschlossene europäische Ordnung
Geschichte.
DAS ENDE DES „VORHANGS"
Am 29. November 1989 verliert die Kommunistische Partei der
Tschechoslowakei auch formal die Macht. Ihre führende Rolle wird aus
der Verfassung gestrichen. Sechs Tage später - noch laufen die
Verhandlungen zur Bildung einer Übergangsregierung - beginnt der Abbau
der Sperranlagen an der Grenze zu Österreich, ab 11. Dezember auch an
der tschechoslowakisch-westdeutschen Grenze. Zum ersten Mal seit der
Niederschlagung des „Prager Frühlings" können Tschechen und Slowaken
wieder unbehelligt in den „Westen" zu reisen. Keine mühsamen
Behördenwege mehr, kein Warten auf Reisegenehmigungen, die dem
Normalbürger ohnehin kaum gewährt wurden. Und keine Schikanen mehr bei
der Rückkehr!

DIE ROLLE ÖSTERREICHS BEI DER ÖFFNUNG DES „EISERNEN VORHANGS"
Spätestens von den 1960er-Jahren an versteht sich Österreich als
Brückenbauer zwischen Ost und West: Hier haben internationale
Organisationen ihren Sitz, finden Konferenzen oder Gipfeltreffen
zwischen den USA und der Sowjetunion statt. Dank seiner Neutralität
kann Österreich auf kultureller Ebene beharrlich kleine Breschen in den
„Eisernen Vorhang" zu seinen Nachbarn schlagen und die
Bürgerrechtsbewegungen im Osten auf vielen Kanälen unterstützen. Das
findet 1989 - personifiziert durch den damaligen Außenminister Alois
Mock - seinen Höhepunkt: Er schlägt seinem ungarischen Amtskollegen
Gyula Horn die Durchtrennung des „Eisernen Vorhangs" als Zeichen der
Öffnung zwischen den beiden Ländern vor. Das Bild geht um die Welt,
fördert den Zusammenbruch des Ostblocks und wird zu einer Ikone der
Befreiung der Ostblockstaaten. Den nach Freiheit strebenden Bürgern der
sozialistischen Staaten signalisiert es, dass ein Korridor in den
Westen existiert: Das offizielle Österreich gewährt tausenden
DDR-Bürgern unbürokratisch die freie Durchreise nach Westdeutschland.
DIE BILANZ DES KOMMUNISMUS
Kommunistische Regime sind im 20. Jahrhundert für die Massenvernichtung
von Menschen in einer bis dahin nicht erreichten Dimension
verantwortlich. Historiker und Demozidforscher (als Demozid wird die
vorsätzliche Massentötung bestimmter Menschengruppen durch eine
Regierung bezeichnet) wie Becker, Courtois, Heinsohn und Rummel haben
zu den Verbrechen des Marxismus-Leninismus folgende Übersicht zur Zahl
der Todesopfer vorgelegt:
Sowjetunion (die niedrigere Zahl berücksichtigt „Tod durch Arbeit" in Lagern nicht): 35,0-61,9
Rotchina inki. Maoisten vor der Machtübernahme: 58,0
Rote Khmer in Kambodscha: 1,8 - 2,0
Nordkorea: 1,6-2,0
Tito-Jugoslawien: 1,07
Osteuropa: 1,0 Millionen Todesopfer
Büsten von Marx, Lenin und Stalin
Der Personenkult spielt in den kommunistischen Diktaturen eine
wesentliche Rolle. Karl Marx, ideologischer Vater des Kommunismus, der
Revolutionär und Gründer der Sowjetunion W. I. Lenin und sein
Nachfolger Josef Stalin werden wie Ikonen verehrt. Allerorts findet man
Büsten und Denkmäler mit ihren Konterfeis.
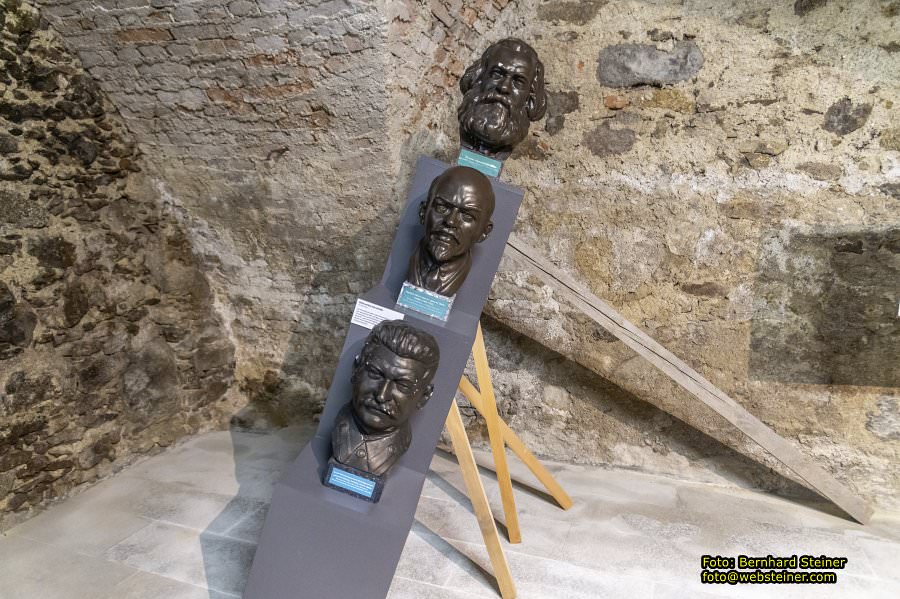
Erlebniswelt Bier - Die alten Mauern der Kuenringerburg Weitra sind
Kulisse dieser spannenden Erlebniswelt auf Schloss Weitra. In der neu
gestalteten Erlebniswelt Bier lernen die Besucher die unterschiedlichen
Brauprozesse einst und jetzt, bis hin zu den heutigen Biersorten,
kennen. Erfahren Sie mehr über Glaskultur und wie Bier heute auch zum
Kochen benutzt wird. Reste der 700-Jahre alten Mauer der Kuenringerburg
Weitra bilden die Kulisse zu dieser spannenden Ausstellung!
1321 Mai 26, Wien
Wir Friderich von gotes gnaden romischer chunich allezit ein merer des
riches veriehen und tun kunt mit disem brief [..] ze furderûng und
pezzerûng der stat dise recht und freyung ge-ben. Des ersten, daz die
lantstrazze, die uncz her aûzzen fûr die stat ze Weitra ist gangen, daz
die hinnenfûr ewichlichen gen sol durch dy stat. Ez sol auch chein
burger von Weitra an der chalten maûtte ze Newenbruch margthalben niht
mer geben dann zwen pfennig. Ez sol auch chain gastgeb sein bei der
stat nêhener dann in ainer meil. Ez sol auch nieman chain pyer prewen
in ainer meil bei der stat.
(Auszug aus dem Privileg von König Friedrich dem Schönen, verliehen an die Stadt Weitra)
König Friedrich der Schöne erteilte den Bürgern zu Weitra einen
Freibrief. Die bisher an der Stadt außen vorüberführende Landesstraße
soll nun durch die Stadt gehen, die Mautpflicht in Korneuburg beträgt
für einen Bürger von Weitra bloß zwei Pfennige; in der Bannmeile der
Stadt soll kein Gastgeber schenken und kein Bräuer Bier brauen, in der
Stadt selbst kein Herr schenken, er sei denn Bürger der Stadt; seine
Schuldner, edel oder unedel, mag ein Bürger von Weitra beim Betreten
der Stadt um seine Schuld anhalten. Wegen eines Wandels soll man keinen
zahlungsfähigen und wegen Unzucht keinen ehrbaren Mann oder Bürger
gefangen setzen. Die Bürger von Weitra sollen die Brücke über den
Tiefenbach in Stand halten.
Um 1645 gab es in Weitra 33 bürgerliche Brauhäuser, ein städtisches und
ein herrschaftliches Hofbräuhaus. Die Braugerechtigkeit jedes Hauses
war „radiziert". Das heißt, das Recht Bier zu brauen, war nicht an
einen einzelnen Bürger oder an eine Familie gebunden, sondern an das
jeweilige Haus. Wurde das Haus weitervererbt oder gelangte in den
Besitz einer anderen Familie, so blieb das Braurecht bestehen. Der
„Bierpfad" führt Sie zu den ehemaligen Bürgerhäusern mit
Braugerechtigkeit und erinnert an Weitras langjährige Brautradition.
Weiße Tafeln mit grüner Schrift an den Häusern weisen auf das Braurecht
und die Ratifizierung hin.

WASSER HAT DEN GRÖSSTEN MENGENANTEIL IM BIER
Bier besteht zu ca. 90% aus Wasser
Für die Herstellung von 1 Liter Bier liegt der aktuelle Verbrauch einer
modernen Brauerei bei ungefähr 3-4 Liter (früher sogar bei 6-8 Liter)
Die Qualität des Wassers hat verschiedene Biertypen geprägt
Restalkalität: Je nach Zusammensetzung der Mineralien im Boden, kann
das Wasser die saure Reaktion des Malzes verringern oder verstärken.
Salzgehalt: Jeder Bierstil stellt andere Anforderungen an den
Salzgehalt im Brauwasser. Dieser wirkt sich auf den Charakter eines
Bieres aus, z.B. Helles Pilsener oder Dunkles Münchner
Der Braumeister stellt an das Brauwasser höhere Ansprüche als an Trinkwasser
Man benötigt es auch zum Heizen, Kühlen und Reinigen
DAS GERSTENMALZ IST DER KÖRPER DES BIERES
Es gibt mehr als 40 verschiedene Malzsorten
Für 1 hl Bier benötigt man ca. 17 kg Malz, welches aus ca. 21 kg Gerste gewonnen wird
Gerste hat sich aufgrund ihrer Spelze beim Bierbrauen gegen andere Getreidearten durchgesetzt
Sommergerste: Vegetationszeit 150 Tage; Ertrag: 4 t/ha
Wintergerste: Vegetationszeit 300 Tage; Ertrag: 6 t/ha
Eine zweizeilige Gerste hat ca. 26 Körner pro Halm
Für 1 hl Bier benötigt man eine Anbaufläche von 40 m²
DIE HEFE IST DER GEIST DES BIERES
Hefe besteht zu 75% aus Wasser
Biere mit untergärigen Hefen sind z.B. Märzen, Pils, Lager und Zwickel
Biere mit obergärigen Hefen sind z.B. Weißbier, Kölsch und Ale
Hefe ist sehr gesund: Vitamin B1, B2, B3, B5, B7, B9
DER HOPFEN IST DIE SEELE DES BIERES
Das Würzmittel des Braumeisters, verantwortlich für die Bierbittere
Hopfen macht das Bier bekömmlicher
Hopfen ist gesund! Er ist daher auch in der Medizin von Bedeutung!
Man unterscheidet zwischen Aroma-, Bitterstoff-, und Flavourhopfen
Wird in Österreich industriell im Mühlviertel und in der Südsteiermark angebaut
Hopfen ist sehr pflegeintensiv: „Der Hopfen will jeden Tag seinen Herrn sehen"
Eine Hopfenpflanze wird im Durchschnitt ca. 15 Jahre alt
Nur die weibliche Pflanze bildet Dolden, die jene für das Bierbrauen wichtigen Inhaltsstoffe enthält

Bierwitz
Ein Russe, ein Franzose und ein Deutscher sind in der Wüste. Sie sind
unglaublich durstig, die Sonne brennt unbarmherzig heiß. Da kommen sie
zu einem leeren Pool, neben dem eine Fee steht, die jedem der drei
Männer einen Wunsch gewährt.
Der Russe sagt: „Ich hätte den Pool gerne voll mit Wodka!" „So sei es",
sagt die Fee. Der Pool ist voll mit Wodka, der Russe nimmt Anlauf und
macht einen Kopfsprung hinein.
Der Franzose sagt: „Ich hätte gerne, dass der Pool mit Rotwein voll
ist!" So sei es", antwortet die Fee. Der Franzose nimmt Anlauf, köpfelt
in den Pool und quietscht ganz vergnügt.
Dann ist der Deutsche mit seinem Wunsch an der Reihe: „Ich möchte, dass
der Pool mit Pils voll ist!" „So sei es", sagt darauf die Fee. Der
Deutsche springt in den Pool. Ein lautes Aufklatschen, ein Aufschrei,
der Deutsche liegt am Boden des leeren Pools. Warum?" grantelt der
Deutsche die Fee an.
Die Fee lächelt ihn an: Aber gerade du als Deutscher müsstest doch wissen, dass ein gepflegtes Pils sieben Minuten dauert."
Schrotmühle

Einst trennte eine beinahe unüberwindbare Grenzbefestigung die Menschen
aus mehr als 40 Ländern. Die Liebe zum Bierbrauen und Biertrinken blieb
jedoch als verbindendes Element erhalten. Auch in Tschechien wird
bereits seit dem Mittelalter Bier gebraut. So erhielt etwa die Stadt
Pilsen im Jahr 1307 das Braurecht. Das Pilsener Urquell gilt zudem als
Ahnvater der Biere nach Pilsener Brauart (= untergäriges Lagerbier mit
starkem Hopfenaroma und relativ geringem Alkoholgehalt von 4,4 Vol.%).
1842 gelang es in der westböhmischen Stadt (damals Teil der
Habsburgermonarchie) erstmals auf diese Art Bier zu brauen. Eine
weitere Weltmarke wurde mit dem Budweiser Budvar geschaffen. Dieses
fruchtige Bier aus der Stadt České Budějovice (Budweis) wird bereits
seit 1895 mit dem Wasser eines unterirdischen Sees gebraut. Nicht zu
verwechseln ist dieses jedoch mit dem amerikanischen „Budweiser" - der
Namensstreit über das „Original" dauert nun schon rund 100 Jahre. Das
tschechische Budvar wird in den USA als „Crystal" verkauft. Aufgrund
der Nachbarschaft der beiden Länder haben sich viele umgangssprachliche
Wörter entwickelt, die eine sprachliche Verwandtschaft erkennen lassen.

DER ALKA-VERSCHLUSS ersetzte die ursprünglich verwendeten Korken als
Flaschenverschluss. Er wurde schlussendlich durch den Kronkorken, der
eine wesentlich höhere Dichtheit garantiert, ersetzt. Außerdem ist der
Kronenkorken in der Bierproduktion einfacher zu handhaben. Apropos:
warum hat der gemeine Kronkorken 21 Zähne? Kronkorken mit ungerader
Anzahl von Zacken verkanten nicht so schnell in den Zuführungsbahnen
der Abfüllanlagen.

DER STAMMTISCH - Vor allem in ländlichen Regionen und kleinen Gemeinden
war die Zugehörigkeit zum Stammtisch an einen höheren Sozialstatus
gebunden. So setzte sich ein Dorfstammtisch bis weit in die zweite
Hälfte des 20. Jahrhunderts vor allem aus örtlichen Honoratioren wie
dem Bürgermeister, Arzt, Apotheker, Lehrer, Förster oder wohlhabenden
Bauern zusammen. Die Einladung an einen Ortsfremden, am Stammtisch
Platz zu nehmen, galt als nicht selbstverständliche Wertschätzung.

Das Weizenbierglas ist ein
ziemlich schmales, hohes Glas. Es wird ganz speziell für Weizenbier
hergestellt und hat diese Form, damit die Perlen der Kohlensäure so
mehr Zeit benötigen, um durch das Bier nach oben zu steigen. So bleibt
das Bier im Weizenbierglas länger frisch und spritzig. Vor dem Benutzen
sollte man das Glas mit kaltem Wasser ausspülen. Dadurch kann man die
sehr starke, für diese Biersorte typische, Schaumentwicklung unter
Kontrolle halten.
Aus der Flasche ins Glas: Halte das Glas schräg - etwa 45 Grad - und
gieße die Flasche fast vollständig leer. Lass etwa 10-15% des
Gesamtinhaltes in der Flasche. Gieße ruhig, denn Weizenbier schäumt
viel mehr als z.B. ein Lagerbier. Danach schwenke die Flasche einige
Male und gieße das Glas voll. Durch Verwirbelung lockerst Du das letzte
Stück Hefe in der Flasche auf.
Geboren in der Nachkriegszeit aus Rationalisierungsgründen: Man
benötigte einen einfach zu produzierenden Glas-Typ. Eine Anekdote
besagt, dass 1954 Willy Steinmeier, ein Mitarbeiter der Ruhrglas GmbH
in Essen der Namensgeber ist. Der Willibecher
ist das Universal-Genie. Nur die wenigsten Menschen haben für jede
Biersorte das richtige Glas zuhause - deshalb gibt es den Willibecher.
Er ist dünnwandig und kühlt daher rasch aus. Es gibt ihn als 0,2 l,
0,25 l, 0,3 l, 0,4 l und 0,5 l.
PILS-TULPE: Das „Pils" lebt von
der feinen Hopfung - es benötigt daher ein feineres Glas so ist diese
Glasform dem Biertyp besonders angepasst. Das heißt: der obere,
kleinere Glasdurchmesser unterstützt einerseits die Haltbarkeit des
feinporigen Schaumes, andererseits verstärkt er den Hopfengeruch an der
Nase des Biergenießers.
Dies sind die größten, dicksten und mächtigsten Vertreter der Biergläser. Am bekanntesten vom Oktoberfest in München. Ein Maßkrug
wiegt leer schon über ein Kilo, das Servieren ist bestimmt kein
Kinderspiel. Das Glas ist so dick, um einerseits die große Menge an
Bier kühl zu halten, andererseits ist die Glasstärke von zusätzlichem
Vorteil, falls doch einmal zu heftig angestoßen wird. Die Biere, die
aus diesem Glas am besten schmecken, sind deutsches Lager, belgisches
Witbier und natürlich speziell gebraute Oktoberfestbiere.
Im englischsprachigen Raum ist das Pintglas die meist verbreitete
Glasform. Es wird bis zum Rand gefüllt und der Schaum anschließend
abgestrichen - erst dann ist das PINT
erreicht. Die Pint Gläser orientieren sich an Maßstäben aus eher
vergangenen Zeiten, denn so ein Pint Glas besitzt eine Füllmenge von
circa 568 Milliliter.

Weitra ist die älteste Braustadt Österreichs und das Bier ist bis heute
ein wichtiger kulinarischer Bestandteil unserer Region. Zum
700-jährigen Jubiläum wurde das bestehende Braumuseum in die neue
Erlebniswelt Bier umgestaltet – hier finden Sie heraus, was Sie schon
immer über Bier wissen wollten.

INTERNATIONALE KOCHKUNST-UND FACHAUSSTELLUNG FÜR DAS GASTWIRTSGEWERBE
UNTER DEM ALLERHÖCHSTEN PROTEKTORATE S.M.DES KÖNIGS FRIEDRICH AUGUST
VON SACHSEN
LEIPZIG 1905
Der FÜRSTLICH FÜRSTENBERGISCHEN BRAUEREI DONALESCHINGEN
wird in Anerkennung vorzüglicher Leistungen vom Preisrichter-Kollegium die
GOLDENE MEDAILLE
zuerkannt und erfolgt hierüber die Ausfertigung dieses Diplomes.
LEIPZIG, den 26. März 1905.


Das Renaissanceschloß
Nach der Übernahme der Herrschaft Weitra durch Wolf Rumpf von Wielroß
sollte auch der Herrschaftssitz eine Umgestaltung erfahren. Mit den
Bauarbeiten wurde 1584 unter dem kaiserlichen Baumeister Pietro
Ferrabosco an den Wirtschaftsgebäuden begonnen. Die Durchführung des
eigentlichen Schloßneubaues (ab 1590) auf Grund eines Planes von
Ferrabosco dürfte unter Meister Anton, dem Erbauer des Linzer
Schlosses, Meister Jakob und Meister Andreas erfolgt sein. Die Planung
der Schloßanlage war zunächst von dem Bemühen bestimmt, möglichst viel
Mauerwerk der Kuenringerburg mitzuver-wenden. Da aber die durch den
Verlauf des Burgfelsens bestimmte unregelmäßige mittelalterliche Anlage
dem Streben der Renaissance nach Geradlinigkeit und Symmetrie
widersprach, entschloß man sich schließlich für eine großzügigere
Lösung. Das Renaissanceschloß hat die annähernd gleiche West -
Ostausdehnung wie der mittelalterliche Vorgängerbau, es ist jedoch
doppelt so breit, da in Richtung Süden der Burgfelsen überbaut wurde.
Daher hat auch der Nordtrakt des Schlosses nur drei Geschosse, der
Südtrakt hingegen fünf.
Um einen zentral gelegenen rechteckigen Hof mit je fünf Arkaden in
jedem Stockwerk an den Schmalseiten gruppiert sich im Osten und Westen
je ein breiter Trakt, während die länglichen Nord- und Südflügel
relativ schmal sind. Die Mitte des Nordflügels erhielt durch einen
hohen Turm einen starken vertikalen Akzent. Wolf Rumpf starb bereits
1605 kurz vor der Vollendung des Schloßbaues. Seine Witwe Maria d'Arco
(Arch) heiratete 1606 den Grafen Friedrich V. zu Fürstenberg
Heiligenberg, dem sie 1607 die Herrschaft Weitras schenkte. Seitdem ist
das Schloß im Besitz der Familie Fürstenberg.
1747 und 1757 richteten Brände beträchtliche Schäden am Schloß an: Der
hohe Turmhelm verbrannte, Dach und Obergeschoß des Schlosses wurden
zerstört. Der Turm wurde nicht wieder in seiner ursprünglichen Form
hergestellt; er erhielt einen geraden, mit einer Steinbalustrade
versehenen Abschluß. Um den gesamten Baukomplex nicht allzu
kastenförmig erscheinen zu lassen, gliederte man die Schmalseiten des
Schlosses durch je vier barocke Volutengiebel. Die Schloßkapelle
verlegte man vom 2. Stockwerk in das Erdgeschoß des Nordtraktes und
versah sie mit einem kleinen barocken Choranbau. Schon im 18.
Jahrhundert befand sich im Südwesten des ersten Stockes ein Theater. Es
wurde 1885 unter Eduard Egon Landgraf zu Fürstenberg nach den Plänen
von A. Führer aus Wien erweitert und historisierend im Rokokostil
umgebaut.

Wem der viele Text zu lange war und lieber Bewegtbilder mit Musik mag,
kann sich gerne dieses Video antun: