web steiner
Webdesign, Pressefotografie, EDV-Dienstleistungen
Theodor Kery WP 2/3, A-2491 Neufeld/L.
+43/2624/54014 - office@websteiner.com
Wieselburg
an der Erlauf, Juni 2023
Wieselburg im Bezirk Scheibbs liegt im Mostviertel in
Niederösterreich. Die Stadtgemeinde liegt am Zusammenfluss der Kleinen
und der Großen Erlauf. Die katholische Pfarrkirche Wieselburg hl.
Ulrich entstand um 993. Historische Bedeutung hat vor allem das
Wieselburger Oktogon, eines der bedeutendsten Bauwerke der Babenberger
Zeit.
Am 20. Oktober 1877 fuhr der erste Zug mit einer Geschwindigkeit von 12
Stundenkilometern durch das Erlauftal. Die Bahnhöfe waren
blumengeschmückt und an den Stationen drängten sich die Menschen, um
das dampfende Ungeheuer näher betrachten zu können – die erste Fahrt
der Bahn gestaltete sich zu einem Volksfest, denn die Menschen hatten
bis dahin noch nie einen Zug gesehen. Man befürchtete, dass es durch
diese technische Neuerung zu zahlreichen Unfällen kommen könne, dass
etwa durch die rasante Fahrt ein enormer Luftdruck aufgebaut würde, der
die menschliche Lunge zum Platzen bringe.

Das Wieselburger Marktschloss
entstand im 13. Jahrhundert. Seine spätbarocke Erscheinungsform im
josephinischen Plattenstil geht auf einen Umbau Anfang des 19.
Jahrhunderts zurück. Im Jahr 1241 gelangte das Gebiet nördlich des
Erlaufzwiesels über ein Tauschgeschäft in den Besitz des Bistums
Passau. Im Laufe des 13. Jahrhunderts entstand dort am linken
Erlaufufer die Siedlung Wieselburg, um einen Platz herum, der planmäßig
angelegt wurde. In dieser Zeit wurde – unabhängig von den älteren
Befestigungen am Kirchenberg – das Talschloss errichtet. Die Adeligen
versuchten damals schon, in Wieselburg Fuß zu fassen, wurden aber
zunächst noch mit Hilfe des österreichischen Landesfürsten abgewehrt.
Spätestens im 15. Jahrhundert gingen das Schloss und damit auch die
Gebietsherrschaft in weltliche Hände über. Aus dem 16. Jahrhundert gibt
es Überlieferungen von Gerichtstagen im Schloss.
Das Museum für Ur- und Frühgeschichte wurde 1994 eröffnet. Anhand der
Präsentation archäologischer Funde aus der Region Wieselburg werden die
historischen Spuren von der Jungsteinzeit bis ins Mittelalter
dokumentiert. Der Kern der Ausstellung ist die Sammlung des
Heimatforschers Stefan Denk (1898-1958), der sich als erster mit der
Ur- und Frühgeschichte des Erlauftales auseinandersetzte und im Jahr
1952 seine Sammlung der Stadtgemeinde Wieselburg übergab.

Das Marktschloss - Die
Grundsubstanz des Marktschlosses stammt aus dem 13. Jahrhundert. Im
Laufe der Zeit wechselten mehrmals die adeligen Besitzer. 1790 wurde
das Marktschloss im josefinischen Plattenstil umgestaltet. Aus dieser
Zeit stammt auch der Mittelrisalit. Im Jahr 1823 erwarb Kaiser Franz I.
das Schloss. Seit 1976 befindet es sich im Besitz der Stadtgemeinde
Wieselburg, die es 1994 renovierte und revitalisierte. Seit 1983 ist in
einem Seitenflügel die Schlosskapelle der evangelischen Gemeinde
untergebracht.
Heute ist das Marktschloss ein multifunktionales Gebäude und ein
beliebter Treffpunkt. Es beherbergt neben Wohnungen auch das Museum für
Ur- und Frühgeschichte, die Kapelle der Evangelischen Gemeinde, ein
Café mit Bäckerei und einen Bio-Laden.
Die im Jahre 1951 am Seitentrakt des Schlosses in Sgrafitto-Technik
angebrachte und vom Eingangsbereich des Schlossparkes aus wahrnehmbare Sonnenuhr
wurde 1990 entfernt. 2020 kam es dann zu einer Nachbildung
(„Blau-Pause“) unter Mitnahme von Thema und Motiv an alter Stelle. Über
dem Stundenband dieser Wandmalerei sieht man den hl. Georg auf einem
Pferd, wie er erfolgreich einen Drachen bekämpft. Das Datum 8. Mai
(rot) unter dem Drachenflügel soll an die Erhebung Wieselburgs zur
Stadt erinnern.
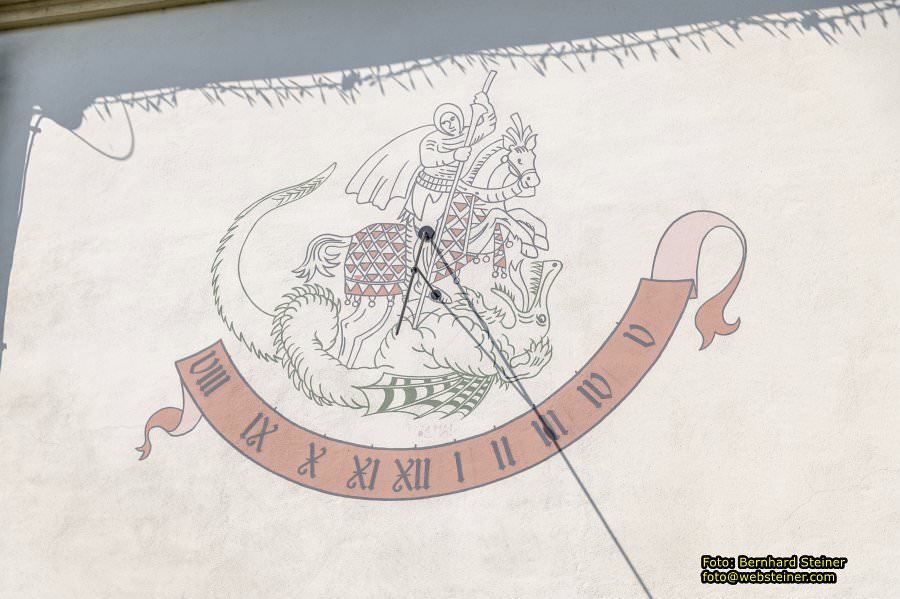
Die Flussmädchen sind
personifizierte Darstellungen von Hauptflüssen der Monarchie. Sie
stammen vom Danubiusbrunnen am Albertinaplatz in Wien und wurden von
Bildhauer Johann Meixner (1819-1872) geschaffen. 1950 schenkte die
Stadt Wien der Gemeinde Wieselburg sechs von insgesamt zehn
Flussmädchen, nachdem der Danubius-Brunnen im Krieg beschädigt worden
war. Fünf Skulpturen wurden im Schlosspark aufgestellt. Die „March" ist
verschollen. 1986 wurden die Originale an die Stadt Wien zurückgegeben.
Wieselburg erhielt dafür Kunststeinabgüsse der Figuren.



Am Eingang zum Schlosspark stehen Statuen, die Hauptflüsse der
Kronländer der Monarchie symbolisieren: Enns, Mur, Raab, Salzach und
Traun darstellen. Sie sind originalgetreue Nachbildungen von fünf der
insgesamt zehn Mädchen-Skulpturen des Albrechtsbrunnens bei der
Albertina in der Wiener Innenstadt. Von 1951 bis 1986 befanden sich
aufgrund einer Schenkung der Stadt Wien die Original-Skulpturen aus
Carrara-Marmor in Wieselburg.
Der Albrechtsbrunnen bei der Wiener Albertina wurde im Jahr 1869
enthüllt. Die Brunnen-Skulpturen wurden von Bildhauer Johann Georg
Meixner (1819–1872) geschaffen. In der Mitte sind Vindobona und
Danubius – die Stadt Wien und der Fluss Donau – als temperamentvolles
Paar dargestellt. Sie werden flankiert von zwei größeren
Mädchen-Skulpturen, welche die Flüsse Save und Theiß darstellen. Zu
beiden Seiten befanden sich damals je vier kleinere Skulpturen, die
Personifikationen der Flüsse Inn, Drau, Mur, Salzach, March, Raab, Enns
und Traun sind. Heute sind nur mehr jeweils drei der kleineren
Skulpturen zu beiden Seiten des Brunnens zu sehen. Die restlichen zwei
Skulpturen befinden sich nahe der Albertina beim Palmenhaus. Der
Brunnen symbolisierte aufgrund der Darstellung der vielen Flüsse die
mächtige Ausdehnung der Donaumonarchie.


Der Wehrmann in Eisen - Am 16.
Jänner 1916 wurde die hölzerne Skulptur des Wehrmannes in einem
Jugendstil-Pavillon neben dem Marktschloss aufgestellt. Für 20 Heller
konnte man einen Nagel in den Wehrmann einschlagen lassen. Ein Großteil
des Erlöses kam Kriegs-Witwen und -Waisen zugute. Der Wehrmann wurde
von einem Bewachungssoldaten des Kriegsgefangenenlagers Wieselburg
geschaffen. Die Statue ist heute ein Mahnmal. Sie soll davor warnen,
dass die Menschen sich erneut für einen Krieg begeistern lassen.
Der Wehrmann mit Mantel und Gewehr steht vor dem Wieselburger
Marktschloss. Mit großem Pomp wurde die hölzerne Soldatenskulptur am
16. Jänner 1916, mitten im Ersten Weltkrieg, vor dem Marktschloss
feierlich enthüllt. Der Wehrmann wurde erst in Ton hergestellt und auf
einem Podest vor dem Schloss aufgestellt. Sein hölzernes Abbild wurde
zur Benagelung in einem schönen Jugendstil-Pavillon am Eingang zum
Schlosspark platziert. Gegen eine Spende konnten die Einwohner Nägel in
den Wehrmann einschlagen lassen. Ein Nagel kostete 20 Heller, was einem
heutigen Gegenwert von etwa 20 Cent entspricht. Der Preis war so
niedrig, dass sich jeder beteiligen konnte. Die Menschen drängten sich
um den offenen Pavillon, in dem die Soldatenskulptur stand, auch in den
folgenden Tagen ließ die Begeisterung nicht los. So kamen in kurzer
Zeit 30.400 Kronen – heute wären das etwa 60.800 Euro – zusammen. Einen
großen Teil des Wehrmannfonds erhielten nach dem Krieg Witwen und
Waisen von gefallenen Soldaten. Der Wehrmann in Eisen steht heute noch
als Mahnmal vor dem Schloss. Er soll davor warnen, dass die Menschen
sich erneut für einen Krieg begeistern lassen. Sein tönerner Bruder
wurde lange Zeit im alten Feuerwehrdepot verwahrt, gilt aber heute als
verschollen.

Rathaus Wieselburg
Das Rathaus wurde in den Jahren 1927 bis 1929 nach den Plänen des
Wiener Architekten Anton Valentin erbaut. Dort, wo es heute steht,
erstreckte sich früher die Gemeindeweide, eine Au- und
Wiesenlandschaft. 1890 wurde auf dem Platz vor den Aubäumen ein
öffentliches Waaghäuschen errichtet, um Tiere und Wagenfuhren abwiegen
zu können.
Architekt Anton Valentin gestaltete seinen Entwurf für das Rathaus in
expressiver Weise. Besonders auffällig sind dabei die aus der glatten
Fassade spitz herausragenden Erker, die Valentin beim Rathaus an die
Ecken des Baukörpers rückte. Als Anlehnung an große historische
Rathausbauten setzte der Architekt einen turmartigen Baukörper ins
Zentrum des Gebäudes. Der Zugang zum Amtsgebäude über einen breiten
Stufenaufgang und durch zwei halbe Rundbögen greift ebenfalls die
Typologie des Amtshauses auf und lässt die Wichtigkeit des Ortes
bereits erahnen. Die unterschiedlichen Fensterformen am Rathaus sind
besonders interessant. Ursprünglich waren sie so nicht vorgesehen, wie
an den halbrunden Fenstern an der Grestner Straße zu sehen ist. Diese
wirken wie stilisierte Fabriksfenster – dahinter lag der Schalterraum
des Post- und Telegrafenamtes. Die rückwärtige Fassade des Rathauses
ist von einem breiten, beinahe durchgängigen Fensterband geprägt.
Dieses sorgt für die optimale Lichtzufuhr im Stiegenhaus. Das
Stilelement der langen Fensterbänder hat Valentin in den 1930er Jahren
vor allem bei der Planung seiner Wiener Einfamilienhäuser eingesetzt.
Für die damalige Zeit war die Verglasung einer größeren Fläche eine
bahnbrechende Errungenschaft und eine statische Herausforderung.
Von Beginn an wünschte Bürgermeister Fahrner einen repräsentativen
Rathausbau. Diesem Anliegen trug Architekt Anton Valentin unter anderem
durch das Anbringen der Turmuhr Rechnung. Die Turmuhr ist in eine
Fassadenmalerei in Secco-Technik von Rudolf Holzinger eingefügt, die
eine Tag- und eine Nachtseite erkennen lässt. Die Turmkante trennt die
beiden größten Figuren des Freskos, den Erzengel Michael als Ritter und
den Drachen. Michael, auf der „Tagseite“ dargestellt, ist Seelenführer
und Beschützer der Christen sowie Schutzherr zahlreicher Berufe. Er
verbannte den Drachen, Symbol der Finsternis, mit dem Flammenschwert
aus dem Himmel.

Während die meisten Kriegerdenkmäler eine Soldatenfigur zeigen, befindet sich im Zentrum des 1932 eingeweihten Wieselburger Kriegerdenkmals
eine trauernde Frauenfigur. Sie symbolisiert einerseits die Trauer der
vielen Ehefrauen und Mütter, die ihre Männer und Kinder verloren haben,
andererseits stellt sie die Beziehung der Soldaten zu ihrem Leben in
der Heimat her.
Die vom Wiener Bildhauer Josef Franz Riedl geschaffene Frauenfigur ist
130 cm hoch und aus drei Keramikteilen zusammengesetzt. Der Überzug aus
brauner Engobe (Tonschlamm), der noch original erhalten ist, verleiht
der Figur ein bronzeähnliches Aussehen. Der Frauenkörper ist s-förmig
gekrümmt, der Kopf weist nach links, die verschlungenen Hände nach
rechts und das lange Gewand liegt in Falten um den Körper. Die
Frauenfigur wird von einem Bau mit polygonalem Grundriss umfasst, den
der Architekt des Wieselburger Rathauses Anton Valentin plante. Im
hinteren Bereich ist die Architektur durch ein Gitterwerk geschlossen,
nach vorne hin ist sie offen. Die sich nach unten verjüngenden, im
Querschnitt quadratischen Pfeiler tragen die Tafeln mit den Namen der
Gefallenen beider Weltkriege. Auf den Pfeilern ruhen Querbalken, einer
davon mit der Aufschrift „Unseren Helden“. Um die Keramikfigur zu
schützen, wurde 1987 in Absprache mit dem Denkmalamt dem Polygon eine
Glasüberdachung aufgesetzt, welche die Höhe des dahinter stehenden
Kreuzes leider nicht mehr zur Geltung kommen lässt.

Stadtpfarrkirche zum hl. Ulrich in Wieselburg: Geschichte
Im Zuge des ottonisch-salischen Reichskirchensystems schenkt Kaiser
Otto II. 976/979 dem später heilig gesprochenen Regensburger Bischof
Wolfgang einen Platz am Zusammenfluss der Großen und Kleinen Erlauf,
der „Zuisila“ genannt wurde. Der hl. Wolfgang errichtet dort ein
„castellum“ (= Fliehburg) zum Schutz der Mutterpfarre der gesamten
Region. In der Mitte des bewehrten Platzes lässt er eine repräsentative
Kirche erbauen.
Der hl. Wolfgang (um 924–994):
Ausgebildet in der Klosterschule Reichenau und in der Domschule
Würzburg, war er zunächst Lehrer in der Domschule von Trier. 965 trat
er ins Benediktinerkloster Einsiedeln ein und ließ sich drei Jahre
später durch Bischof Ulrich von Augsburg zum Priester weihen. Nach
kurzer Missionstätigkeit in Ungarn erhob ihn Kaiser Otto I. 972 zum
Bischof von Regensburg. Eingebunden in die politischen
Auseinandersetzungen zwischen Kaiser und bayerischem Herzog, zog er
sich einige Jahre in die Besitzungen seines Bistums in Mondsee und im
heutigen Niederösterreich zurück, wo er auch die Kirche von Wieselburg
erbauen ließ.Als Bischof waren seine Bemühungen um die Klosterreform
und um die Bildung des Klerus bedeutsam. Sein von Demut und
Menschenliebe geprägtes Wirken begründete seine Verehrung schon zu
Lebzeiten. Der oft mit einem Kirchenmodell als Hinweis auf seine
Tätigkeit als Kirchengründer und Reformer dargestellte Bischof Wolfgang
gilt als Patron der Holzhauer, Zimmerleute, Hirten und Schiffer.
Die "Kapelle am Berg"
beherbergt eine aus Lindenholz geschnitzte Grödner Pietà aus der
Bildhauer-Werkstatt Stueflesser. Die 1913 feierlich geweihte Statue war
urspünglich färbig gefasst.

Statue hl. Wolfgang - 1976
feierte Wieselburg das 1000-jährige Bestehen seines Namens. Die
bisherige Marktgemeinde wurde am 8. Mai des gleichen Jahres zur Stadt
erhoben. Aus diesem Anlass schuf der Künstler KUNIBERT ZINNER aus St.
Peter in der Au eine 2,50 Meter hohe Kunststeinfigur des hl. Wolfgang,
die beim Stiegenaufgang zur Kirche aufgestellt wurde.

Oktogon und Kirche
Die Wehrkirche Sankt Ulrich, 993 eingeweiht, ist das älteste erhaltene
sakrale Bauwerk Österreichs. Dem Bau mit quadratischem Kern und vier
vorgelagerten Kreuzarmen wurde ein Oktogon mit Kuppel aufgesetzt. Im
Innenraum befinden sich die ältesten Monumentalmalereien des
Mittelalters in Österreich. Um 1500 wurde eine zweischiffige gotische
Hallenkirche mit Kreuzrippengewölbe angebaut. 1952 geriet die Kirche
durch einen Blitzschlag in Brand. Im Zuge der Renovierungsarbeiten von
1953 bis 1958 wurde die Kirche vergrößert.

Die Wieselburger Pfarrkirche ist über die Jahrhunderte gewachsen. Ihr
größtes Geheimnis lüftete ein Brand, der aufgrund eines Blitzschlags im
Oktober 1952 ausgelöst worden war. Der Großteil der Kirche konnte
gerettet werden, das Feuer und das Löschwasser richteten dennoch großen
Schaden an und die Kirche musste von Grund auf renoviert werden. Dabei
offenbarten sich gleich mehrere Geheimnisse der Geschichte. Jener Teil
der Kirche, der immer für einen gotischen Karner gehalten worden war,
entpuppte sich als ältester Sakralbau Österreichs: das ottonische
Oktogon aus dem Jahr 993. Es ist heute ein Teil der Wieselburger
Pfarrkirche.

Das ottonische Oktogon und seine Fresken
Die Kuppel wird von einer von acht Rundfenstern belichteten Tambourzone
getragen. Die Scheitelhöhe der Kuppel beträgt 13 Meter. Der
überkuppelte Zentralbau mit seinen gleichmäßigen Seitenarmen beruhte
auf dem Grundriss eines griechischen Kreuzes. Gelbe Streifen sowie
andersfarbige Fliesen auf dem Fußboden, die teilweise durch die
Kirchenstühle verdeckt werden, markieren die Lage der Fundamente jener
Oktogonteile, die bei der gotischen Erweiterung abgetragen wurden,
ferner die Lage der 1952 entdeckten Fürnberggruft sowie
mittelalterlicher Bauten. Der östliche Seitenarm wurde 1783 im Zuge der
Aufstellung des barocken Hochaltares umgestaltet und erhöht; Nord- und
Südarm entsprechen nicht dem Originalbestand, dessen Fundamente aber
ergraben wurden.
Altarbild „Triumph des hl. Ulrich“ am barocken Hochaltar im Oktogon
Der um die Mitte des 18. Jahrhunderts entstandene Hochaltar, gefertigt
aus rotgrauem Gaming-Peutenburger Marmor, stand ursprünglich in der
Kirche der 1782 aufgehobenen Kartause Gaming. Vier Säulen tragen das
geschwungene Gebälk und flankieren das Altarbild „Triumph des hl.
Ulrich“. Es wurde erst anlässlich der Übertragung nach Wieselburg
geschaffen und später in den Altar eingearbeitet. Seitlich davon sind
Statuen der beiden Apostelfürsten Petrus (mit Himmelsschlüssel) und
Paulus (mit Schwert als Hinweis auf sein Martyrium) angeordnet. Oben im
Altarauszug rahmen Voluten die plastische Darstellung der Heiligen
Dreifaltigkeit.

"Oktogon" - vor 1000 Jahren erbaut
Nach dem Privileg von 976/979 wurde Bischof Wolfgang von Regensburg von
Kaiser Otto II. ermächtigt, am Zusammenfluß der Großen und Kleinen
Erlauf ein "Castellum" zu errichten in einem Land, das Wolfgang vorher
mit Bauern aus Baiern besiedelt hatte. Den Ort nannte man "Zuisila",
was im Zwiesel, im Zwickel bedeutet und im Wort (Z) Wieselburg
weiterlebt. Wolfgang hat einen würfelförmigen Bau (mit Kreuzarmen)
errichtet, dem ein achteckiger Teil (daher der Name Oktogon) mit einer
Zentralkuppel aufgesetzt wurde, wie er zum bevorzugten Typus der
Sakralbauten in Byzanz ab 900 entwickelt worden war. Die prächtige
Freskoausmalung der Wände mit kreisrunden, bunten Medaillons bis in die
13,5 m hohe Kuppel gehört zu den ältesten Monumentalmalereien des
Mittelalters in Österreich vom Ende der vorromanischen Epoche. Die
Entstehungszeit ist bald nach der Erbauung der Kirche um 1000
anzusetzen.
Oben in der Kuppel befindet sich als zentrale Figur der Weltenherrscher
(Pantokrator, mit Buch?), darunter ein Band von wahrscheinlich
ursprünglich neun Medaillons mit Halbfiguren samt Heiligenschein und
Flügeln als Symbole für die neun Chöre der Engel. Darunter zwischen
rundbogigen Fenstern Reste von wohl acht Medaillons ohne erkennbare
Darstellungen, deren Programm aber aus der Umschrift darüber als die
Seligpreisung aus den Anfängen der Bergpredigt erschlossen werden kann.
In den Trompen links und rechts des Altares sind in den Medaillons je
zwei Evangelistensymbole (Stier und Adler, Mensch und Löwe) zu sehen,
an der Ostwand außerdem zwei Rundfenster mit Schachbrettmuster in den
Leibungen. Im Erdgeschoß befinden sich Reste von weiteren Medaillons:
Apostel und Propheten (?), alle ohne erkennbar gebliebene Darstellung.
Sehr zum Leidwesen aller sind die Fresken nur fragmentarisch erhalten,
so daß im Zuge der Restaurierung durch das Bundesdenkmalamt keine
Ergänzungen gewagt werden konnten.
Kronleuchter - Der mächtige
Radleuchter aus Stahl und Eisenblech ist ein Werk des
niederösterreichischen Künstlers FRANZ KATZGRABER aus dem Jahr 1968. Er
erinnert bewusst an früher in romanischen Kirchen übliche Radleuchter
oder Lichtkronen und symbolisiert mit seinen turmartigen Zinnen und
Toren das „Himmlische Jerusalem“ aus der Offenbarung des Johannes.

Der hl. Ulrich (um 890–973)
Der hl. Ulrich wird als Wieselburger Kirchenpatron zwar erst 1235/1237
genannt, ihm wird die Kirche aber von Anfang an geweiht gewesen sein.
Als Bischof von Augsburg (923–973) hatte er maßgeblichen Anteil am Sieg
in der Schlacht auf dem Lechfeld gegen die Ungarn 955, die zur
Befreiung des heutigen westlichen Niederösterreichs führte. Bischof
Ulrich war der väterliche Freund des hl. Wolfgang, den er 968 zum
Priester geweiht hatte. Ulrich wurde 993, erstmals in der
Kirchengeschichte offiziell vom Papst, heilig gesprochen. Damals ließ
Wolfgang auch die Wieselburger Kirche vollenden. Dargestellt wird
Ulrich meist in bischöflichen Gewändern mit Buch und Fisch. Der Fisch
als Attribut bezieht sich auf die Legende, wonach Ulrich wegen der
Nichteinhaltung des Fastengebotes am Freitag verleumdet werden sollte.
Doch das als angeblicher Beweis präsentierte Bratenstück verwandelte
sich in einen Fisch. Der als Bischof mutige und barmherzige Heilige
wurde Fürsprecher gegen Überschwemmungen und Hochwasser und um Heilung
bei Augenleiden angefleht. Sein Gedenktag ist der 4. Juli.
Nach einem Konzept des Wieselburger Stadtpfarres Franz Dammerer ruht
der Volksaltar im Oktogon auf sieben Säulen aus hellem und dunklem
Holz, als Symbol für die sieben Sakramente. Rechts davon steht ein
spätgotisches Taufbecken aus
rotbraunem Marmor (Anfang 16. Jh.; Deckel modern); es trägt am Sockel
ein zierliches Taufsymbol in Wappenform, ein Relief des Propheten Jona
mit dem Walfisch.

Das spätgotische Langhaus
Das zweischiffige, vierjochige Langhaus der spätgotischen Kirche (20,50
m lang und 10,50 m breit)wirkt heute beim Eintritt von Norden her wie
eine geräumige Vorhalle; drei schlanke, hoch aufragende Mittelsäulen
stützen das Kreuzrippengewölbe, das im östlichen Joch etwas reicher
ausgebildet ist und zwei reliefierte Schlusssteine aufweist: der rechte
trägt ein Wappen, der linke ein Marienantlitz, offenbar das Brustbild
einer Ährenkleidmadonna, ein besonders in der Spätgotik verehrtes
Gnadenbild-Motiv. Es wurzelt in der theologischen Auffassung, dass
Maria die Gnadenähre ist, die den Weizen Christus als das wahre
Himmelsbrot hervorbringt.
Dieses spätgotische Bauwerk ist von bemerkenswert guter Qualität. Dazu
kommt noch, dass die Zweischiffigkeit von gotischen Kirchen eher selten
ist. Besonders zu empfehlen ist der Blick vom Hochaltar der neuen
Kirche aus in das gotische Kirchenschiff.

Orgel - Auf der Seitenempore
des Hauptschiffes steht die am 12. Juni 1960 eingeweihte, ab 1959 in
der Orgelbauwerkstatt GREGOR HRADETZKY in Krems erbaute
Schleifladenorgel. Sie besitzt zwei Manuale mit 16 Registern und war
die erste mechanische Orgel aus der Werkstatt Gregor Hradetzkys des
Jüngeren. Die Reliefs der beiden Haupttore beim Nordportal entstanden
1964 nach Entwürfen von ROBERT HERFERT. Die dargestellten Motive sind
Taube und Flamme als Opfer des Alten Bundes sowie Brot, Kelch und
Weintrauben als Opfer des Neuen Bundes.

Alte Kirchhofmauer gegenüber dem Kirchenturm
Diese Mauern waren ursprünglich Teil eines Bruchsteinhauses des
gotischen Dorfes "Berg", das sich anschließend an die alte Kirche
entwickelt hatte. Die Bevölkerung hat langsam begonnen, im Tal nach dem
Zusammenfluß der Erlaufflüsse ihre neuen Häuser zu bauen. Für den um
1500 errichteten gotischen zweischiffigen Anbau an das "Oktogon" hat
man die noch stehenden Hausmauern zur Steingewinnung abgetragen, aber
einzelne Hauswände stehen gelassen, die seither als Kirchhofmauer
dienen. Ihr abgewinkelter Verlauf ist dadurch zu erklären.

Apsis-Mosaik Christus Pantokrator
Die künstlerische Ausgestaltung des neuen Kirchenschiffes prägen die
Glasmalerei der Fenster sowie die ebenfalls farbkräftigen drei Mosaike
über den Altären, die mit Farbkeramiksteinen und Gold- und
Silberplättchen gestaltet wurden. Es sind Frühwerke des St. Pöltener
Künstlers ROBERT HERFERT aus den Jahren 1960–1962. Das zentrale Motiv
der Apsis hinter dem Hauptaltar ist, in Wiederaufnahme des Kuppelbildes
im Oktogon, die monumentale Darstellung von Christus als
Weltenherrscher, eingebunden in die Dreifaltigkeitsthematik. So ist
links oben die auf das Haupt Christi weisende Hand Gottvaters zu
erkennen und rechts am Nimbus der Heilige Geist in Taubengestalt. Aus
den Handwunden Christi fließt der Gnadenstrom auf das Volk Gottes,
symbolisiert durch zwei für die Region wichtige Heilige in Begleitung
von Männern und Frauen: links vom Betrachter aus gesehen der hl.
Leopold, der Babenberger Markgraf Leopold III. (um 1073–1136), Patron
von Österreich und des Landes Niederösterreich, rechts gegenüber die
Jugend, angeführt vom hl. Bischof Wolfgang, dem Gründer der ersten
Kirche von Wieselburg. Die beiden barocken Engel wurden anlässlich der
50-Jahr-Feier der dritten Kirche im Jahr 2008 hier angebracht.

Linker Seitenaltar - Thema des
Mosaiks ist der „Hl. Joseph als Patron der Sterbenden“. Der Nährvater
Jesu ist hier als Fürsprecher der Arbeiter und für einen guten Tod
dargestellt. Die Statue des hl. Wolfgang, eine Spende des örtlichen
Lions-Club, schnitzte der Scheibbser Bildhauer JOSEF LECHNER (1995).
Kanzel - Die 1956 angebrachte
Kanzel mit einer Verkleidung aus grünen Serpentinplatten stammt von
SEPP ZÖCHLING, der auch die 1994 abgebaute Kommunionbank anfertigte.
Der Kanzelkorb als Ort der Verkündigung des Evangeliums ist geschmückt
mit Darstellungen Christi und der vier Evangelisten mit ihren
Attributen: Matthäus (Engel), Markus (Löwe), Lukas (Stier) und Johannes
(Adler) – angelehnt an die Medaillons im Oktogon, aber in moderner
Formensprache.
Rechter Seitenaltar mit
spätgotischer Madonna - Das Mosaik zeigt die Verkündigung an Maria
durch den Erzengel Gabriel. Auf dem Altartisch steht eine wertvolle
spätgotische Statue, die Madonna mit Kind aus der Zeit um 1510; die
Pfarre Wieselburg hatte diese Statue 1961 der Kapelle des
Bildungshauses St. Pölten als Leihgabe überlassen, 1996 kam sie auf
Initiative von Stadtpfarrer Franz Dammerer wieder zurück in die
Pfarrkirche.
Farbglasfenster - 6.
KreuzwegstationDie 1960 von ROBERT HERFERT in Absprache mit dem
damaligen Pfarrer Leopold Teufel entworfenen fünf großen
Farbglasfenster der Westseite zeigen Symbole aus der Passion Christi:
Ölzweig, Dornenkrone, Krone, Kelch mit Blutstropfen Christi und Hostien.

Mauerreste der Burg von Wieselburg (Vor dem Durchgang zum Friedhof)
Rechteckiger Bau aus gemörtelten Bruchsteinen aus dem
(fortgeschrittenen?) 11. Jahrhundert. Damals wahrscheinlich "Festes
Haus" oder nur "Haus" genannt. Es war mehrere Stockwerke hoch, der
Eingang war durch eine einziehbare Leiter im 1. Stock üblich. Im
Verband mit diesem Bau, also gleichzeitig, wurde um 1000 auf der
erhöhten Wallanlage (im Halbkreis von der Großen zur Kleinen Erlauf)
eine breite Bruchsteinmauer errichtet, vor der ein vorhandener Graben
vertieft worden ist. In diesem Graben wurde 1961 die Zufahrt zur
Leichenhalle angelegt, die deswegen "Burggrabenweg" benannt wurde. Der
Durchbruch der Bruchsteinmauer zum Friedhof ist mit dessen Errichtung
1877 anzusetzen. Vorher lag der Friedhof rund um die Kirche.
Kreuzwegstationen - Unter dem
Fenster beim Marienaltar beginnt die Reihe der Kreuzwegbilder. Die
alten Kreuzwegstationen (wahrscheinlich um 1820), die nach dem
Kirchenbrand 1952 ausgelagert und in der neuen Kirche durch moderne
Terrakotta-Reliefs ersetzt worden waren, ließ man 1994 durch Franz
Aschauer aus Wieselburg restaurieren und brachte sie wieder hier im
Kirchenraum an. Die Kreuzwegbilder wurden so angebracht, dass sie die
„drei Kirchen“ miteinander verbinden. Gleichzeitig wurde neben dem
Sakristeiportal eine barocke Tragfigur des auferstandenen Christus (um
1750) aufgestellt.

Auf Wunsch von Dechant Franz Dammerer sollte am Kirchenplatz ein
Friedenskreuz und kein „Krieger-Denkmal" stehen. Der Plan: Auf
kreisförmigem Fundament (der Kreis ist das Symbol des Vollkommenen)
steht der dreieckige Altar. Das Dreieck soll die Dreifaltigkeit
symbolisieren. Darüber erhebt sich in Nirostahl das Symbol des Kreuzes,
das aber in seine einzelnen Elemente aufgespaltet ist. Eine vergoldete
Kugel im Kreuzungspunkt soll den verklärten Leib Christi
versinnbildlichen. Gleichzeitig sind die Balken des Kreuzes als „Arme
Gottes" zu sehen, die eine Kugel tragen. Diese Kugel, der Erdball, ruht
wohl behütet in Gottes Hand. Und so beschützt möge Friede und Eintracht
herrschen. Altpfarrer Leopold Teufel hat dies mit dem Spruch „FRIEDE
DER HEIMAT FRIEDE DER WELT" vorgeschlagen. Errichtet wurde dieses
Denkmal vom St. Pöltner Schlosser Anton Fasching und vom
Kameradschaftsbund Wieselburg. Leitung: Obmann Josef Hofmarcher /
Entwurf: Hannes Scheruga
Das Friedenskreuz wurde am 31. Mai 1992 von Pfarrer Franz Dammerer gesegnet.

Der Kirchenberg
Modell des ursprünglichen KirchenbergesDieser mehr als 20 Meter hohe
Geländesporn mit runder Fläche im Zwickel und einem Durchmesser von 120
Metern war von Natur aus nach zwei Seiten durch die steilen
Uferböschungen der beiden Erlaufflüsse abgesichert. Ein
halbkreisförmiger Wall mit Graben schloss die um 900 entstandene Anlage
vom Hinterland ab. Deren nördlicher Verlauf wird heute noch durch die
Wegbezeichnung „Burggraben“ (Zufahrt zum Friedhof) wachgehalten. Das in
weiteren Bauphasen verstärkte, von einer massiven Bruchsteinmauer
gekrönte Wallgrabensystem wurde durch einen turmartigen Rechteckbau
(Wohn- und Fluchtort) an der höchsten Stelle des Geländes im Bereich
des heutigen Durchgangs zum neuen Friedhof zusätzlich gesichert.
Die Wehrfunktion des befestigten Kirchenbergs stand in engem
Zusammenhang mit der Wirtschaftsfunktion. Die Anlage dürfte schon früh
mit einem Markt verbunden gewesen sein. 1443 wurden die
Marktprivilegien der Siedlung „St. Ulrich am Berg“, die in gotischer
Zeit zum Dorf mit mehreren Wohnhäusern ausgebaut wurde, erstmals
bestätigt; dies war insofern eine Besonderheit, als diese Rechte nicht
der unterhalb gelegene Markt Wieselburg besaß, sondern die Siedlung am
Kirchenberg. Erst 1913 kam das zur ehemaligen Pfarrherrschaft Berg
gehörende Dorf Berg zur Gemeinde Wieselburg.
Nordansicht der (alten) Kirche

Wem der viele Text zu lange war und lieber Bewegtbilder mit Musik mag,
kann sich gerne dieses Video antun: